Ein Kommentar zu Bernd Ulrichs Artikel »Mann irrt« in der ZEIT.
11. April 2018
Das Hauptproblem am Begriff des »Patriarchats« ist, dass jeder ihn benutzt, aber niemand ihn definiert. Rebecca Solnit verwendet ihn, Laurie Penny verwendet ihn, mit der größten Selbstverständlichkeit und Lautstärke verwendet ihn Patricia Hecht in der taz, um Jens Jessen damit argumentfrei abzuschießen. Auch an der Wahl Donald Trumps war, einem Panel des »Guardian« zufolge, das »Patriarchat« schuld: Robin Morgan, Moderatorin der Radiosendung »Women’s Media Center Live«, gab sich dort überzeugt: »A diseased patriarchy is in a battle to the death with women.« Für Arwa Mahdawi, einer Marketing-Strategin, war Trumps Sieg »the last gasp of a desperate white patriarchy«. Suzanne Moore, eine Kolumnistin des »Guardian«, war überzeugt: »The patriarchy is fully restored.« Und die Beispiele für eine solche ebenso plakative wie unscharfe Verwendung des Begriffs lassen sich nahezu beliebig vermehren. Die Selbstverständlichkeit, mit der der Begriff in den Medien verwendet wird, suggeriert: es sei fraglos klar, was damit gemeint ist, die Tatbestände, die damit behauptet werden, seien über jeden Zweifel erhaben Teil unserer Realität. Und nun verwendet auch Bernd Ulrich den Begriff, prominent im Untertitel seines Artikels, um seinen Argumenten gegen Jens Jessen Kontext und historische Tiefe zu verleihen:
»Macht es uns nicht freier, ist es nicht erwachsener und auch weniger stressig, freiwillig in die Verantwortung für das Patriarchat einzutreten, als ständig alle Vorhaltungen zurückzuweisen und zu schreien: ›Ich war’s nicht, Weinstein ist es gewesen!‹?«
DIE ZEIT 16, 2018, S. 60
Was versteht Ulrich unter »Patriarchat«? Eine direkte Definition erhalten wir auch von ihm nicht. Aber wir können es aus dem Kontext erschließen. Wie viele andere Kritiker stört sich auch Ulrich an den Übertreibungen Jessens, aber er verweist auf die Wut dahinter und konstatiert beinahe milde:
»Nun ja. Das muss dann wohl alles erst mal abgetragen werden, bevor über das wirklich Wichtige gesprochen werden kann.«
Auf dieses »Wichtige« kommt er nach ein paar weiteren durchaus konzilianten Wendungen alsbald zu sprechen. Der zweite, durch Kapitälchen ausgewiesene Hauptabschnitt des Artikels beginnt mit dem Satz:
»Es gibt etwas wirklich Irritierendes und auch Empörendes am Text von Jens Jessen. Er versucht die Unterdrückung von Frauen zu historisieren und zu marginalisieren.«
Das ist ein bemerkenswerter Satz. Denn da die »Unterdrückung von Frauen« ohnehin in Breite historisch aufgearbeitet und insofern anerkannter Teil der Geschichte ist: was ist denn dann an »Historisierung« zu beanstanden? Das dürfte an einer zweiten Bedeutungskomponente der Vokabel liegen, die Ulrich ein paar Sätze später als »Vergestrigung« umreißt, und auf diese Bedeutung verweist auch der Vorwurf der »Marginalisierung«. Ulrichs Sorge ist:
»Damit soll wohl gesagt sein, sexualisierte Gewalt sei auf dem Rückzug, nur mehr etwas, das aus einer tiefen Vergangenheit gelegentlich und vorläufig noch in unsere lichte Gegenwart ragt.«
Allerdings kontert er diese Implikation Jessens nicht mit einer Darlegung von anerkannten Sachverhalten, sondern mit persönlichen Impressionen:
»Mein Eindruck in letzter Zeit war eher, dass es mehr männliche Gewalt gegen Frauen und Mädchen gibt, auch in liberalen und gebildeten Kreisen, als ich es mir jahrelang einzureden versuchte.«
»Patriarchat« ist also offenbar im Wesentlichen sexuelle Gewalt – und damit das, was die #metoo-Debatte, in deren Kontext Jesssen und Ulrich schreiben, verlangt, dass der Begriff enthalten muss. Für Rebecca Solnit muss der Begriff weibliches Schweigen enthalten, für Laurie Penny psychisch verkorkste Männlichkeit, für Robin Morgan, Arwa Mahdawi und Suzanne Moore reaktionäres politisches Denken – oder was man gerade dafür hält. Und damit sind wir schon recht geradewegs auf eine zentrale Funktion dieser Begriffsverwendung gestoßen: der Begriff des »Patriarchats« muss regelmäßig dafür herhalten, subjektiven Impressionen, persönlichen Werturteilen und fragwürdigen Tatsachenbehauptungen gleich welcher Provenienz, aber im Dunstkreis des Feminismus, die Aura eines systematischen Zusammenhangs zu verleihen, die Illusion einer tiefen historischen Wohlbegründetheit, die angeblich nicht infrage zu stellen sei, ohne sich außerhalb der zivilisierten Menschheit zu stellen. Und dann wird Ulrich doch noch ein bißchen ausführlicher und erläutert:
»Erstmals in der Geschichte der Menschheit kann nun also dem Mann etwas widerfahren, das doch bislang nur den Frauen vorbestimmt war: Er kann wegen seines Geschlechts diskriminiert und angegriffen werden, er ist unter Umständen schutzlos der Niedertracht von Frauen ausgeliefert. Das ist da, wo es wirklich geschieht, furchtbar, vor allem aber ist es eine Weltneuheit: Diskriminierung jetzt auch für Männer! Eines jedoch wird dabei gern vergessen, und auch Jens Jessen unterschlägt es: Dass Männer ohne Beweise wegen sexueller Nötigung oder Schlimmerem ins soziale Abseits geraten können, ist lediglich die Kehrseite eines anderen, weit häufigeren Tatbestands, dass nämlich Frauen sexuelle Nötigung oder Schlimmeres erleben und der Mann anschließend straffrei ausgeht, weil es in der Natur der Sache liegt, dass es meistens keine Beweise gibt. Es handelt sich hier also keineswegs um eine totalitäre Attacke des Feminismus, sondern um ein tragisches Dilemma, das Frauen schon immer getroffen hat und Männer neuerdings treffen kann.«
Da ein alleinstehender Facepalm an dieser Stelle wenig hilfreich und nachvollziehbar ist, wiederhole ich nachstehend einen Abschnitt, mit dem ich im vergangenen November einen SPIEGEL-Artikel von Jakob Augstein kritisiert habe und ihm vorwerfe, sein Plädoyer für den Terror mit einer Geschichtsklitterung zu legitimieren. Selbstzitat: Die »Urszene« einer weiblichen Falschbeschuldigung finden wir bereits in der Bibel, in der Geschichte von Joseph und der Frau des Potiphar (Gen. 39). Ilse Lenz hat versucht, diese Geschichte im Kontext der Kachelmann-Falschbeschuldigung als »frauenfeindlich« und als eine Art patriarchaler Denunziation beiseite zu schieben, was jedoch nur dann plausibel ist, wenn man Machtverhältnisse, die nicht auf Geschlechts-, sondern auf Klassenunterschieden beruhen (in diesem Fall zwischen Herren und Sklaven, denn Joseph wurde als Sklave verkauft) mutwillig ignoriert. Denn die »die Möglichkeit, den anderen jederzeit und ohne nennenswertes eigenes Risiko zu gefährden oder zu erniedrigen« [das ist jetzt ein Augstein-Zitat], hat jeder Angehörige eines ranghöheren Standes gegenüber Angehörigen eines rangniederen Standes ganz unabhängig vom Geschlecht. Es gehört zum Kern des intellektuellen Elends und der tiefen Unaufrichtigkeit der feministischen Ideologie, diese simple Tatsache zugunsten eines ausschließlich auf der Geschlechtszugehörigkeit beruhenden weiblichen Opferkults unsichtbar gemacht zu haben. (Selbstzitat Ende)
Und wenngleich mit geringerem Aggressivitätspegel als Jakob Augstein, so tritt Bernd Ulrich doch in dieselbe Falle wie dieser. Seine These, dass Männer von weiblicher Willkür »neuerdings«, gleichsam historisch präzedenzlos, als Weltneuheit, betroffen seien, ist nicht wirklich ein Argument, sondern ein weiterer Beleg dafür, welche intellektuellen Verwüstungen ein analytisch entdifferenzierender, nur noch die Geschlechtskategorie als relevant wahrnehmender Begriff wie »Patriarchat« in der öffentlichen Debatte angerichtet hat. Wer historisch seriös und sauber bilanzieren will, muss dies in einer Vielzahl von Merkmalsdimensionen tun: Klasse, Stand, Prestige, Machtchancen, Eigentum, Alter, Ethnie …, und eben auch Geschlecht. Wenn man aber einen Längsschnitt durch die feministische Literatur legt, dann ist der Begriff des »Patriarchats« niemals, zu keinem Zeitpunkt, aus einer in diesem Sinne sauberen historischen Bilanzierung hervorgegangen. Eva Cyba schreibt in ihrem Beitrag zum »Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung« von 2010 unter dem Titel »Patriarchat: Wandel und Aktualität«:
»Die Anforderung an ein entsprechendes Konzept von Patriarchat im Rahmen der feministischen Theorie erfordert, dass dieser Begriff nicht ahistorisch oder ethnozentrisch, gleichzeitig aber als Konzept universell gültig ist, das alle Arten der Unterdrückung in allen Gesellschaften erfassen kann. Unter Patriarchat werden daher die Beziehungen zwischen den Geschlechtern verstanden, in denen Männer dominant und Frauen untergeordnet sind. Patriarchat beschreibt ein gesellschaftliches System von sozialen Beziehungen der männlichen Herrschaft«.
Eva Cyba, Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung, S. 17
Die Überdehnung und Zirkularität dieser Definition liegt auf der Hand: auf der einen Seite, in empirischer Hinsicht, soll es um »alle Arten der Unterdrückung in allen Gesellschaften« gehen, auf der anderen Seite aber, in theoretischer und analytischer Hinsicht, wird die Bandbreite der Ursachenbestimmung auf »soziale Beziehungen der männlichen Herrschaft« eingeschränkt. Einmal entlang solcher Forschungsrichtlinien aufs Gleis gebracht, wird »feministische Wissenschaft« in empirischer Hinsicht niemals Unterdrückung von Männern durch Frauen identifizieren, und sei es vermittelt über einen Klassenzusammenhang wie im Beispiel der Frau des Potiphar, und in theoretischer Hinsicht wird sie »alle Arten der Unterdrückung in allen Gesellschaften« niemals auf etwas anderes zurückführen als auf »soziale Beziehungen der männlichen Herrschaft«. Und diese soeben zitierte Definition ist keine Grille eines überforderten Journalisten, sondern das gilt unter Feministinnen als Wissenschaft! Man könnte mich einer böswilligen Verkürzung feministischer Methodologie zeihen, würden nicht nur vergangene, sondern auch zeitgenössische, aktuelle feministische Äußerungen zum Stichwort »Patriarchat« nicht dutzend- und aberdutzendweise exakt so aussehen wie mit der Presse dieser Definition gestanzt.
Unsere Epoche ist von der Vorstellung besessen, sie könne gesellschaftliche Probleme dadurch benennen und lösen, dass sie sie zu Problemen der »Männlichkeit« deklariert. Der Mann und eine »toxische Männlichkeit« stehen stellvertretend für alle Schattenseiten, die wir an unserer modernen Zivilisation identifizieren, vom Klimawandel über Formen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und Formen der Familie bis hin zu Problemen der Gewalt in zwischenmenschlichen Beziehungen – und die Rettung unserer Zivilisation erwarten wir uns davon, dass wir Frauen mehr »Raum«, mehr »Stimme«, »Gehör« und Einfluss verschaffen – weil sich alle möglichen Problemlagen angeblich verbessern, sobald mehr Frauen oder mehr »Weiblichkeit« eine Rolle darin spielen. Und indem auf diese Weise ein analytischer Begriff der »Gesellschaft« hinter der Figur des »Männlichen« verblasst ist, ist ein anderer Systembegriff an seine Stelle getreten: der Begriff des »Patriarchats« – das Gespenst einer allgegenwärtigen, die gesamte Menschheitsgeschichte durchziehenden Superstruktur, die wiederum nichts anderes darstellt als eine Ableitungs- und Kollektivform von »Männlichkeit«. Dieser Begriff des »Patriarchats« ist ein Mythos im strengen Sinne – bis zum heutigen Tag regelmäßig zur Beglaubigung feministischer Behauptungen und Geschichtskonstruktionen beschworen, aber trotz der Bemühungen von zwei, drei oder vier feministischen Generationen niemals empirisch überzeugend dargelegt.
Ein ganz kleines bißchen fällt das im letzten Drittel seines Artikels sogar Bernd Ulrich auf, wenn er eine Maß- und Grenzenlosigkeit der feministischen Ideologie konstatiert, ohne jedoch die Tragweite seiner Beobachtung tatsächlich zu ermessen:
»Die Anforderungen des Feminismus an uns sind schließlich nicht bloß paradox, sondern auch unendlich, ja unersättlich. (…) Es brauchte eine Weile, bis ich mich auf den im Grunde sehr simplen Gedanken bringen ließ, dass es für die jungen Frauen egal ist, ob früher alles schlimmer war, dass sie Profiteurinnen von Kämpfen sind, die andere vor ihnen ausfochten. Sie sahen und sehen schlicht nicht ein, warum sie überhaupt noch irgendeinen Nachteil für ihr Geschlecht in Kauf nehmen sollten. Und sei er noch so klein.«
Und sei er noch so klein, er ist prioritär zu beseitigen, noch ehe ein männlicher Nachteil für sein Geschlecht auch nur in die öffentliche Wahrnehmung vordringen darf. Was Ulrich hier wahrnimmt, ohne es wirklich zu verstehen, ist die strukturelle Paranoia der feministischen Ideologie: so, wie die bolschewistische Ideologie notorisch unfähig war, zwischen in der Sache liegenden, objektiven Schwierigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung und dem Widerstand und der Sabotage von »Klassenfeinden« unterscheiden zu können, weil man sich ideologisch auf die Erwartung programmiert hatte, dass die »Bourgeoisie« umso stärkeren Widerstand leistet, je näher sie am Abgrund steht, so ist die feministische Ideologie notorisch unfähig, zwischen in der Sache liegenden, objektiven Schwierigkeiten und der Unterdrückung und »strukturellen Diskriminierung« durch ein »Patriarchat« und durch »toxische Männlichkeit« unterscheiden zu können, weil sie sich auf die Erwartung programmiert hat, überall »patriarchale Unterdrückung« und »hierarchische Geschlechterverhältnisse« vorzufinden. Es wird »strukturell« unmöglich, eine »emanzipierte« Frau darauf hinzuweisen, dass ihre Ansprüche Grenzen haben könnten, weil das zwangsläufig als Versuch »des Patriarchats« wahrgenommen wird, sie »klein zu halten« oder »mundtot zu machen«.
Und so endet Ulrichs Artikel damit, über die Psychologie des Mannseins zu meditieren, denn Männlichkeit ist ein »Projekt«.
»Wir können an unserer Männlichkeit arbeiten, und »der« Feminismus leistet seinen Beitrag dazu, er bestimmt uns nicht, sondern beeinflusst unsere Selbstbestimmung. Man kann ihn auch zurückweisen und muss das dürfen, aber man bringt sich damit um viele Möglichkeiten und Ideen. Männlichkeit so zu meditieren, das schafft Raum für Neugier auf sich selbst, auf die nächsten Metamorphosen des Mannseins.«
Ganz so, als hätten Männer keine Probleme, die sie nicht durch Meditation lösen könnten. Aber so sieht man das wohl in Ulrichs journalistischem und politischen Milieu fernab von Obdachlosigkeit und Scheidungskrieg. Meditierend tritt man in die Verantwortung für ein »Patriarchat« ein, das niemals mehr gewesen ist als ein Stöckchen, über das Feministinnen Männer usque ad infinitum springen lassen, um sie von ketzerischen Gedanken über sich selbst, »die Gesellschaft« und, Göttin behüte, womöglich über den Feminismus abzuhalten.
Bernd Ulrich ist brav gesprungen.

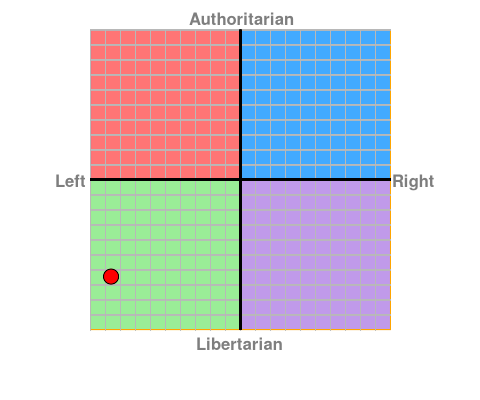
Schreibe einen Kommentar