25. Dezember 2017
Ich werde ja sofort hellhörig, wenn in öffentlichen Debatten (oder, wie man im Internetzeitalter wohl ergänzen muss, in öffentlichen Debatten von hinreichender geistiger Schöpfungshöhe) tatsächlich explizit die Vokabel vom »Patriarchat« verwendet wird. Jetzt ist sie mir in einer Zeitschrift begegnet, die ich abonniert habe, nämlich in den »Blättern für deutsche und internationale Politik«, die als »politische Fachzeitschrift« gilt und dem eigenen Anspruch nach »die größte politisch-wissenschaftliche Monatszeitschrift im deutschen Sprachraum« ist, und zu deren Herausgeberkreis unter anderem linksliberale Akademiker wie Micha Brumlik, Dan Diner, Claus Leggewie und Jürgen Habermas gehören. In der aktuellen Ausgabe 1’18 findet sich ein Artikel von Rebecca Solnit mit dem Titel »Die Geschichte des Schweigens oder: Wie das Patriarchat uns mundtot macht« (online nur hinter Paywall), der ausweislich Fußnote auf ihrem jüngst erschienenen Buch »Die Mutter aller Fragen« beruht. Da nun die Frage danach, ob und inwieweit es so etwas wie ein »Patriarchat« überhaupt gibt und gegeben hat und ob es zudem sinnvoll ist, die moderne Gesellschaft als »Patriarchat« zu bezeichnen, für mich »die Mutter aller Fragen« darstellt, habe ich mich entschlossen, meiner Lektüre des Artikels einen Blogpost folgen zu lassen.
Der Ozean des Schweigens
Rebecca Solnit eröffnet ihren Artikel mit allgemeinen Überlegungen dazu, was Schweigen im Kontext von Machtbeziehungen bedeutet, insofern es dabei um die Macht geht, jemanden zum Schweigen zu bringen oder zum Reden zu ermächtigen. Ob geredet oder geschwiegen wird, kann von Machtverhältnissen bestimmt sein, die festlegen, wer schweigen muss und wer reden darf.
»Das Schweigen ist der Ozean des Ungesagten, des Unsagbaren, Unterdrückten, Ausgelöschten und Ungehörten. Er umspült die versprengten Inseln, gebildet von jenen, denen es erlaubt ist, zu sprechen, von dem, was gesagt werden kann, und von jenen, die zuhören. (…) Worte bringen uns zusammen, das Schweigen dagegen trennt uns und beraubt uns der Unterstützung, Solidarität oder auch schlicht der Gemeinschaft, die das Sprechen stiftet oder erzeugt. (…) Wer nicht in der Lage ist, die eigene Geschichte zu erzählen, führt ein trostloses Dasein. Manchmal ist das buchstäblich so, als wäre man lebendig begraben: wenn dir niemand zuhört, … wen dir niemand glaubt, obwohl du sagst, du habest Schmerzen, wenn niemand deine Hilferufe hört oder du dich nicht mal traust, um Hilfe zu rufen, weil dir eingetrichtert worden ist, andere Menschen nicht mit deinen Hilferufen zu behelligen. (…) Geschichten retten dir das Leben. Sie sind dein Leben. Wir sind unsere Geschichten. Ein Mensch, der wertgeschätzt wird, lebt in einer Gesellschaft, in der ihre oder seine Geschichte einen Platz hat. (…) Sprache, Worte und Stimme ändern die Dinge manchmal von Grund auf – immer dann, wenn sie zu Inklusion und Anerkennung führen, Entmenschlichungen rückgängig machen und Rehumanisierung ins Werk setzen. Manchmal sind Sprache, Worte und Stimme nur die Voraussetzungen dafür, Regeln, Gesetze und Regime so zu verändern, dass sie Gerechtigkeit und Freiheit hervorbringen. Manchmal sind allein das Sprechenkönnen, Gehörtwerden und Glaubengeschenkt-Bekommen ausschlaggebend dafür, Teil einer Familie, einer Community, einer Gesellschaft zu werden. (…) Auch Armut bringt zum Schweigen. Im Kampf um die Freiheit ging es immer auch darum, Bedingungen zu schaffen, die denen, die vormals zum Schweigen gebracht wurden, zu Sprache und Gehörtwerden verhelfen.«
S. 61 ff.
Wunderbar, denke ich. So kann man zum Beispiel die Situation von abservierten Vätern beschreiben, deren Rede für ihre Kinder ausgelöscht wird, deren Kinder Wunsch, den Vater sehen zu wollen, zu dem vor der Mutter Unsagbaren gehört, oder die Situation von verprügelten Ehemännern, denen niemand im Ernst zuhört, oder das vollständige Verstummen der überwiegend männlichen Obdachlosen, deren Elend weder für sie selbst noch für die Gesellschaft, zu der sie nominell immer noch gehören, artikulierbar ist, in der sie keine Geschichte haben. So wie, in historischen Zusammenhängen, auch die Arbeiter, die die ägyptischen Pyramiden erbaut haben, oder die römischen Sklaven, die in den spanischen Silberminen zugrundegegangen sind, in denen außer Silber auch Blei und Quecksilber gefördert wurde, oder die Situation von Häftlingen des sowjetischen Gulag, von denen einige wenige nach Jahrzehnten des Leidens noch eine Chance erhalten haben, ihre Geschichten zu erzählen. Eine warme, empathische Darstellung der Wichtigkeit des Gehörtwerdens von Rebecca Solnit, voller ungetrübter und ungeteilter Zuneigung für das Menschengeschlecht.
An diesem Punkt meines Blogpost habe ich schon geschummelt. Ich habe nämlich das obige, längere Zitat manipuliert. Nicht durch Austausch von Wörtern oder Bezugnahmen, sondern einfach durch die Auslassungen, die ich nicht allein zu Zwecken der Kürzung vorgenommen habe – ich habe nämlich ebenfalls darauf geachtet, alle Formulierungen auszulassen, die das Bild einer »ungetrübten und ungeteilten Zuneigung« der Autorin für das Menschengeschlecht hätten stören können. Die konkreten Beispiele und Illustrationen nämlich, die sie in ihren Text einflicht und die sie schließlich ins Zentrum rückt, lassen diesen Eindruck des »ungetrübt und ungeteilt« alsbald schwinden:
»Gewalt gegen Frauen passiert oft als Gewalt gegen unsere Stimmen und unsere Geschichten. Sie ist die Zurückweisung unserer Stimmen – und dessen, was eine Stimme überhaupt bedeutet: das Recht auf Selbstbestimmung, auf Teilhabe, auf Zustimmung oder eine abweichende Meinung, das Recht darauf, zu leben und mitzumachen, zu interpretieren und zu erzählen. Ein Ehemann schlägt seine Frau, um sie zum Schweigen zu bringen; jemand, der sein Date oder seine Bekannte vergewaltigt, weigert sich, dem Nein seiner Opfer die Bedeutung zu lassen, die es hat: dass nämlich der Körper einer Frau unter die Gebietshoheit allein dieser Frau fällt. Die rape culture behauptet, die Aussage einer Frau sei wertlos und unglaubwürdig.«
S. 61 f.
Die Illustrationen in diesem Zitat sind für sich genommen sicherlich legitim, schließlich beruht ja das Prinzip des Beispiels auf dem Prinzip der Auswahl. Der theoretische Begriff der »rape culture« jedoch, der in diesem Zusammenhang fällt und der dazu dient, um die genannten Beispiele analytisch einzuordnen, wird weder erläutert noch sein Gebrauch durch Argumente legitimiert. Er wird als selbstverständlich vorausgesetzt, so als wäre er den angeführten Beispielen per Implikation zwangsläufig schon anwesend. Weitere von der Autorin genannte Beispiele rücken das Thema sodann in die Nähe der #metoo-Kampagne. Genannt wird Jimmy Savile, der Showmoderator mit einer jahrzehntelangen Vergangenheit als Vergewaltiger, dessen Verhalten schon 1978 in einem Interview mit dem Sex-Pistols-Mitglied John Lydon Erwähnung fand, was aber damals herausgekürzt wurde und der Öffentlichkeit darum erst 2013 bekannt wurde.
»Das Schweigen macht es Tätern möglich, unbehelligt durch ganze Jahrzehnte zu marodieren. Es ist, als hätten die Stimmen dieser prominent in der Öffentlichkeit stehenden Männer die Stimmen anderer bis zur Nichtigkeit verschluckt. Ein Akt des narrativen Kannibalismus.«
S. 63
Dann kommt Solnit auf Harvey Weinstein und die Gegenwart zu sprechen, auf Männer wie Roger Ailes (Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung), Bill Cosby (Anklage wegen sexueller Belästigung), Jian Gomeshi (Anklage wegen sexueller Belästigung) und Dominique Strauss-Kahn (Anklage wegen sexueller Belästigung).
»Sie alle waren Männer mit Macht, die wussten, dass ihre Stimme und ihre Glaubwürdigkeit die derer übertönen würde, gegen die sie tätlich geworden waren. Was so lange gutging, bis etwas brach: bis das Schweigen gebrochen wurde, ein ganzer Ozean an Geschichten heranrauschte und ihre Immunität hinfortspülte. (… ) Diese endlich gehörten Stimmen verkehren die Machtverhältnisse. (…) Stars haben ihre Karrieren selbst zerstört, indem sie in dem Glauben handelten, eine mit der Ohnmacht der Opfer einhergehende Straffreiheit zu genießen. (…) Wenn wir neu definieren, wessen Stimme Wertschätzung entgegengebracht wird, definieren wir auch unsere Gesellschaft und ihre Werte neu.«
S. 64 f.
Ersichtlich wird von der Autorin in der Auswahl der konkreten Beispiele das Deutungsmuster von den männlichen Tätern und den weiblichen Opfern befüttert. Dass dies kein Zufall ist, sondern einer jahrzehntelang eingeübten feministischen Perspektive folgt, zeigt der folgende Abschnitt, der sich in wenig überraschender Weise mit der männlichen Seite dieses Schweigens befasst und die Überschrift trägt: »Jeder Mann eine Insel – das männliche Schweigen«.
Der Mann als emotionaler Krüppel
Ich habe eingangs angedeutet, dass sich der gesamte Einleitungsabschnitt des Artikels, gleichsam die »Präambel«, problemlos auch auf typische Situationen beziehen lässt, in denen Männer sich wiederzufinden pflegen. Solnits Thesen über das »männliche Schweigen« machen nun aber unmißverständlich klar, dass Männer auf dieser Seite der Erzählung, als Opfer von Schweigekartellen und Sprachlosigkeit, nicht vorgesehen sind. Für die Hauptthese meines Blogposts ist zudem entscheidend, wie dieser Abschnitt eingeleitet wird:
»Im Patriarchat ist das Schweigen omnipräsent.«
S. 65
Noch auffälliger als beim zuvor verwendeten Begriff der rape culture ist hier die Unmittelbarkeit, Voraussetzungs- und Begründungslosigkeit, mit der dieser Begriff ins Spiel gebracht wird, ohne dass dafür eine irgendwie geartete Begründung nachgeliefert würde. Der Begriff des Patriarchats setzt einen axiomatischen Bezugsrahmen, von dem (nach offenkundiger Überzeugung der Autorin) wesentliche Plausibilisierungen ausgehen, der aber selbst keiner Plausibilisierung bedarf. Welche Rolle und Funktion dem Mann im großen gesellschaftlichen Schweigen zukommt, zitiert Rebecca Solnit bei der afroamerikanischen Feministin bell hooks:
»(D)as Patriarchat verlangt von jedem Mann, Akte der psychischen Selbstverstümmelung an sich vorzunehmen und die emotionalen Anteile seiner selbst abzutöten. Ein Individuum, das diese emotionale Selbstverkrüppelung nicht erfolgreich betreibt, muss damit rechnen, dass patriarchalische Männer entsprechende Machtrituale einsetzen, die sein Selbstwertgefühl angreifen.«
S. 65
Solnit ergänzt hooks sodann mit der Aussage:
»Für die Ordnung des Patriarchats ist es unerlässlich, dass Männer sich zunächst selbst zum Schweigen bringen. (…) Was bedeutet, dass Männer lernen müssen, nicht nur gegenüber anderen zu schweigen, sondern auch mit sich selbst nicht zu kommunizieren über Aspekte des eigenen Innenlebens und Ichs.«
S. 65
Diese These ist nicht neu – sie ist gewissermaßen das feministische Standard-Defizitmodell der männlichen Persönlichkeitsentwicklung. In der sogenannten »Matriarchatsforschung« und im psychoanalytisch orientierten Feminismus wurde versucht, ein solches Modell historisch und psychologisch zu begründen, seine Fortsetzung findet es beispielsweise in jüngeren Theorien von der »männlichen Hegemonialität«. Als Beispiel sei hier eine entsprechende Formulierung von Carola-Meier Seethaler genannt:
»Der Preis für die Autonomie des männlichen Bewusstseins ist die Verdrängung der Abhängigkeitsgefühle ins Unbewusste oder ihre Verschiebung ins Irrational-Romantische, und daraus folgt die emotionale Infantilität des patriarchalen Mannes und der modernen Mentalität überhaupt. Den brillanten Errungenschaften unserer rationalen Kultur steht die Unfähigkeit zur Bewältigung emotionaler Probleme gegenüber, die Hilflosigkeit angesichts psychischer Leiden, Alter und Tod und die Unfähigkeit, mitmenschliche Beziehungen offen und partnerschaftlich zu gestalten.«
Meier-Seethaler 2011, S. 265
Tatsächlich ist dieses Modell ein Schlüsselelement in der feministischen Theorie des Patriarchats, weil diese damit sozusagen »theoriestrategisch« den Anspruch erhebt, eine psychosoziale Grundstruktur identifiziert zu haben, die sich über alle historischen Epochen und Klassenunterschiede hinweg wiederfinden lässt. Es beruht auf der These einer defizitären Emotionalität des Mannes und qualifiziert spiegelbildlich die Frau zu einem qua Emotionalität höher entwickelten Mitglied der Gesellschaft. In diesem Modell verschwimmt jedoch die Grenze zwischen (empirisch zu erörternden) unterschiedlichen männlichen und weiblichen Persönlichkeitstypen einerseits und pathologischen Persönlichkeitsentwicklungen andererseits. »Männlichkeit« wird in ihm per se in eine Defizitperspektive gerückt, indem im Rückblick auf die Menschheitsgeschichte seit dem Ende der Altsteinzeit eine im Saldo negative Zivilisationsbilanz erstellt und eine psychische Grundverfassung des Mannes als deren Ursache identifiziert wird. Dass der Mann »im Patriarchat« emotional abgetötet und psychisch verstümmelt sei, ist insofern kein empirischer Befund, sondern ein ätiologischer Mythos, der eine innerhalb der feministischen Weltanschauung vorgenommene Wertung der Zivilisationsgeschichte begründen und beglaubigen soll. Die Vorstellungen eines »Patriarchats« und des psychisch defizitären Mannes stützen sich gegenseitig und bilden ein System von Axiomen, das konkreten historisch-empirischen Urteilen immer schon vorausliegt und insofern selbst nicht falsifizierbar ist. Dass dem tatsächlich so ist, lässt sich am weiteren Verlauf von Solnits Argumentation aufzeigen. Zunächst einmal ergänzt sie, dass der emotionale Zustand des »patriarchalen Mannes« dem eines Zombies gleiche:
»Als ich diese Passage bei bell hooks las, lief es mir kalt den Rücken hinunter, weil ich plötzlich begriff, dass wir es hier mit dem Plot eines Horror- oder Zombiefilms zu tun haben. Die fühllos Gemachten spüren den Lebenden nach, um auch deren Gefühle zu eliminieren – entweder indem sie ihre Opfer dazu bringen, sich ihrer Erstarrung anzuschließen, oder indem sie sie einschüchtern, angreifen oder vergewaltigen – und dadurch mundtot machen.«
S. 65
»Gender-Gewalt«
Sodann bezieht sie sich auf zwei Themen von »Gender-Gewalt«: erstens auf häusliche Gewalt, zweitens auf den Umgang mit Vergewaltigungsfällen an amerikanischen Universitäten, die unter dem Etikett campus rape seit Jahren ein Thema der öffentlichen Debatte in den USA und darüber hinaus sind. Zu ersterem Thema schreibt sie:
»Viele Morde unter dem Vorzeichen häuslicher Gewalt sind eine Strafe oder Versuche, die Kontrolle zu behalten über Frauen, die angekündigt haben, gehen zu wollen, die versucht haben, zu gehen, oder die gegangen sind. Jemanden zu töten bedeutet, seine oder ihre Freiheit zu töten und ihre Autonomie, ihre Macht, ihre Stimme gleich mit. Dass viele Männer glauben, es sei ihr Recht und eine Notwendigkeit, Frauen zu kontrollieren – ob gewaltsam oder anderweitig –, sagt eine Menge aus über die Glaubenssysteme, in denen sie leben, und über die Kultur, in der wir existieren.«
S. 66
Dieser Absatz ist als solcher, zumindest in den ersten beiden Sätzen, nicht falsch, denn zweifellos gibt es häusliche Gewalt, die genau darauf beruht, dass Männer eine vermeintlich oder tatsächlich bedrohte Autorität glauben verteidigen zu müssen. Jeder sogenannte »Ehrenmord« an Töchtern mit einem Willen zu eigenständigen Lebensentscheidungen fällt in diese Kategorie (wobei freilich die Mitwirkung der Mütter durch Delegation von Gewalt einbezogen werden müsste). Das Problem an Solnits Text besteht darin, dass dies auch schon alles ist, was die Autorin zum Thema der häuslichen Gewalt zu sagen hat. Die gesamte Diskussion über die annähernde Gleichverteilung häuslicher Gewalt (siehe Hamel/Nicholls 2013) scheint an ihr vorübergegangen zu sein, sie führt – in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift! – keinen einzigen Literaturverweis an, der erkennen ließe, worauf sie sich empirisch zu stützen gedenkt, und es ist nicht einmal ansatzweise erkennbar, wie sie denn größere Zahlen weiblicher Täterschaft bei häuslicher Gewalt würde erklären können, es sei denn vielleicht dadurch, dass es sich dann um legitime Notwehr handeln müsse. Für ihre Bezugnahme auf die amerikanischen »campus rapes« wiederum gebe ich ein längeres Zitat wieder:
»Viele Vergewaltigungsfälle stoßen die Opfer in die Mühlen der Gerichts- und Universitätsbürokratie, wo sie durch die Fragen des Verwaltungspersonals weiterer Diskreditierung und Herabsetzung unterworfen sind. (…) Entscheidungsträger an Universitäten und Gerichten scheinen sich häufig mehr um die Zukunft von Campusvergewaltigern zu sorgen als um deren Opfer und neigen dazu, Ersteren mehr Glaubwürdigkeit zuzugestehen als Letzteren. (…) So also vollzieht sich Zwangskontrolle sowohl auf häuslicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Darüber, wie mit Opfern umgegangen wird und wie weitverbreitet die Toleranz epidemisch auftretender Gewalt ist, wird Frauen beigebracht, dass sie einen geringen Wert haben, dass sie eventuell noch mehr bestraft werden, wenn sie den Mund aufmachen, und dass es womöglich die bessere Überlebensstrategie sein könnte, zu schweigen. Exakt dieser Zusammenhang wird manchmal als rape culture, also Vergewaltigungskultur bezeichnet, aber genau wie bei der häuslichen Gewalt stellt dieser Begriff den Fokus eher eng auf eine einzelne Tat, statt das Motiv vieler in den Blick zu nehmen. Der Begriff ›Patriarchat‹ ist in dieser Hinsicht umfassender und besser zu gebrauchen. Die Epidemie der Vergewaltigungen an Universitäten gemahnt uns daran, dass diese Form der Straftat nicht von einer Gruppe begangen wird, die man als marginalisiert abtun könnte; innerhalb von Studentenverbindungen an Elite-Unis wie Vanderbilt oder Stanford hat es schon ganz besonders abscheuliche Vorfälle gegeben. Jedes Frühjahr macht wieder die nächste Horde ungestraft davongekommener Vergewaltiger an unseren besten Universitäten ihren Hochschulabschluss.«
S. 66 f.
Auch zu diesem Thema gibt es keinen einzigen Literaturverweis. Es dürfte auch ein Euphemismus sein, Solnits Darstellung als »einseitig« zu charakterisieren. Nicht ein einziger der zahlreichen Kritikpunkte, die zum Umgang amerikanischer Universitäten mit mutmaßlichen sexuellen Übergriffen vorgebracht wurden, wird von ihr zur Sprache gebracht, geschweige denn das Thema der Falschbeschuldigungen. Mindestens ansatzweise hätte sie erklären müssen, wie sie Einwände der Art, wie sie zum Beispiel in Johnson und Taylors »The Campus Rape Frenzy« vorgebracht werden, zu entkräften gedenkt: dass nicht eine von fünf, sondern nur eine von vierzig Frauen an Colleges von sexuellen Übergriffen betroffen ist, dass die Anzahl solcher Übergriffe nicht wie behauptet alarmierend zugenommen hat, dass es auf einem Collegegelände für Frauen nicht wie behauptet gefährlicher zugeht als außerhalb davon, dass die große Mehrzahl der tatsächlich stattfindenden Übergriffe nicht wie behauptet von Serientätern begangen wird, und dass nicht wie behauptet 90 bis 98 Prozent der Beschuldigten auch tatsächlich schuldig sind. (Johnson/Taylor 2017, S. 43 ff.) Ebenso ließe sich einwenden, dass sich an vielen Universitäten eine juristische Standards aufweichende Parallelgerichtsbarkeit etabliert hat, dass eine Logik des Verdachts gegen Männer Frauen dazu einlädt, Falschbeschuldigungen als bequeme Entschuldigung für nachträglich bereute Begegnungen vorzubringen und dass schließlich in besonders spektakulären Fällen wie dem von Paul Nungesser und Emma Sulkowicz, eine offenkundige Falschbeschuldigerin in der Öffentlichkeit zur Heldin des Kampfes gegen die angebliche »Rape Culture« stilisiert wird, ohne dass sich irgendjemand für die tatsächlichen Umstände des Falles interessieren würde. Und schließlich werden, wie zum Beispiel im Fall von Laura Kipnis, von derselben Parallelgerichtsbarkeit auch Professoren unter Druck gesetzt, die den Mut aufbringen, dieses System zu kritisieren.
Angesichts dieser Weigerung von Rebecca Solnit, auch nur den Hauch eines Belegs für ihre Behauptungen beizubringen, erscheint ihre aggressive Rhetorik, mit der sie von »epidemisch auftretender Gewalt«, von einer »Epidemie der Vergewaltigungen an Universitäten« und von »der nächsten Horde ungestraft davongekommener Vergewaltiger« spricht, als ein Einschüchterungs- und Überrumpelungsversuch, der den Leser davon abhalten soll, solche kritischen Einwände überhaupt erst zu erheben. Was Solnit uns in ihrem Aufsatz anbietet – um nicht zu sagen: zumutet – ist daher nicht Empirie, sondern Topik: die Anwendung von Allgemeinplätzen zur Darstellung besonderer Umstände. Sowohl zur häuslichen Gewalt als auch zum Thema des »Campus Rape« werden die Verhältnisse nicht so beschrieben, wie sie sich empirisch belegen lassen, sondern so, wie die feministische Perspektive sie zu sehen verlangt. Wie kann man solche Sätze schreiben, ohne die tatsächlichen Verhältnisse häuslicher Gewalt, bei der Frauen nahezu hälftig Täterinnen sind, oder auf dem Campus, auf dem regelmäßig Grundrechte von Beschuldigten außer Kraft gesetzt werden, zu berücksichtigen? Die Frage ist falsch gestellt: man kann solche Sätze nur dann schreiben, wenn man die tatsächlichen Verhältnisse außer Betracht lässt. Wenn aber diese Topik nicht durch empirische Belege getragen wird, wodurch wird sie dann plausibel? Die Antwort lautet: die feministische Topik, als ein System von misandrischen Allgemeinplätzen, steht in Bezug zum Begriff des »Patriarchats«, bei dem es sich um das allgemeinste System der feministischen Topik handelt, von dem sich alle anderen herleiten lassen.
Der Mythos vom Patriarchat
Das »Patriarchat« ist in einem strikten Sinne ein Mythos. Das heißt: nicht in jenem Sinne, dass es sich um einen empirisch völlig unbrauchbaren Begriff handelte, denn bei einem soziologischen Klassiker wie Max Weber wird der Begriff einer »patriarchalen Herrschaft« in einem historisch präzisen, aber in seiner empirischen Reichweite auch eng umgrenzten Sinne im Rahmen seiner Typologie der Herrschaftsformen entwickelt. Sondern ein Mythos in dem Sinne, dass es sich dabei angeblich um eine fundamentale Struktur menschlicher Gesellschaften als Ganzer handele, mit der auch ein historischer Längsschnitt durch die Geschichte der Menschheit von der Jungsteinzeit bis ins Atomzeitalter gelegt werden könnte – auf diese Weise erfüllt der Begriff die ätiologische Begründungsfunktion des Mythos. Und schließlich in dem Sinne, dass die Rede vom »Patriarchat« auch die Beglaubigungsfunktion des Mythos erfüllt: der Begriff repräsentiert ein als selbstverständlich geltendes, nicht weiter zu hinterfragendes Wissen, das als Voraussetzung alles weiteren konkreten Urteilens dient: »It is known, Khaleesi!«. In eben diesem Sinne einer argumentfreien, axiomatischen Begründung und Beglaubigung wird der Begriff auch von Rebecca Solnit verwendet – in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift. Solnits Thesen werden in ihrer ganzen haarsträubenden Einseitigkeit und Verallgemeinerungstendenz nur darum »wahr«, weil sie diese Beglaubigungsfunktion des Patriarchatsbegriffs in Anspruch nehmen, indem sie den Begriff als Deutungsrahmen aufrufen. Der mythische Patriarchatsbegriff deckt die Begründungslücken zu, die von der Autorin in Bezug auf die Gewaltfrage aufgerissen wurden.
Es ist nun aber nicht so, dass die von Solnit inkriminierten Zustände völlig aus der Luft gegriffen wären. Man könnte aus den realen Ereignissen, die die #metoo-Kampagne angestoßen haben, durchaus eine präzise Diagnose herausdestillieren: nämlich beispielsweise, dass die Kontrolle über Reden und Schweigen in der Film- und Medienbranche, also jenem Segment der Gesellschaft, in dem autorisiert und stellvertretend Sinngebungen und Symbole für die ganze Gesellschaft produziert werden, besonders stark ist, weil unsere Gesellschaft ihr diese Kontrolle zu einem guten Stück freiwillig anvertraut hat. Gerade bei Harvey Weinstein wurde darauf hingewiesen, dass er sich lange Zeit unwidersprochen als »Feminist« bezeichnen konnte. Anstatt einfach ein weiteres Beispiel unspezifischer »männlicher Macht« zu sein, ließe es sich vielmehr als ein Beispiel für unsere kollektive Bereitschaft betrachten, uns selbst zu betrügen und den Schöpfern unserer kollektiven Träume und Weltdeutungen die Macht zu übertragen, mit den von ihr geschaffenen Illusionen eben diesen freiwilligen Selbstbetrug zu unterstützen. Die Macht dieser Branche, und in dieser Branche, beruht insofern zu einem guten Teil gerade darauf, dass wir durch ihre Produkte, zumindest ein Stück weit, betrogen werden wollen. Sie gehörte bislang nicht zu jenen Segmenten der Gesellschaft, die – wie beispielsweise das Militär oder die chemische, die Atom-, die Waffen- oder auch die Tabakindustrie – seit Jahrzehnten unter einem Dauerverdacht illegitimer Machtausübung stehen. Eine solche Argumentation wirft aber für die feministischen Lobbies keine geeigneten Gewinne ab. Sie ist nicht geeignet, die Mär vom emotional verkrüppelten männlichen Patriarchen als dem Hauptproblem unserer Gesellschaft zu unterstützen. Daher dominiert in der Öffentlichkeit anstelle einer präzisierenden, das Objektiv der Kritik schärfer stellenden Kritik eine verallgemeinernde und verunschärfende Deutung.
Wir sind noch nicht ganz am Ende der Argumentation angelangt – einen Punkt müssen wir noch ergänzen: in einem weiteren Abschnitt sucht die Autorin – an die Denkfigur vom emotional verkrüppelten Mann anschließend – die systematische Ursache für die von ihr behaupteten Tatsachen in einem »Verkümmern der Empathiefähigkeit« (S. 67 ff.):
»Unsere Menschlichkeit ist aus Geschichten oder – im Fall der Abwesenheit von Worten und Narrativen – aus Phantasien gemacht, in denen es darum geht, dass ich mir das, was ich nicht direkt fühle, weil es nicht mir, sondern dir passiert ist, trotzdem vorstellen kann, und dass es mich etwas angeht. Auf diese Weise stehen wir miteinander in Verbindung. Solche Geschichten können brutal stummgestellt werden, die Stimmen, aus denen vielleicht Empathie erwächst, können zum Schweigen gebracht, diskreditiert, unaussprechlich und unhörbar gemacht werden.«
S. 67
In dieser allgemeinen Form kann man Solnits Darstellung nur unterschreiben. Wir haben aber bereits gesehen, wie geradlinig die Autorin solche allgemeinen Formen auf einseitige Perspektiven herunterbricht. Und damit kommen wir zur letzten wichtigen Pointe dieser Kritik ihres Artikels: Rebecca Solnit entgeht völlig, wie sehr sich die Kernthesen ihres Textes auf sie selbst anwenden lassen. Sie schreibt einen Artikel über das Schweigen – und beschweigt alle Fakten, die ihr Modell vom patriarchalen Mann und alleinigen Gewalttäter in Frage stellen könnten. Sie beklagt das Verkümmern der Empathie – und zeichnet ein gänzlich empathiefreies Zerrbild vom gewalttätigen, emotionslosen männlichen Zombie als Standardmodell des Mannes. Faszinierend, aber auch bedrückend ist die feministische Fähigkeit, einerseits durchaus scharfsinnige Einsichten in gesellschaftliche Machtverhältnisse zu erlangen, die im Prinzip auf beide Geschlechter anwendbar wären, es dann aber in radikaler Einseitigkeit fertigzubringen, diese Einsichten ausschließlich auf Frauen zu beziehen und Männer daraus auszuschließen. Das Ausblenden von Gewalt gegen Männer durch Frauen, die mindestens im Rahmen der häuslichen Gewalt ebenfalls als »epidemisch« bezeichnet werden könnte, führt zu einer systematischen Verzerrung der Gesamtperspektive.
Mit dieser vom Begriff des »Patriarchats« gesteuerten Selektivität des empirischen und analytischen Blicks hinterlassen auch Fachartikel in wissenschaftlichen Zeitschriften wie der von Rebecca Solnit in den »Blättern« den Eindruck einer atemberaubenden, fundamentalen, bis auf die Knochen gehenden Unaufrichtigkeit und Unverantwortlichkeit der feministischen Ideologie. Und diese Unaufrichtigkeit ist ebenfalls ein integraler Bestandteil der »Kultur, in der wir existieren«. Wohlgemerkt: dieser Artikel erscheint in einem Monatsmagazin, das den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erhebt – in dem freilich dennoch regelmäßig Artikel erscheinen, die ohne jede Fußnote oder Literaturangabe auskommen. Solnits Artikel ist einer davon. Nicht jedem dieser Artikel schadet das. Solnits Artikel ist einer von denen, denen das schadet. Aber in diesem Fall muss man wohl obendrein ein Versagen des Peer Reviews unterstellen. Bei derart starken Behauptungen, wie sie dem Publikum von der Autorin aufgetischt werden, hätte der Artikel in dieser Form, mit diesem Mangel an Belegen, niemals gedruckt werden dürfen.
Aber welchen Sinn kann man in einer solchen Verhaltensweise finden, die man kaum anders als gewohnheitsmäßige Unredlichkeit nennen kann? Eine naheliegende Antwort – die von den Gemeinten zweifellos als »Sexismus« der übelsten Sorte denunziert werden wird – lautet: Feministinnen sind offensichtlich Frauen, die mittels taktischer Kommunikation Männer dazu bewegen wollen, ihnen zu verschaffen, was sie fordern. Es sind Frauen, die die klassische Strategie der bürgerlichen Frau auf das Niveau der ganzen Gesellschaft gehebelt haben: eine jederzeit abrufbare Ressource an schlechtem Gewissen zu generieren, die Männer dazu bewegen soll und tatsächlich bewegt, über jedes, aber auch jedes Stöckchen zu springen, das ihnen hingehalten wird. Konstatierend, dass Solnits Artikel in der Januarausgabe 2018 der »Blätter für deutsche und internationale Politik« erschienenen ist, drängt sich der Eindruck auf: der Text möchte sich für den Titel des wüstesten Stücks feministischer Propaganda des Jahres 2018 qualifizieren, noch ehe das Jahr 2018 überhaupt begonnen hat.
Und dennoch hat mir Rebecca Solnit mit diesem Aufsatz in einer anderen Hinsicht ein Weihnachtsgeschenk gemacht: sie hat mir ein kristallklares Beispiel dafür geschenkt, für welche intellektuellen Verwüstungen der feministische Begriff des Patriarchats auch tief im 21. Jahrhundert immer noch herhalten muss. Genauer gesagt: der feministische Mythos vom Patriarchat in einem strikten Sinne. Denn dieser Mythos vom Patriarchat ist diejenige Denkfigur des Feminismus, aus der sich in der Art einer »generativen Struktur« praktisch alle Ambivalenzen, Verkürzungen und grundsätzlichen Denkfehler feministischer Theorie und Weltanschauung herleiten lassen, die heute zu einer flächendeckenden intellektuellen Landplage geworden sind. Er ist diejenige begriffliche Klammer, die den Feminismus seit der Zweiten Frauenbewegung zu einer eigenständigen historischen, ideologischen und politischen Gestalt macht.
Literatur:
- Hamel, John; Nicholls, Tonia L. (Hrsg.)(2013), Familiäre Gewalt im Fokus. Fakten – Behandlungsmodelle – Prävention. Frankfurt a. M.: Ikaru
- Johnson, KC; Taylor jr., Stuart (2017), The Campus Rape Frenzy. The Attack on Due Process at America’s Universities. New York: Encounter
- Meier-Seethaler, Carola (2011), Ursprünge und Befreiungen. Eine dissidente Kulturtheorie. Stuttgart: opus magnum
- Sanyal, Mithu (2016), Vergewaltigung. Aspekte eines Verbrechens. Hamburg: Edition Nautilus
- Solnit, Rebecca (2018), Die Geschichte des Schweigens oder: Wie das Patriarchat uns mundtot macht. In: Blätter für deutsche und internationale Politik 1/2018, S. 61-70
- Taylor, Stuart; Johnson, KC (2008), Until Proven Innocent. Political Correctness and the Shameful Injustices of the Duke Lacrosse Rape Case. New York: Thomas Dunne Books
Keine Agitpropkultur heute, dafür ein bißchen feierlicher:

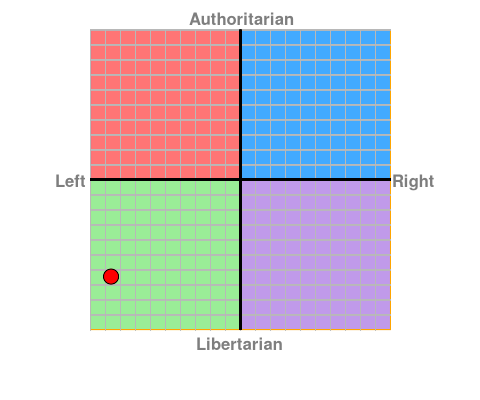
Schreibe einen Kommentar