Ein Rezensionsessay zu »Female Choice« von Meike Stoverock nebst kritischen Anmerkungen zur Evolutionspsychologie
Der folgende Artikel ist die überarbeitete und ergänzte Version einer Buchrezension, die im März 2021 als Gastartikel auf dem Blog Alles Evolution erschienen ist. Der dortige Artikel war als erster von zwei Teilen geplant. Für den zweiten Teil habe ich aufgrund der sich damals dramatisch weiter entfaltenden Zeitumstände (aka »Corona«) keine Zeit mehr gefunden, wozu aber auch der Umstand Vorschub leistete, dass mein Hauptinteresse Stoverocks anthropologischer These galt und nicht ihrer Gegenwartsdiagnose.
Inzwischen habe ich mich im Rahmen meines Buchprojekts systematisch mit anthropologischen Modellen der Hominisierung auseinandergesetzt. Aus dieser Auseinandersetzung beziehe ich nicht nur weitere Argumente zur Vertiefung meiner gegen Stoverocks These vorgebrachten Einwände (die neuen Argumente befinden sich hauptsächlich im Abschnitt 5 des Textes), sondern auch Argumente für eine grundsätzliche Kritik an einem engen Verständnis von Evolutionspsychologie, das die spezifischen Merkmale der menschlichen Kultur aus sexuellen Strategien und sexueller Selektion ableiten möchte.
Daher habe ich meine Kritik an Stoverocks Buch um eine Kritik an evolutionspsychologischen Kurzschlüssen in Bezug auf die menschliche Kultur erweitert. Ich stelle die Rolle kultureller Prozesse für die biologische Evolution des Menschen heraus, mit der sich der Vorgang der Hominisierung, also der evolutionären Menschwerdung, besser erklären lässt als mit dem biologischen Reduktionismus eines reinen Sexuelle-Strategien-Modells. Der Titel dieses Blogposts, »Verpatzte Anthropologie«, bezieht sich daher nicht nur auf den Ansatz von Meike Stoverock, sondern auch auf ein solches zu eng gefasstes Verständnis von Evolutionspsychologie.
Den grundsätzlichen Argumentationsbogen von Meike Stoverocks Buch kann man folgendermaßen zusammenfassen:
Erstens insistiert Meike Stoverock darauf, dass die Geschlechtlichkeit des Homo sapiens ein primär biologisch bestimmtes Phänomen ist, das auf dem Prinzip der zweigeschlechtlichen Fortpflanzung beruht, während es sich bei allem, was auf den ersten Blick wie »Genderfluidität« aussieht, um eine Normalverteilung auf der Skala des (ebenfalls biologischen, aber sich psychologisch manifestierenden) hormonellen Geschlechts handelt. Damit weist sie einen »Geschlechterkonstruktivismus« konsequent zurück.
Zweitens postuliert sie, dass die sexuelle Evolution – das heißt: sowohl die Evolution des Paarungsverhaltens als auch die Evolution aufgrund des Paarungsverhaltens aller sich sexuell fortpflanzenden Spezies – praktisch durchgängig auf dem Prinzip der »Female Choice« beruht, dass es also jeweils die Weibchen einer Art sind, welche sich die Männchen ihrer Art aussuchen, weshalb diese Männchen durch Imponierverhalten die Weibchen umwerben.
Drittens überträgt sie dieses Prinzip auf den Homo sapiens, von dem sie behauptet, dass es auch bei dieser Spezies der Normalfall sei, dass eine Mehrzahl von Männern keine Chance auf Fortpflanzung habe, weil die Frauen nur einen kleinen Anteil der Männer (in der Größenordnung von 30 Prozent) als Partner in Betracht ziehen. Diese Konstellation und die 30:70-Relation hält sie mehr oder weniger für den Naturzustand der menschlichen Art.
Viertens leitet sie aus diesem postulierten Naturzustand faktisch ein »Naturrecht« der Frau ab, und die weitere Argumentation folgt dem roten Faden eines Verlusts und einer Wiedergewinnung dieses Naturrechts. Die Geschichte seines Verlusts und seiner Wiedergewinnung ist dementsprechend zugleich die Geschichte des Anfangs und des Endes einer »männlichen Zivilisation«, die mit der Erfindung von Ackerbau und Sesshaftigkeit ihren Anfang nimmt und in der »feministischen« modernen Gesellschaft wiederum an ihr Ende kommt.
Schließlich fünftens: In der modernen Gesellschaft restaurieren Frauen gleichsam ihr Naturrecht, sich ihre Männer hoch selektiv auszuwählen, und die Gesellschaft soll dementsprechend Vorkehrungen ersinnen, um die von den Frauen als untauglich abgefertigte Mehrheit der Männer so zu kompensieren, dass diese nicht ihrer aus sexueller Frustration gespeisten Gewaltneigung erliegen. Gehen wir die Argumentationsschritte im Einzelnen durch.
1. Der Geschlechterdualismus
Kapitel 1, »Das Duale System«, fasst die Funktion der Zweigeschlechtlichkeit für die Evolution höherer Lebewesen zusammen:
»Alles sexuell entstandene Leben auf unserem Planeten basiert daher auf der Dualität der Geschlechter, auf zwei Gegenstücken, die wie Schlüssel und Schloss ineinanderpassen.«
S. 36
Da These von der »Female Choice« den Kontext einer Theorie der sexuellen Evolution voraussetzt, würde es ihr Argument zerstören, sich auf diesen grundlegenden Sachverhalt nicht einzulassen. Ebenso akzeptiert sie die Funktion von Hormonen für die Ausprägung menschlicher Geschlechtlichkeit, beginnend mit der Bedeutung des vorgeburtlichen Testosteronspiegels, aber auch für die Ausprägung von Stimmungen bis hin zum Prämenstruellen Syndrom:
»In der menschlichen Geschlechterdebatte werden Hormone meist nur zu einem Zweck erwähnt: um das jeweils andere Geschlecht herabzusetzen. Männer werden als triebgesteuerte Höhlenmenschen dargestellt, Frauen als nah an der Unzurechnungsfähigkeit rangierende Irre. Am Ende streiten dann alle ab, dass Hormone überhaupt mehr bewirken als vernachlässigbare Kleinigkeiten, weil niemand beleidigt werden will … . Dabei beeinflussen Hormone unser Wohlbefinden, unsere Bedürfnisse, unsere Partnerwahl, unsere Stimmungen und unser Verhalten sehr stark. So sorgen dafür, dass wir kuscheln, weglaufen, zuschlagen, Sex haben oder kleinen Babys in die Wangen kneifen wollen. Sie machen uns aggressiv, kooperationsbereit, widerborstig oder ängstlich. Sie entscheiden mit über unseren beruflichen Erfolg, unser Aussehen und darüber, wen wir attraktiv finden.«
S. 37 f.
Die Konzentrationen von Testosteron, Östrogen und Progesteron im menschlichen Körper sind die drei hormonellen Faktoren, die bei Männern und Frauen ungleich verteilt sind und in ihren jeweils konkreten Relationen das »hormonelle Geschlecht« jedes Individuums ausprägen, einschließlich der biologischen Abweichungen wie im Fall des weiblichen Adrenogenitalen Syndroms und der männlichen Androgenresistenz.
Aus diesem Grund kann Stoverock auch mit der Differenzierung von »sex« und »gender«, zwischen biologischem und sozialen Geschlecht, nicht viel anfangen, weil darin die bloße Anatomie einer Blank-Slate-Psychologie gegenübergestellt wird:
»Es ist schwer, die Trennung von ›biologischem‹ und ›sozialem‹ Geschlecht, ›sex‹ und ›gender‹ aufrechtzuerhalten, letztlich gibt es nur Geschlecht. Eine Einheit aus Chromosomen, Hormonen und sozialem Einfluss macht uns zu den geschlechtlichen Wesen, die wir sind.«
S. 49
Tatsächlich bietet das Funktionssystem des hormonellen Geschlechts einen entscheidenden Ansatzpunkt zur Kritik der Art von kulturalistischen Gendertheorien, wie sie von Judith Butler eingeführt worden sind. Da das hormonelle Geschlecht eine Variationsbreite aufweist, durch die es mit dem anatomischen Geschlecht nicht immer kongruent ist, kann es den empirischen Befund einer »Genderfluidität« erklären, die die Gendertheorien allein aus kulturellen Rollen herleiten wollen. Man kann daher dem Genderfeminismus zugestehen, von einer zutreffenden Beobachtung auszugehen, muss aber ebenso klar sein wissenschaftliches Versagen beim Versuch, sie zu erklären, konstatieren. »Judith Butler und die Folgen« sind jedoch nicht Gegenstand dieses Blogpost.
Stoverocks Anerkennung der biologischen Grundlagen menschlicher Sexualität führt die Autorin dann auch zu der klarsten Stellungnahme zum Fall David Reimer, den ich bei einer sich als Feministin verstehenden Frau gefunden habe. Anders als Alice Schwarzer, die den Wandel in der Bewertung John Moneys einfach ignoriert hat, und anders als Judith Butler, die zwar die Tragik des Falles konzediert, aber so tut, als sei David Reimers Geschlecht nicht von Anfang an klar bestimmt gewesen, kritisiert Stoverock ausdrücklich auch die Frauenbewegung:
»Seine Weigerung, das Scheitern des Experiments öffentlich zuzugeben, führte dazu, dass nach David noch unzählige weitere Kinder, intersexuelle wie auch andere Opfer ärztlicher Kunstfehler, die operative Geschlechtsneuzuweisung und die quälenden Sitzungen mit Money durchlaufen mussten. (…) In Teilen der Frauenbewegung hält sich Moneys Konzept des neutralen Kindes, dem die Gesellschaft eine Geschlechtsidentität aufdrückt, aber bis heute. Dabei gesteht die queerfeministische Bewegung paradoxerweise den geschlechtlichen Minderheiten – und dies völlig zurecht – einen angeborenen Faktor zu. Bei heterosexuellen Männern und Frauen dagegen, die nicht diskriminiert werden und die normierende Mehrheit darstellen, werden angeborene Muster bestritten.«
S. 47 ff.
Bei einem so klaren Bekenntnis, zu dem sie teils darum motiviert ist, weil »mich als Biologin diese Missachtung meiner Zunft kränkt« (S. 21), teils, um das Thema nicht »den Biologisten« (S. 22) zu überlassen, dürfen wir gespannt sein, wie sie ihre weitere Argumentation bei aufrechterhaltenem Anspruch, als Feministin zu gelten, entwickelt.
2. Sexuelle Evolution
Das zweite Hauptstück in Stoverocks Argumentationsgang ist ein Resümee der Theorie der sexuellen Evolution. Die Evolution der Zweigeschlechtlichkeit führt eine konstitutive Asymmetrie zwischen den beiden Geschlechtern ein, die auf unterschiedlich hohen Kosten für den jeweiligen Anteil an der Reproduktion beruht, die sich mit dem Satz: »Sperma ist billig, Eier sind teuer« zusammenfassen lassen. Ein Weibchen kann im Verlauf seines Lebens nur eine begrenzte Anzahl von Eiern hervorbringen, während Spermien nahezu unerschöpflich produziert werden. Weibchen zahlen folglich einen höheren Preis für reproduktive Fehlschläge und sind darum wählerisch:
»Wegen der unterschiedlichen Fortpflanzungskosten haben beide Geschlechter vollkommen unterschiedliche Reproduktionsstrategien entwickelt. (…) Vereinfacht gesagt, muss das Männchen möglichst viele Weibchen rumkriegen, das Weibchen dagegen möglichst viele Verehrer abwehren, er ist wahllos, sie wählerisch. Dieses ›Sexueller Konflikt‹ genannte Phänomen hat im Laufe der Evolution bei den Geschlechtern eine völlig gegenläufige Sexualität hervorgebracht. (…) Sex ist für Männchen eine begrenzte Ressource, die die Weibchen kontrollieren. Dass Männchen oft und hartnäckig versuchen, sexuelle Kontakte zu Weibchen herzustellen, und Weibchen diese Versuche fast immer ablehnen, ist kein Fehler des Systems – es ist das System.«
S. 83 f.
Stoverock zählt eine Vielzahl von Beispielen aus dem Tierreich auf, um das Prinzip der Female Choice zu illustrieren: Blaukiemenbarsche, Frösche, Vögel, Insekten, Löwen, Paviane, Mäuse, Seeelefanten. Dabei geht sie in einem eigenen Kapitel, »Gewalt ist eine Lösung«, auch auf die Rolle männlicher Aggressivität ein, die teils im Kampf gegen konkurrierende Männchen , teils in Form einer Vergewaltigung der Weibchen zum Ausdruck kommt. Und sie beschreibt die Kehrseite dieser Aggressionen: ihre Ablenkung auf Ersatzobjekte im Falle der sexuellen Frustration:
»Rangniedere Männchen, die keine Partnerin für sich gewinnen können, reagieren ihren aufgestauten Trieb an Jungtieren, toten Artgenossen, Gegenständen oder sogar anderen Tierarten ab, Von Seeottern vor Kalifornien wird berichtet, dass sie junge Seehunde angreifen, töten und sich über Tage hinweg wiederholt an deren Kadavern vergehen. Tümmler vergreifen sich an Abflussrohren, Robben an Königspinguinen, Schimpansen an Fröschen, Makaken an Sikaihirschen. (…) Sex mit toten Artgenossen wird regelmäßig von Enten, Pinguinen, Schwalben, verschiedenen Reptilien und Meeressäugern berichtet.«
S. 98
Die entscheidende Frage ist nun, wie Stoverock dieses Prinzip auf die Spezies Homo Sapiens zu übertragen versucht.
3. Übertragung auf Homo Sapiens
Den grundlegenden Sachverhalt der größeren Abhängigkeit menschlicher Kleinkinder von elterlicher Betreuung aufgrund ihrer im Vergleich zu anderen Spezies ontogenetisch frühen, »unfertigen« Geburt gibt sie korrekt wieder:
»Je weiter sich die frühen Hominiden aufrichteten, desto mehr wurden nämlich die Beckenschaufeln nach unten hin zusammengedrückt. Während aber der Geburtskanal immer enger wurde, wurden die Köpfe der Babys durch die steigende Intelligenz immer größer. Die einzige Lösung bestand darin, den Nachwuchs unfertig auszuliefern. (…) Das Menschenkind passte damit zwar wieder durch den Geburtskanal, war aber bei der Geburt unfähig zu Kommunikation und Fortbewegung. Ein echter Nichtskönner, eine Art Schreiraupe, deren Versorgung die Frau rund um die Uhr beanspruchte. Das wiederum bewirkte, dass die Mutter beinahe genauso hilfebedürftig wurde wie das Baby. Sie brauchte eine Gruppe mit engen sozialen Bindungen, die sie unterstützen konnte.«
S. 114
Von diesem Moment an fällt jedoch mehr und mehr auf, dass ihr Bild des Menschen – und des Mannes – auf einer simplen Fortschreibung der bis dahin aufgeführten biologischen Sachverhalte in den Bereich der menschlichen Kultur beruht. Die Frage danach, was das ihn vom Tier unterscheidende Spezifische des Menschen darstellt, warum Menschen Mondraketen, Nuklearwaffen und Quantencomputer bauen, Menschenaffen dagegen nicht, stellt sich ihr nicht, und sie erweckt nicht den Eindruck, als würde sie den Sinn der Frage überhaupt verstehen.
Obwohl sie, wie oben angedeutet, den polemischen Gebrauch der »Hormon«-Vokabel kritisiert, verwendet sie selbst nichtsdestotrotz ein simples Triebstaumodell und stellt den Mann als ein testosterongetriebenes Triebmonster dar, das seine innere Natur nur dann zu zähmen vermag, wenn es von einer Frau als Sexualpartner erwählt wurde und andernfalls eine Gefahr für seine soziale Umwelt darstellt:
»Wir haben gesehen, dass Gewaltbereitschaft integraler Bestandteil der männlichen Reproduktionsstrategie ist. Sie verbessert die Chancen der Männchen, sich beim Konkurrenzkampf oder beim mate guarding gegen Rivalen zu behaupten. Es ist also kein Zufall, dass Testosteron die Aggressivität erhöht, sondern Ergebnis einer evolutionären Anpassung. (…) Männer, die keinen oder nicht genug Zugang zu Sex haben, reagieren mit Aggression, darin unterscheiden sich Menschen nicht von Tieren. (…) Männer mit geringem Status haben tendenziell eher weniger Zugang zu Sex und reagieren öfter mit Gewalt. Diese mag sich als nicht-reproduktive Frustrationsgewalt gegen andere Männer, Kinder, Alte, Fremde richten – eine direkte Folge des Sexualtriebes ist sie dennoch.«
S. 111 f.
Gleichzeitig bestehen ihrer Ansicht nach die für die Männchen ungünstigen Paarungsrelationen von bis zu 80:20 auch beim altsteinzeitlichen Menschen. Der Umschlag in das, was sie als »männliche Zivilisation« bezeichnet, erfolgt dann in der Jungsteinzeit mit dem Aufkommen des Ackerbaus und der Sesshaftigkeit – sie ist der Ansicht, dass sich das Problem der sexuellen Selektion durch die Frauen hier noch einmal dramatisch verschärft:
»Die Neolithische Revolution ist wie Evolution auf Speed. Vor allem die Männer müssen einen rasanten Lernprozess durchmachen, weil nun statt Jagdgeschick ganz andere Fertigkeiten gefragt sind, um eine Partnerin zu finden. Nur die intelligentesten und geschicktesten Männer kommen mit den Anforderungen der sich im Höllentempo verändernden Welt zurecht und können sich fortpflanzen. Das hat zur Folge, dass die Female Choice den Mann jetzt mit ganzer Härte trifft. (…) Denn das [natürliche 80:20-Verhältnis] verschiebt sich nach der Entstehung der Landwirtschaft bis auf ein erbarmungsloses 95:5. Die Frauen wählen am Übergang zur Sesshaftigkeit nur noch eine verschwindend geringe Zahl der Männer als Partner aus. (…) Die Sesshaftwerdung bewirkt ein unbarmherziges Aussieben, das sicherstellt, dass nur die ideenreichsten und kreativsten Männer die neue Welt aufbauen, eine Art neolithische Supermänner. Die Fortpflanzungssituation ist für Männer eine Katastrophe. Der ohnehin hohe sexuelle Selektionsdruck steigert sich durch den genetischen Flaschenhals bis ins Unermessliche. Dies wiederum führt dazu, dass die Konkurrenz unter den Männern sich in einem Maße verschärft, das vermutlich kaum noch ein gemeinschaftliches Zusammenleben erlaubt. Denn die unbefrauten Männer reagieren auf die gleiche Weise wie die Männchen fast aller anderen sich sexuell fortpflanzenden Arten: aggressiv. Und diese Aggression stellt die Menschen vor ihre größte bisherige Herausforderung, denn sie gefährdet das sesshafte Leben in wachsenden Siedlungen, noch bevor es recht begonnen hat.«
S. 136 f.
Als Reaktion auf diese Verhältnisse – und das ist jetzt Stoverocks zentrale These – setzen sich die Männer über die bisherige »natürliche Ordnung« der sexuellen Verhältnisse hinweg und erfinden Heiratsregeln, bei denen jeder Mann eine Frau abkriegt. Daraus entsteht nun »Zivilisation« als eine Sozialordnung, die »nach männlichen Bedürfnissen« eingerichtet wurde, nämlich nach den männlichen sexuellen Bedürfnissen. Somit ist »Zivilisation« gleichbedeutend mit der Unterdrückung der Frau, gleichbedeutend mit »Patriarchat« und gleichbedeutend mit einer reduzierten, partikularen Vernunft, in der die Bedürfnisse der Frauen (und anderer Herrschaftsunterworfener) ausgeschlossen bleiben, und schließlich bis zur Tautologie gleichbedeutend mit männlicher Zivilisation.
Dementsprechend kann sie dann fordern, dass die Entfremdungen dieser »männlichen Zivilisation« durch eine Rückkehr zum Naturzustand der »Female Choice« wieder aufgehoben werden sollen. Bevor wir jedoch auf ihre politische Gegenwartsdiagnose eingehen können, müssen wir uns zunächst mit ihrem Bild der Ur- und Frühgeschichte näher befassen, denn dieses ist in so vielen Hinsichten schief und falsch, dass ihr anthropologisches Argument dadurch vollständig entwertet wird. Dieses kritische Unterfangen wird freilich dadurch erschwert, dass Stoverock ihrem Publikum einen Anmerkungsapparat verweigert, sodass man den Bezug ihrer Aussagen zu den Titeln des Literaturverzeichnisses umständlich erschließen oder erraten muss. Beginnen wir mit ihrer These einer ungünstigen 70:30-Paarungsrelation beim altsteinzeitlichen Homo sapiens:
»Eine grobe Faustregel besagt, dass 80% der geschlechtsreifen Weibchen nur 20 % der Männchen ranlassen – dass also 80% der Männchen für Sex mit ihnen nicht in Frage kommen. Die müssen sich um die verbleibenden 20% der Weibchen prügeln. (…) Genetische Untersuchungen lassen darauf schließen, dass es bei unseren menschlichen Ahnen nicht anders war. Die heutige Weltbevölkerung hat ungefähr doppelt so viele weibliche wie männliche Vorfahren, in präkulturellen Zeiten haben sich also ungefähr 70% der Frauen mit 35% der Männer gepaart. Die restlichen 65% der Männer mussten um die restlichen 30% Frauen buhlen. Das Verhältnis von 2:1 zugunsten der Frauen verschärfte sich nach der Erfindung der Landwirtschaft sogar noch auf unglaubliche 17:1.«
S. 90
Hier ist als erstes festzuhalten, dass die genannte 80:20-Relation sich nicht auf menschliche Populationen bezieht, denn sie illustriert diese Relation am Beispiel der Seeelefanten und kommt erst dann auf den Menschen zu sprechen. Sehr viel schwerer wiegt jedoch, dass ihre Literaturverweise äußerst spärlich und hoch selektiv sind. Tatsächlich ignoriert sie schlicht einschlägige Literatur zur Entwicklung des spezifisch menschlichen Paarungsverhaltens – »Female Choice« gilt anscheinend auch für die Literaturrezeption der Autorin.
Ohne allzu große Mühe lassen sich anthropologische Fachartikel finden, die ihrer Behauptung klar widersprechen: Lippold et al. (2014) finden archäogenetische Indizien für einen generellen Frauenüberschuss in paläolithischen Gemeinschaften oberhalb einer Relation von 3:2. Sikora et al. (2017) finden archäogenetische Indizien für inzestvermeidende exogame Heiratsregeln bei paläolithischen Jägern und Sammlern um 30.000 v.u.Z., d. h. Indizien für eine kulturell regulierte Partnerwahl. Nakahashi und Horiuchi (2011) gehen bei Homo sapiens generell von stabilen Paarbeziehungen mit geringer weiblicher Promiskuität und geringer männlicher intrasexueller Konkurrenz aus.
Stoverock stützt sich dagegen hauptsächlich auf Mansperger (1990), der für Homo sapiens wie auch Nakahashi/Horiuchi (2011) von »multimale, multifemale«-Gemeinschaften ausgeht, ansonsten aber bereits alle Thesen Stoverocks formuliert hat: kurze Partnerschaftsperioden (Mansperger: »a few months or less«, Stoverock: ca. 4 Jahre), »selective promiscuity« (für die Stoverock den Modus der Female Choice postuliert) sowie eine spätere Unterdrückung dieses Partnerschaftssystems: »suppressed and modified by culture.« Manspergers Argument für die menschliche Promiskuität ist ein Sparsamkeitsargument und besteht darin, dass es in Bezug auf die Promiskuität unter (manchen!) Menschenaffen keine Zusatzhypothesen zur Erklärung eines abweichenden Spezifikums bei Homo sapiens benötigt.
Dieses Argument impliziert freilich, dass die Charakteristika von Homo sapiens als einem Kulturwesen, also seine spezifische Differenz zu den Menschenaffen, keine besondere Rolle spielen. Es erklärt die Organisation der menschlichen Sexualität zu einer bruchlosen Fortsetzung der Naturgeschichte. Genau das ist Stoverocks Anliegen, für das sie alle konkurrierenden kulturanthropologischen Denkansätze sowie ihr widersprechende archäogenetische Befunde ausblendet.
Für das Zustandekommen des neolithischen 17:1-Spitzenwerts diskutiert die Autorin keine Alternativhypothese. Nach Feldmann, Aw und Zeng (2018) kann der extreme Flaschenhals durch die Konkurrenz patrilinearer Gruppen erklärt werden: patrilineare Deszendenz sorgt für eine starke Homogenisierung des Y-Chromosomen-Pools, und kriegerische Konkurrenz kann dann bewirken, dass solche homogene Gruppen als Ganze oder in ihrem männlichen Anteil ausgelöscht werden. Vereinfacht gesagt: der Flaschenhals kann anstatt durch ein Female-Choice-Modell auch durch »Tötet die Männer, nehmt euch die Frauen«-Szenarien zwischen patrilinearen Abstammungsgruppen erklärt werden. Solche Szenarien sind auch schon in der feministischen Literatur protokolliert worden, zum Beispiel bei der Historikerin Gerda Lerner:
»There is overwhelming historical evidence for the preponderance of the practice of killing or mutilating male prisoners and for the large-scale enslavement of female prisoners.«
Lerner 1986, S. 81
Lerner bezieht sich dabei auf mesopotamische Quellen des dritten vorchristlichen Jahrtausends wie die Geierstele, was aber nicht dagegen spricht, dass solche Praktiken schon früher ausgeübt wurden.
4. Statistische Hütchenspiele
Kommen wir nun zu den von Stoverock präsentierten Zahlen. Die Autorin möchte mit einer Statistik aus den kulturvergleichenden Arbeiten von George P. Murdock nachweisen, das Polygynie die dominante Paarbeziehungsform in primitiven menschlichen Gesellschaften darstellt:
»Der evolutionäre Druck hat auch bei den Menschen vor allem polygyn-monoandrische Systeme hervorgebracht. Die Daten zeigen, dass eine überwältigende Mehrheit der Kulturen, nämlich 1041, in vorübergehend oder dauerhaft polygynen Systemen (Harems) leben, gegenüber 186 monogynen und lediglich 4 polyandrischen Kulturen. Diese Verhältnisse spiegeln die Verteilung der Paarungssysteme in der Tierwelt wider. Der evolutionäre Druck hat auch bei den Menschen vor allem polygyn-monoandrische Systeme hervorgebracht.«
S. 115
Schaut man tatsächlich genauer nach, erweist sich die Behauptung als manipulativ: Murdock, den sie im Text als Quelle nennt, ist in ihrem Literaturverzeichnis gar nicht namentlich gelistet. Man muss umständlich erschließen, dass es um das dort gelistete Ethnographic Atlas Codebook, World Cultures, 10(1) geht. Die von Stoverock genannte Summe von 1041 polygynen Systemen ergibt sich, wenn man in Tabelle 9 (»Marital Composition: Monogamy and Polygamy«) die den Codes 2-6 zugeordneten Zahlen summiert. Code 2 mit 453 Fällen ist jedoch als »Independent nuclear, occasional polygyny« ausgewiesen, das heißt, die primäre Bestimmung dieses Typs lautet »Unabhängige Kernfamilie«. Schlägt man diese Kategorie nun den nicht polygynen Systemen zu, weil ihre primäre Bestimmung nicht polygyn ist, dann ergibt sich anstelle eines Verhältnisses von 1 zu 11,5 zugunsten der Polygynie ein Verhältnis 1,1 zu 1 zuungunsten der Polygynie!
Die nackten Zahlen abstrahieren zudem von jeglichem Kontext, selbst von den Aussagen, die man anderen Tabellen desselben Werks entnehmen kann: 788 dieser Kulturen sind sesshaft, 831 betreiben Ackerbau, 739 betreiben Viehhaltung von Schweinen, Schafen, Ziegen oder Rindern, im Unterschied zu 294, die primär vom Sammeln (103), Fischen (116) oder von der Jagd (75) leben. Wie diese ergänzenden Daten in ein Modell passen sollen, das vor-neolithische (Jäger und Sammler) und neolithische Gesellschaften (Ackerbau und Viehzucht) typologisch gegeneinander ausspielt, erklärt uns die Autorin nicht. Ihre Rezeption empirischer kulturanthropologischer Daten ist reinstes Rosinenpicken und entbehrt jeglicher nachvollziehbaren theoretischen Einordnung. Da Stoverock sich als einziges ausführliches ethnographisches Beispiel für die Polygynie auf die südafrikanischen San bezieht, bietet sich ein Zitat zu den benachbarten !Kung an, die derselben Kulturgruppe angehören. Stoverock sagt:
»Denn die Female Choice ist in der Nomadengesellschaft voll intakt. Bei den San werden Partnerschaften zwar von den Müttern junger Frauen arrangiert. Doch eine Frau wird den Partner ihrer Tochter eher nach Kriterien bestimmen, die auch für die selbst relevant sind. Und tatsächlich wählen sie den künftigen Kindeserzeuger vorwiegend nach seinem Jagdgeschick aus, glücklose Jäger bleiben unbegehrte Junggesellen.«
S. 129
Differenzierter ist die Darstellung, die Günter Dux auf Basis der ethnologischen Primärliteratur gibt:
»Die mit Abstand wichtigste soziale Institution, die das Verhalten der Geschlechter bestimmt, ist die Praxis, die Mädchen schon im frühesten Kindesalter, idealiter zwischen zwei und sechs Jahren, in die Ehe zu versprechen. An der Auswahl sind beide Eltern beteiligt, vielleicht mit einem leichten Übergewicht der Entscheidung des Vaters. Die Eltern haben bei der Auswahl des Mannes sicher das Interesse des Kindes im Auge, vor allem das an einer guten Behandlung durch den Mann und an der Versorgung mit Fleisch. Das letztere ist jedoch auch ihr eigenes Interesse. Denn der Mann ist über Jahre zu einer Form des Braut-Dienstes verpflichtet, die darin besteht, auch die Eltern der Frau mit Fleisch zu versorgen. Das Mädchen bleibt nach dem Versprechen zunächst in der Familie der Eltern, wird jedoch früh und noch als Kind dem Bräutigam zugeführt.«
Dux 1994, S. 114
Weder die Frau, noch ausschließlich ihre Mutter, sondern ihre verwandtschaftliche Bezugseinheit trifft letztlich die Entscheidung zur Partnerwahl. Dabei wird auch klar, dass die Versorgungsbefähigung des Mannes nicht einfach ein Fitnessindikator für gute Gene ist, sondern ein wichtiger ökonomischer Faktor in der Subsistenzsicherung der Familie:
»Übereinstimmend ist in den Berichten vermerkt, daß die !Kung verrückt sind nach Fleisch, selbst wenn genug Nahrung im Camp vorhanden ist. Die Aussicht auf Versorgung mit Fleisch ist deshalb noch allemal ein gutes Argument, die widerstrebende Nisa in die Ehe zu reden. Ihr Vater erklärt: ›Also, nimm diesen Mann als deinen Ehemann, diesen starken Mann, der Nahrung bringen wird für dich und für mich zu essen. Ist etwa dein Vater der einzige, der Nahrung finden kann? Ein Ehemann tötet Dinge und gibt sie dir, ein Ehemann ist hinter Dingen her, die er dir gibt; ein Ehemann verschafft Fleisch, das ist Nahrung für dich zu essen.‹«
Dux 1994, S. 116
Das ergibt ein ganz anderes Bild der Polygynie: welcher Mann es sich leisten kann, verwirklicht sie, aber die meisten Männer geben sich mit einer Frau zufrieden (anstatt, wie Stoverock unterstellt, gar keine abzukriegen):
»Polygynie ist die von den Männern begehrte ideale Eheform. Allerdings können sie nur fünf Prozent der Männer verwirklichen. Entscheidend sind die persönlichen Fähigkeiten eines Mannes, vor allem die Fähigkeit, zwei oder gar mehr Frauen mit Fleisch zu versorgen. Bei den Frauen stößt die polygyne Ehe auf wenig Gegenliebe. Sie ziehen es vor, einen Mann für sich zu haben.«
Dux 1994, S. 115
Stoverocks Argumentation manipuliert aber nicht nur die Daten, sie ignoriert auch ein ganzes Feld anthropologischer Literatur, in dem systematische Gründe für das exakte Gegenteil ihrer These vorgebracht werden. Dieses anthropologische Argument, demzufolge Paarbeziehungen geradezu evolutionär konstitutiv für das Entstehen von Homo sapiens sind, schauen wir uns im Folgenden an.
5. Nicht »Female Choice«, sondern »Pair-Bonding«
Die Entwicklungsschritte auf dem Weg vom Last Common Ancestor von Menschen und Menschenaffen, der vor ungefähr sieben Millionen Jahren lebte, lassen sich wie folgt skizzieren: Die Vorfahren des Menschen gaben in einer kaltzeitbedingten Versteppungsperiode das Biotop des Waldes als Lebensumfeld auf und passten sich an das Leben im offenen Grasland an. Dadurch veränderten sie sich nicht nur anatomisch durch die Entstehung des aufrechten Gangs und die Freisetzung der Hand als generisches Manipulationswerkzeug, sondern entwickelten auch eine neue, spezifische Form des Sozialverhaltens, das an die ressourcenärmeren, räumlich ausgedehnteren und durch Raubtiere in höherem Maße gefährdeten Lebensbedingungen der Savanne angepasst war. Evolutionär erfolgreich wurde die Entwicklung einer Fähigkeit zur kognitiv anspruchsvollen Kooperation, die durch Selektion auf ein nicht nur größeres, sondern in funktioneller Hinsicht soziales Gehirn möglich wurde. Dieses Gehirn konnte höhere Formen der Intentionalität verarbeiten und ermöglichte dadurch ein im Vergleich zu den Menschenaffen höher entwickeltes mind reading sowie die bewusste Zuordnung von Verwandtschaftsklassen als Grundlage abgestufter moralischer Verpflichtungssysteme, wodurch Kooperationsbeziehungen zuverlässig stabilisiert wurden und im Vergleich zu den Menschenaffen auf größere Gruppen ausgedehnt werden konnten. Das »soziale Gehirn« wurde damit zugleich zu einem moralischen Gehirn. Kooperation, Verwandtschaft und Moral transformierten das psychologische, emotionale Bindungssystem des Menschen, bevor sich darauf aufbauend höhere Fähigkeiten wie der differenzierte Sprachgebrauch und abstraktes Denkvermögen entwickelten. Der emotional, anatomisch und verhaltensmäßig moderne Mensch beginnt in Gestalt numerisch kleiner, hyperkooperativer Kollektive mit kollektiver Moral und Identität, das heißt auch: einer hohen In-Group-Homogenität, der als Kehrseite ein hohes Potential an Out-Group-Feindseligkeit korreliert, wobei die Grenzen der sozialen Gruppe auf dem Wege sekundärer Prozesse einerseits »kulturell konstruierbar« sind, andererseits aber auch leichter als die Kooperativität der sozialen Kleingruppen wieder verloren gehen können.
Gehen wir die Schritte im Einzelnen durch: während Populationen von Menschenaffen wie die Gorillas und Schimpansen geografisch auf nahrungsreiche ökologische Nischen im Waldland lokalisiert sind, entwickeln die Homininen die Fähigkeit, sich »nomadisierend« das offene Grasland als Lebensraum zu erschließen, dessen Ressourcen sich über ein größeres und nicht klar abgegrenztes Territorium erstreckten und mit höherem Bewegungsaufwand erschlossen werden mussten. Da der aufrechte Gang hierzu Vorteile bot, passte sich der Körperbau so weit an, bis die Füße nicht mehr greifen konnten, sondern auf das aufrechte Gehen spezialisiert waren, während die Funktion der Hand von der Fortbewegung freigesetzt wurde und sich auf Greifoperationen spezialisieren konnte. Es entstanden in der Zeit vor 5 bis 4 Mio. Jahren Sahelanthropus und Ardipithecus, bei denen es sich im Wesentlichen um »Trockenlandaffen« handelte: um
»Menschenaffen, die sich an eine anspruchsvolle Umwelt angepasst hatten, in der regelmäßige Niederschläge und der Nachschub mit Früchten und Kräutern nicht gesichert war. Alle heutigen Menschenaffen leben in Regenwäldern und können sich vorwiegend von Früchten und weichen Kräutern ernähren; wo sie leben, hängt davon ab, wo diese Nahrung das ganze Jahr über verfügbar ist.«
Gamble/Gowlett/Dunbar 2016, S. 148
Am Anfang der Entwicklung zum Menschen steht also ein aufrecht gehender Affe. Die flexible Gestaltung seiner Hand mit ihrer Fähigkeit zu Operationen wie dem »Drei-Punkte-Feingriff«, dem »Fünf-Punkte-Korbgriff« und dem »schrägen Pressgriff« (Suhr 2018, S. 153 ff.) erwies sich als Präadaption, die in einem späteren Abschnitt der Humanevolution zu einer Voraussetzung der Technologieentwicklung wurde. Das Leben in der offenen Savannenlandschaft mit geringerer Nahrungsdichte und folglich längeren Wegstrecken und größerer Zerstreuung der Gemeinschaft bei der Nahrungssuche sowie einer größeren Gefährdung durch Raubtiere, aber auch mit dem regelmäßigen Vorkommen von Buschfeuern, übte einen Selektionsdruck zugunsten von Gemeinschaften aus, die ihr Zusammenleben trotz länger werdender Trennungsphasen erfolgreich koordinieren konnten, die sich schwerer zugängliche Nahrungsressourcen wie Wurzeln und Knollen erschließen konnten und die schließlich durch den Gebrauch des Feuers an leichter verdauliche Nahrung (Fleisch und stärkespeichernde Knollen) gelangten.
Damit wiederum konnte die relative Größe des Darms zugunsten einer wachsenden Gehirngröße schrumpfen und sich generell die für die Nahrungssuche erforderliche Zeit verringern, wodurch der »soziale Tag« länger wurde, das heißt: die für die Pflege sozialer Beziehungen zur Verfügung stehende Tageszeit verlängerte sich und wurde zudem durch die Erfindung der abendlichen Lagerfeuerromantik als sozialem Treffpunkt ausgedehnt. Die Homininen schlugen dadurch einen Entwicklungspfad ein, auf dem die zentrale evolutionäre Innovation in der Entwicklung eines »sozialen Gehirns« bestand, mit dem überlegene soziale Kooperationsbeziehungen möglich wurden. (Gamble/Gowlett/Dunbar 2016) Zugleich wurde es mit diesem größeren Gehirn möglich, komplexe und planungsbedürftige Zusammenhänge wie der Bearbeitung von Rohmaterialien und ihrer Beschaffung über große Distanzen zu bewältigen, womit neben dem Feuer auch die technologische Entwicklung der Steinwerkzeuge in Gang gesetzt wurde. Die Homininen begannen, Intentionalität höherer Ordnung kognitiv verarbeiten zu können, wodurch geteilte Intentionalität und reflexives Bewusstsein, mithin erstmals Selbstbewusstsein, möglich wurde. (Tomasello 2002, 2014) In diesem Entwicklungsschritt wirkten mehrere Komponenten und Präadaptionen zusammen: zunehmende Gruppengröße, zunehmende Gehirngröße, verwandtschaftliche Binnenstrukturierung der größeren Gruppen, »Frühgeburt« des menschlichen Säuglings, kooperative Sorge um den Nachwuchs in der entstehenden Familie sowie die Erschließung von Feuer, gekochter Nahrung und Werkzeugen.
Die These vom »sozialen Gehirn« gilt es in ihren weitreichenden Implikationen näher zu verstehen. Sie besagt im Kern, dass die Größe des (vor)menschlichen Gehirns mit der Größe (vor)menschlicher Gemeinschaften in Korrelation steht: Gemeinschaften von Menschen (oder Homininen), die in persönlichen Beziehungen stehen können, sind im Schnitt 150 Individuen groß: das ist die nach Robin Dunbar benannte »Dunbar-Zahl«. Evolutionär von Bedeutung ist aber nicht, dass sie im Vergleich zur Größe urbaner und moderner Massengesellschaften verschwindend niedrig ist, sondern dass sie um das Dreifache über der typischen Gruppengröße von Menschenaffen liegt. Das korrelierte Wachstum von sozialer Gruppe und Gehirn war jedoch nicht nur ein quantitativer Zusammenhang, sondern führte zu qualitativen Neuerungen, nämlich zu einer vollständigen Revolutionierung des menschlichen Soziallebens, dessen Komplexitätssteigerung mit der Steigerung kognitiver Fähigkeiten in positiver Rückkoppelung stand. Diese Revolutionierung des Soziallebens wurde eingeleitet durch die Entstehung des spezifisch menschlichen Paarungssystems, das heißt: durch die Entwicklung der Paarbindung. Diese Paarbindung und nicht eine angebliche »female choice« war das Spezifische bereits des Soziallebens der Homininen auf dem evolutionären Weg hin zu Homo sapiens.
Allerdings kennen weder Gorillas noch Schimpansen, die beiden nächsten lebenden Verwandten des Menschen, Systeme der Paarbindung. Die genetisch weiter vom Menschen entfernten Gibbons leben überwiegend monogam, doch bei den Gorillas monopolisieren einzelne dominante Männchen einen Harem von Weibchen, und bei den Schimpansen finden wir promiskes Sexualverhalten in einer Gruppe aus mehreren Männchen und Weibchen (»the promiscuous multimale-multifemale group«, Chapais 2010, S. 171). »Female Choice« könnte möglicherweise ein passender Begriff für das Sexualverhalten der Gorillas und Schimpansen sein – allerdings ist das Kriterium der weiblichen Wahl bei den Gorillas nicht die sexuelle Fitness des Silberrückens, sondern die Vermeidung der bei Gorillas üblichen Infantizide. Und bei den Schimpansen und Bonobos scheinen die Weibchen gerade nicht übermäßig wählerisch zu sein, jedenfalls gibt es bei ihnen nicht wie bei den Gorillas größere Gruppen von »Junggesellen« ohne Zugang zu Sexualpartnern. Wie also könnte die menschliche Paarbindung evolutionär entstanden sein?
Eine erste Ausgangsvoraussetzung hierzu lag in einer Konsequenz des aufrechten Gangs: Der aufrechte Gang führte anatomisch zu einem schmaleren Becken und damit zu einer Verengung des Geburtskanals beim Weibchen. Zunächst blieb das ohne weitere Folgen, weil die Größe der Köpfe der Neugeborenen auf der Stufe von Ardipithecus noch keine Quelle möglicher Komplikationen bei der Geburt darstellten. Als die Größe des Gehirns und damit der Schädelkapsel jedoch zunahm, musste das Neugeborene als relative Frühgeburt zur Welt kommen. Eine der menschlichen Körpergröße entsprechende Tragzeit müsste bei bloßer Fortsetzung des Schemas der Menschenaffen bei 21 anstatt bloß neun Monaten liegen. (Suhr 2018, S. 182) Der menschliche Säugling ist also bei seiner Geburt in weitaus höherem Maße unselbständig und versorgungsbedürftig als ein neugeborener Schimpanse. Zudem sind abgestillte Schimpansenkinder zur selbständigen Nahrungssuche imstande, während menschliche Kinder noch Jahre darüber hinaus der Versorgung bedürfen, während die Mutter bereits den nächsten Säugling stillt. (Chapais 2010, S. 164, Hrdy 2011, S. 31) Von einem bestimmten Moment an sorgte eine kooperative Versorgung des Nachwuchses nicht mehr (wie bei den Menschenaffen) ausschließlich durch die Mutter, sondern auch durch das soziale Umfeld der Mutter für eine Erhöhung der evolutionären Fitness des Nachwuchses. Damit wurde das soziale Leben des Kleinkinds anspruchsvoller, und das bereits zu einem Zeitpunkt, in dem es noch vollständig von Fürsorge abhängig war: die erweiterte Fähigkeit zum mind reading wurde zur Erfolgsvoraussetzung für die Gestaltung sozialer Beziehungen zu einer Mehrzahl von Familienangehörigen (neben der Mutter auch Geschwister, Vater und Großeltern), auf die es zum Überleben einer verlängerten unselbständigen Kindheit existenziell angewiesen war.
Teil dieser Revolutionierung des Sozialsystems war auch die »Familialisierung des Mannes« (Habermas 2001, S. 149 f.) in der sozialen Rolle des Vaters. Wie Verwandtschaft generell, so muss auch Vaterschaft sozial zugeordnet werden, um zur Grundlage moralisch abgesicherter Kooperationsbeziehungen werden zu können. Aber es gibt mehrere Wege der Zuordnung von Vaterschaft. Auch in polygynen Beziehungsmustern ist die Rolle des Vaters sozial definiert, Monogamie ist dafür keine zwingende Voraussetzung. Die biologischen Indikatoren für die Einordnung der Homininen und des Menschen auf einer Monogamie-Polygynie-Skala, nämlich der Grad des sexuellen Dimorphismus und das Längenverhältnis zwischen Zeigefinger und Ringfinger (Gamble/Gowlett/Dunbar 2016, S. 100), deuten auf eine Mittelstellung des Menschen zwischen monogamen Gibbons und promisken Schimpansen und Bonobos hin. Paarbindung ist also nicht mit strikter Monogamie identisch. Worin besteht der Unterschied? Der Begriff der Monogamie bezieht sich auf die Exklusivität von Sexualpartnern, aber der Begriff der Paarbindung bezeichnet einen stabilen Zusammenhang mehrerer Verhaltensmuster: (1) eine relativ stabile Beziehung zu einem bevorzugten Sexualpartner, (2) eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung bei der Nahrungsbeschaffung mit dem Ziel der Versorgung des gemeinsamen Nachwuchses und (3) eine Beachtung von bilateralen Verwandtschaftsverhältnissen bei der Gestaltung der sozialen Beziehungen über die Kernfamilie hinaus. Hinzu kommt das kontraintuitive Merkmal, dass sich auch polygyne Beziehungsmuster in diesem Sinne als Parallelität mehrerer Paarbindungen verstehen lassen, weil das entscheidende Kriterium in der Dauerhaftigkeit dieser Beziehungen und ihrer Koppelung an Versorgungsleistungen besteht. (Chapais 2010, S. 160 f.) »Paarbindung« bezieht sich nicht auf den Unterschied von Monogynie und Polygynie, sondern auf den Unterschied von stabilen Langzeitbeziehungen der sexuellen Partnerschaft und Fürsorge einerseits und okkasioneller Promiskuität ohne soziale Verpflichtungen andererseits.
Dieses Bündel an Verhaltensmustern ist jedoch nicht auf einen Schlag, sondern durch eine mehrstufige evolutionäre Entwicklung entstanden. Den Ursprung der Paarbeziehung kann man in einer Anpassung der mate-guarding-Strategien bei den Homininen sehen: Männchen waren zunächst nur auf den Zugang zu Weibchen aus, ohne sich deswegen schon am parentalen Investment zu beteiligen. Bernard Chapais schlägt einen Entstehungszusammenhang ökologisch eingeschränkten mate guardings (»ecologically constrained mate-guarding strategies«, Chapais 2010, S. 174) vor, in dem die räumliche »Dichte« verfügbarer Nahrungsquellen und die Größe der tagsüber nahrungssuchenden Gruppen in Beziehung stehen:
»Briefly, if females can forage in small groups owing to the density and spatial dispersion of food, a single male can defend such groups against other males, the outcome being a polygynous unit. But if females forage in larger groups, a single male cannot exclude other males, and the outcome is a multimale-multifemale composition.«
Chapais 2010, S. 173
Das Fouragieren in kleinen Gruppen entspräche dabei der Situation der Homininen in der Savanne mit einer geringen Nahrungsdichte, in der sich die tagsüber aktiven kleinen Gruppen unter dem Schutz eines Männchens erst abends an ihren Schlafplätzen wieder zu größeren Verbänden zusammenschließen. Das promiske »multimale-multifemale«-Beziehungsmuster wandelte sich dabei in ein Multi-Harem-Beziehungsmuster. Dieses Beziehungsmuster kann wiederum unter Druck geraten, wenn aufgund des oben skizzierten Umstands der menschlichen »Frühgeburt« die Versorgungsanforderungen der Mutter-Kind-Dyaden steigen. Chapais schlägt vor, dass eine Lösung dieses Problems wiederum durch den Umstand begünstigt wird, dass die Homininen bereits über eine Technologie von Steinwerkzeugen verfügen: diese Steinwerkzeuge sind nicht nur Werkzeuge, sondern auch »waffenfähig«, das heißt, sie können außer für die Materialbearbeitung und die Jagd auch gegen andere Menschen eingesetzt werden. Dadurch relativierte sich das Merkmal reiner physischer Überlegenheit entscheidend, das noch die Dominanzhierarchien unter Menschenaffen reguliert hatte:
»Any tool, whether it was made of wood, bone, or stone, and whatever its initial function, from digging up roots to killing animals, could be used as a weapon in the context of intraspecific conflicts, provided it could inflict injuries. Armed with a deadly weapon, especially one that could be thrown some distance, any individual, even a physically weaker one, was in a position to seriously hurt stronger individuals. In such a context it should have become extremely costly for a male to monopolize several females. Only males able to monopolize tools and form coalitions could do do. But because all males can make tools and form coalitions, generalized polygyny was bound to give way eventually to generalized monogamy.«
Chapais 2010, S. 177
Oder kürzer gefasst: »(M)onogamy ›replaced‹ polygyny when the costs of polygyny became too high.« (Chapais 2010, S. 176)
Dieser Erklärungsansatz hat mehrere faszinierende Implikationen: Wir müssen erstens nicht die Annahme treffen, dass Homo sapiens biologisch auf Monogamie »festverdrahtet« ist wie beispielsweise die Gibbons, wodurch sich das episodische Hervortreten polygyner Beziehungsmuster in der weiteren menschlichen Geschichte ebenso plausibel erklären lässt wie die von der Evolutionspsychologie beschriebenen asymmetrischen Muster sexueller Attraktivität in einer modernen, kulturell libertinistischen Gesellschaft: es ist nämlich die Entstehung von sozialer Schichtung bzw. Klassengesellschaften im Gefolge der neolithischen Revolution, die die Monopolisierung von Waffen und Ressourcen und damit ein Umkippen der ursprünglichen mate guarding-Gleichgewichte sozial ermöglicht hat, und es ist die moderne, kulturgeschichtlich einzigartige Freisetzung der »nackten« sexuellen Attraktionskräfte von ihren kulturellen Fesseln, die das Beobachtungsmaterial der heutigen Evolutionspsychologie allererst erschaffen hat. Wir haben daher (zweitens) ein frühes Beispiel dafür, dass die biologische »Verdrahtung« menschlicher Verhaltensmuster durch kulturelle Faktoren überformt werden kann und dass dies (drittens) bereits vor dem Abschluss der biologischen Evolution von Homo sapiens wirksam, also selbst ein evolutionär selektiver Faktor gewesen ist. In den Worten von Chapais:
»If monogamy did not evolve as a result of specific selective pressures, the drive for polygyny was merely checked, not eliminated. Polygyny could reemerge whenever some males secured more competitive power or were able to attract several females based on attributes other than physical prowess. Human societies amply testify to this reemergence.«
Chapais 2010, S. 178
Mit dieser Einsicht einer »reemergence« der Polygynie fällt die zentrale These Stoverocks: dass es der Übergang zu Sesshaftigkeit und Staatlichkeit in und nach der neolithischen Revolution gewesen sei, der die monogame, also angeblich »nach männlichen Bedürfnissen gestaltete« Gesellschaft hervorgebracht habe. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall: durch die entstehende soziale Schichtung und die hierdurch mögliche Monopolisierung von Waffen und Ressourcen wurde es erstmals wieder möglich, der biologisch nicht ausgelöschten, aber kulturell überformten Disposition zur Polygynie zumindest am oberen Ende der sozialen Schichtung wieder kulturellen Spielraum zu verschaffen. Es waren wohlhabende Haushalte und Häuptlingstümer im frühgeschichtlichen und hochkulturellen Orient, in denen erstmals seit einer Million Jahren wieder eine Polygynie führender Männer institutionalisiert wurde. Wobei die female choice solcher Arrangements ziemlich berechenbar ausfiel: sie richtete sich zuverlässig dorthin, wo ganz unübersehbar der Wohlstand ausgebrochen war. Bei Homo sapiens, und nur bei ihm, ist »eine Frau für jeden Mann« die evolutionäre Grundregel und »mehrere Frauen für einzelne Männer« die opportunistische kulturelle Option.
Die Erweiterung des männlichen Mate-guarding auf Versorgungsbeziehungen und die damit erfolgende Erfindung der Vaterschaft war der nächste evolutionäre Entwicklungsschritt. Zur Verstetigung der Paarbeziehung trug auch die verdeckte Ovulation der Homininenweibchen bei, die bewirkte, dass der Zeitpunkt der Fruchtbarkeit des Weibchens für das Männchen nicht mehr erkennbar war, während das Weibchen auch außerhalb der Zeiten der biologischen Empfängnisbereitschaft sexuell aktiv blieb. Sex wurde zu einem dauerhaften Aspekt der Beziehungspflege (des »sozialen Kraulens«), und der verdeckten Ovulation beim Weibchen korrespondierte ein anatomischer »Umbau« des männlichen Sexualapparats. In den Worten von Geoffrey Miller:
»Wären wir eine Spezies, bei der die Männchen das Sexualsystem dominierten, dann hätten Männer 2,5 Zentimeter lange Penisse wie dominante Gorillas. Der große männliche Penis ist ein Produkt der weiblichen Auswahl während der Evolution. Wenn dies nicht so wäre, hätten sich die Männer niemals mit der Entwicklung eines so großen, schlaffen und bluthungrigen Organs abgegeben. Unsere weiblichen Vorfahren brachten die Männer dazu, weil ihnen solche Penisse gefielen.«
Miller 2010, S. 268 f.
Die soziale Vaterschaft, die der zuverlässigen Kenntnis der biologischen Vaterschaft vorausgeht, war der Kern dessen, was Gamble, Gowlett und Dunbars These vom »sozialen Gehirn« und Chapais’ These vom Pair-Bonding als dem Ursprung menschlicher Gesellschaften ausmacht, und sie hat weitreichende, ja revolutionäre Implikationen: es entstehen Systeme der Verwandtschaft.
Verwandtschaft ist zunächst eine rein biologische Tatsache, zu der eine über den biologischen Westermarck-Effekt einer sexuellen Abstoßung vermittelte »instinktive« Inzestvermeidung gehört. Bereits Primatensozietäten sind aufgrund dieses Effektes dahingehend »exogam«, dass mit dem Erreichen der Geschlechtsreife üblicherweise die Weibchen die soziale Bezugsgruppe ihrer Geburt und ihres Aufwachsens verlassen – eine Präadaption für die spätere Institutionalisierung exogamer Heiratsregeln.
Um aber über eine Tendenz zur Inzestvermeidung hinaus sozial wirksam zu werden, musste Verwandtschaft zunächst überhaupt bewusst gemacht und kognitiv zugeschrieben (also mithin »sozial konstruiert«) werden. Die Voraussetzung dafür lag in dem, was Bernard Chapais eine »period of shared developmental familiarity near a parental mediator« (Chapais 2010, S. 204) nennt, also einen biografischen Zeitraum, in dem ein Individuum die Erfahrung stabiler Sozialbeziehungen zu einem anderen Individuum macht, von dem es versorgt wird und von dem es lernen kann. Eine solche Beziehung war ursprünglich keine andere als die der Mutter-Kind-Dyade, wird aber bei den Homininen zusätzlich an »aushelfende Eltern«, sogenannte »Alloparents« (Hrdy 2011) delegiert. »Verwandtschaft« beruhte somit zunächst nicht auf einem abstrakten Wissen über den Zusammenhang von Sexualität und Schwangerschaft, sondern auf nichts anderem als einer die Erinnerung prägenden Erfahrung verlässlicher sozialer Nähe. Die Erfahrung einer solchen Nähe führt auch bei Menschenaffen dazu, dass adulte Individuen ihre faktischen Verwandten bei kooperativen Tätigkeiten und sozialer Koalitionsbildung bevorzugen. Sozial erfahrbar ist aber bei Menschenaffen nur die direkte mütterliche Verwandtschaft.
Stabile Beziehungen zwischen Vater und Mutter revolutionierten das System der Erfahrung sozialer Nähe: sie stabilisierten das soziale Bindungssystem dahingehend, dass sie erfahrbar stabile Situationen der gegenseitigen Fürsorge auf Dauer stellen und gleichsam als Archetyp verlässlich erfahrbarer Nähe fungieren. Die Betonung liegt auf »verlässlich«, weil das parentale Investment auf eine größere Abhängigkeit des Nachwuchses reagieren musste. Diese Aufgabe wurde über die Paarbindung der Eltern hinaus auch an unterstützende »alloparents« (Hrdy), d. h. an die nähere Verwandtschaft, an ältere Brüder und Schwestern und an die Großeltern delegiert. Durch den kürzeren Intervall zwischen Geburten und die gleichzeitige Verlängerung der Zeit erforderlicher Versorgung der Kinder (mit »technisch veränderter«, das heißt gekochter Nahrung) wurde evolutionär auf erfolgreiche Kooperation der Erwachsenen, aber auch auf erfolgreiches mind reading der abhängigen Kleinkinder selektiert und die Erfahrung stabiler Vertrauensbeziehungen auf Gegenseitigkeit geschaffen, mit anderen Worten: es kam zur »Erfindung der Moral« als einzigartigem Merkmal von Homo sapiens. Sozial zugeschriebene Verwandtschaft lieferte die kognitive und moralische Struktur eines Netzwerks von Vertrauensbeziehungen und gegenseitigen Verpflichtungen.
Dieses verwandtschaftlich strukturierte Bindungssystem wurde so zum evolutionären Ursprung der Moral, und Moral begann evolutionär mit der Entstehung moralischer Gefühle, eines Gerechtigkeitsempfindens und eines Begriffs der Ehre. Soziale Bindung wurde so intensiviert, dass sie »im Gedächtnis blieb«. Das hatte eine ganze Reihe von Konsequenzen: (1) Die Verwandten des Vaters wurden als Verwandte sozial zurechenbar. (2) Die Verwandten der Mutter gingen im Moment der exogamen »Auswanderung« der Mutter dem sozialen Gedächtnis nicht mehr verloren, sie blieben als Verwandte sozial zurechenbar. (3) Verwandtschaftsverbände blieben über die Exogamie-Grenzen hinaus aufeinander bezogen. (4) Parentales Investment konnte innerhalb der als Verwandtschaft definierten Eigengruppe partiell delegiert werden. (5) Innerhalb der verwandtschaftlichen Gruppe entstanden Vertrauensbeziehungen, Erwartungshaltungen auf gegenseitige Verlässlichkeit und damit schließlich moralische Vorstellungen. (6) Dadurch, dass bereits das frühkindliche Aufwachsen eine Lebensphase des sozial anspruchsvollen »Managements« von Abhängigkeitsbeziehungen darstellt, wurde die Fähigkeit zum mind reading zu einem evolutionären Selektionsvorteil und somit zur proximalen Ursache sowohl der menschlichen Fähigkeit zur geteilten Intentionalität als auch der menschlichen Moral. (Hrdy 2011, Tomasello 2016) Das, was Tomasello als »geteilte Intentionalität« bezeichnet, ist nicht nur ein rein kognitives, sondern auch ein emotionales Phänomen. Geteilte Intentionalität entstand im Verlauf einer Revolution des menschlichen Bindungssystems: die Fähigkeit zum Intentionsverstehen wurde unter den Bedingungen obligaten alloparentalen Investments als Überlebensfaktor existentiell, das heißt: es wurde evolutionär darauf selektiert. Dadurch, dass die emotionale Grundlage dieses neuen Bindungssystems als Antwort auf gesteigerte Abhängigkeitsbeziehungen entstand, entstanden auch die Grundlagen der Moral in Gestalt moralischer Gefühle. Menschen sind durch Missbilligung (und schließlich durch missbilligende Worte) ebenso verwundbar wie durch physische Angriffe.
Fazit: Bewusst zugeschriebene Vaterschaft und Paarbindung waren ein Schlüssel für die Entstehung bewusst zugeschriebener Verwandtschaft sowie stabiler Beziehungen gegenseitiger Verpflichtung zwischen basalen Einheiten der Verwandtschaft, den von Claude Lévi-Strauss so genannten »Verwandtschaftsatomen«. (Lévi-Strauss 1977, S. 60 f., 1993), wobei das Verwandtschaftsatom der strukturalistischen Theorie der durch Paarbindung konstituierten Kernfamilie noch den Mutterbruder hinzufügt: »Verwandtschaft« ist ein Tripel von Allianz (»Heirat«), Deszendenz (»Abstammung«) und Konsanguinität (»Blutsverwandtschaft«). Während bei den Menschenaffen der Bezug der Mutter zu ihrer Herkunftsfamilie verlorengeht, blieb er beim Menschen durch eine starke Geschwisterbeziehung zwischen der Mutter und ihrem Bruder erhalten. Die Beziehung zwischen Mutter und Mutterbruder konservierte, was die Exogamie andernfalls zerstört hätte: die Blutsverwandtschaft zwischen väterlichen und mütterlichen Clans. Es ist der Mutterbruder (bzw. das »Avunkulat«), durch den das Verwandtschaftsatom gleichsam »molekular bindungsfähig« wird und Beziehungen der sozialen Verpflichtung zu anderen Clans pflegen kann.
Während die Schwester-Bruder-Beziehung durch das gemeinsame Aufwachsen faktisch gegeben, das heißt: von Anfang an in der gemeinsamen biografischen Erfahrung verankert war, ist die Allianzbeziehung »sozial konstruiert«, das heißt, als Kategorie sozialer Verpflichtung konstituiert. Gemeinschaften von Menschenaffen, in denen die exogame Mutter ihre soziale Herkunftsgruppe vergessen hat und nicht auf alloparentale Unterstützung (Hrdy) angewiesen ist, benötigen keine Kategorie der Allianz (und können sie in Ermangelung eines »sozialen Gehirns« auch nicht bilden). Wenn die Beziehung zum Vater aber Verpflichtungen (primär: zur alloparentalen Unterstützung durch ihn selbst und seine Blutsverwandten) implizieren soll, muss sie als bewusst zugeschriebene Beziehungskategorie in die moralische Buchführung mit aufgenommen werden. Somit ist »Paarbindung« als soziale Kategorie und soziale Konstruktion der Schlüssel zum verwandtschaftlich organisierten menschlichen Sozialverhalten.
Das bedeutet in Bezug auf Stoverocks These: »Jeder nur eine Frau«, das Muster, das Stoverock mit der Entstehung der »männlichen Zivilisation« sich ausbilden sieht, ist somit so alt wie die menschliche Art und die menschliche Kultur selbst.
Als Resultat der »Familialisierung des Mannes« am Beginn der kulturellen Evolution entstand somit tatsächlich ein spezifisches »männliches Bedürfnis« – das Bedürfnis nämlich, ein guter Versorger von Frauen und Kindern zu sein, denn dieses Bedürfnis ist die kulturelle Form, die das biologische Bedürfnis nach Sex beim Kulturwesen Homo sapiens annahm. Nur weil Stoverock als Kulturanthropologin einen Totalausfall darstellt, kann sie sich zu Formulierungen wie der folgenden versteigen:
»Männer haben die Zivilisation von Anfang an so gestaltet, dass zuallererst ihre aus dem Sexuellen Konflikt entstandenen Bedürfnisse und Notwendigkeiten berücksichtigt wurden. (…) Das, womit wir im Moment hadern, ist die Erkenntnis, dass die Zivilisation fast nur für eine Sorte Mensch funktioniert: den Mann.«
S. 17
Die neolithische Revolution brachte darum keine »männliche Zivilisation« hervor, weil die auf relativ stabilen Paarbeziehungen beruhende Vergemeinschaftungsform der Geschlechter ein Merkmal der menschlichen Kultur schlechthin ist. Die Geschlechterbeziehungen des paläolithischen Homo sapiens waren nicht, wie Stoverock behauptet, »naturbelassen«. Zivilisation »funktioniert« entweder für beide Geschlechter, oder für keines, also überhaupt nicht.
Stoverock verwechselt den Übergang zur menschlichen Hochkultur mit der Entstehung der menschlichen Kultur als solcher. Sie verlegt in die Anlaufzeit zur Hochkultur im Neolithikum, was tatsächlich eine Eigenschaft der menschlichen Kultur schlechthin ist und mit der Familialisierung des Mannes einsetzt: das Paarungsverhalten kulturellen Regeln zu unterwerfen.
Sie missversteht das Neolithikum auch noch in anderer Hinsicht, wenn sie dort die »Entstehung männlicher Hierarchien« verorten will: »Männliche Hierarchie« ist in erster Linie funktionelle Hierarchie unter Männern, die in altsteinzeitlichen Jagdgruppen und frühgeschichtlichen Kriegergemeinschaften gleichermaßen funktioniert.
Die sakrale Hierarchie der frühen Staaten und aller späteren ständegesellschaftlichen Statushierarchien dagegen ist ein ganz anderes Phänomen, das sich auf Lineages, d. h. auf Dynastien, und schließlich auf ganze soziale Schichten bezieht. Es ist immer die ganze Sippe, immer ein ganzer Familienverband, der im sozialhierarchischen Statusfahrstuhl nach oben oder unten fährt. So war es beispielsweise der Rang ihrer Familie innerhalb einer Ständegesellschaft, der es der Frau des Potiphar gestattete, ihrem Haussklaven Joseph eine Falschbeschuldigung wegen sexueller Belästigung anzuhängen. (Gen. 39, 7-15)
Schließlich verwechselt Stoverock auch Individualbesitz und Privateigentum. Individualbesitz gibt es, seit paläolithische Jägergruppen die Jagdbeute erst unter den Jägern aufteilen, bevor diese es innerhalb der Paarbeziehung weitergeben. Privateigentum entsteht aus der Weitergabe erblichen Besitzes. Jedes Stück Fleisch aus dem Beuteanteil des Jägers ist ein Individualbesitz. Der wesentliche Unterschied zum Zeitalter der Landwirtschaft besteht darin, dass man im Unterschied zu Pflug, Land und Immobilie ein Rib-Eye-Steak nicht als Familienerbsteak Familienerbstück weiterreichen kann.
Für Erbangelegenheiten dagegen muss die Nachkommenschaft unzweifelhaft bestimmbar sein. Die Einschränkung der sexuellen Freiheiten der Frau entsteht daher nicht aus dem »Bedürfnis«, die Female Choice zurückzudrängen, sondern daraus, Vaterschaft und damit Genealogien zurechenbar zu machen.
An dieser Stelle beginnen wir zu verstehen, inwiefern Stoverock ihr Erklärungsmodell als »feministisch« verteidigen kann: sie macht in aller subjektiven Unschuld den auf einem impliziten Biologismus beruhenden Sexismus der feministischen Ideologie explizit. Ihre nach dem Triebstaumodell konstruierte Vulgärpsychologie des Mannes ist nicht nur mit jedem feministischen Vorurteil über Männer kompatibel, sondern adelt es geradezu.
Man kann dies freilich auch als eine Entfaltung der dem Feminismus inhärenten Widersprüche verstehen, insofern sie unfreiwillig aufdeckt, dass diese Ideologie zwischen der Skylla der Biologieverleugnung im Genderfeminismus und der Charybdis des uneingestandenen Biologismus im Radikalfeminismus offenbar einer bipolaren Störung unterliegt. Stoverocks Gegenwartsdiagnose, die ich hier nicht eigens zum Thema mache, erliegt daher folgerichtig den Implikationen des bisher Gesagten. Aus falschen Voraussetzungen ergeben sich falsche Schlussfolgerungen, und wenn die angeblich »männliche Zivilisation« des Neolithikums keinen Sündenfall darstellt, dann kann auch die Frauenbewegung nicht davon erlösen.
6. Kritische Anmerkungen zur Evolutionspsychologie
Aus den Argumenten des vorstehenden Abschnittes ergeben sich Konsequenzen für das Verständnis dessen, was die menschliche Kultur ausmacht und wie das ihr Verhältnis zur menschlichen Biologie bestimmt. Hier stoßen wir auf ein Paradox: Der evolutionäre Erfolg von Homo sapiens beruhte gerade nicht auf einer Steigerung seiner individuellen Fitness. Er beruhte nicht auf einer Entstehung von weiblichen Superbrütern, die um die Gunst von männlichen Superjägern und Superkriegern konkurriert hätten (und umgekehrt), sondern im Gegenteil auf der Hyperkooperativität von durch Selbstdomestizierung körperlich mittelmäßig gewordenen Individuen, die im Kopf haben mussten, was die Männchen nicht mehr in den Eckzähnen und den Oberarmen und die Weibchen nicht mehr in einem selbstgenügsamen Geburtsapparat und Fürsorgeprogramm hatten. Sowohl Männchen als auch Weibchen der Homininen wurden paradoxerweise in ihrer individuellen Physiologie fragiler und anfälliger als Menschenaffen (die philosophische Anthropologie Plessners und Gehlens hatte diese Intuition in den Begriff des »Mängelwesens« gefasst, das sein Verhalten darum in kulturellen Institutionen stabilisieren muss). Dass die Homininen darüber nicht ausgestorben sind, lag daran, dass sie diese physiologischen Nachteile durch die Entwicklung der Funktionen ihres Gehirns wettmachen und mehr als wettmachen konnten. »Evolutionäre Fitness« ist in der Entwicklungslinie von den Homininen zum anthropologisch modernen Menschen nicht mehr primär an die physischen Merkmale von Individuen gebunden, sondern an ihre sozialen Kompetenzen, und das heißt: an ihre Fähigkeit zur Kooperation und zum mind reading, das heißt zum wechselseitigen reflexiven und rekursiven Verstehen von Intentionen. Letzteres aber ist Ursprung und Inbegriff dessen, was wir »Kultur« nennen.
Die ursprüngliche Idee der Evolutionspsychologie bestand darin, dass die psychologischen Mechanismen, die dem menschlichen Verhalten zugrunde liegen, im Verlaufe der Hominisierung, also der zum anthropologisch modernen Menschen führenden evolutionären Prozesse entstanden sind – womit nicht der Mensch der kulturellen Moderne, also der letzten zwei bis drei Jahrhunderte, gemeint ist, sondern die eiszeitlichen Jäger und Sammler (Barkow, Cosmides, Tooby 1992). Diese ursprüngliche Fragestellung wies noch keine Polarisierung zwischen »Biologie« und »Kultur« auf, sondern verstand sich als integrativer Ansatz einer sozialwissenschaftlichen Anthropologie. Zu einer Konfrontation der Evolutionspsychologie mit den Sozialwissenschaften kam es erst durch den Streit um sogenannte blank slate-Theorien innerhalb letzterer, die insbesondere durch den Aufschwung genderfeministischer Theorien seit den 1990er Jahren eine politische Aufladung erfuhren. Es war die aggressive Frontstellung jüngerer feministischer Theorien gegen einen vermeintlichen »Biologismus« in der Soziologie der Geschlechterverhältnisse, die einen in die Wissenschaften ausgreifenden Kulturkampf auslöste und erwartbar scharfen Widerspruch hervorrief. Diese Kontroverse begann mit Judith Butlers 1990 erschienener Arbeit »Gender Troubles« (dt. 1991 als »Das Unbehagen der Geschlechter«), in der Butler das empirisch beobachtbare Paradox der Einnahme männlicher und weiblicher Geschlechtsrollen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen aufgriff. Methodologisch auffällig war dabei jedoch, dass sie systematisch jedem Rückgriff auf biologische Theorien aus dem Weg ging und stattdessen postulierte, dass die zu erklärenden Verhaltensmuster ausschließlich »diskursiv« erschaffen worden seien. Damit schnitt Butler die feministisch geprägte Geschlechterforschung von jeder seriösen anthropologischen Diskussion ab und nahm jene Weichenstellung vor, die die »Genderforschung« in die politische Ideologisierung und ideologische Radikalisierung führte.
Im Gegenzug verengte sich die evolutionspsychologische Argumentation auf einen Kampf gegen die nun entstehenden, feministisch politisierten Varianten eines blank slate-Denkens sowie in empirischer Hinsicht auf die Erklärung kulturell modernen Verhaltens im Rahmen einer individualistischen und sexuell libertinistischen Gesellschaft. Hier unterliegt die Evolutionspsychologie einer dem sogenannten »Geschlechterparadox« analogen Verkürzung der Perspektive: »Geschlechterparadox« bezeichnet die Erkenntnis, dass auch eine maximale kulturelle Befreiung von traditionellen Geschlechtsrollen nicht zu einer tatsächlichen Angleichung männlicher und weiblicher Präferenzen und Verhaltensweisen führt – ein Befund, den die feministische Kritik anstatt auf evolutionspsychologisch herleitbare Dispositionen auf einen Fortbestand »patriarchaler Herrschaft« zurückführen will. Die Kehrseite des Geschlechterparadoxes besteht jedoch darin, dass die trotz kultureller Gleichheitsnormen divergierenden tatsächlichen Verhaltensweisen von Männern und Frauen erst dadurch »im Naturzustand« beobachtbar werden, dass eine individualistische Massengesellschaft die Befreiung von Geschlechtsrollen und die Maximierung sexuellen Vergnügens zum kulturellen Wert erklärt hat. Ohne eine Kultur der Befreiung wäre der evolutionspsychologische Gegenstand nicht sichtbar. Mit dieser Blickverengung der Evolutionspsychologie auf die kulturelle Moderne kommt der Blick auf die evolutionäre Bedeutung der Kultur für die Hominisierung unter die Räder des gegenwärtigen Kulturkampfes. Als emblematisch für diese Sichtweise kann eine Aussage von David Buss in »The Evolution of Desire« stehen, die wie eine Spiegelung der genderfeministischen Behauptung von der »Omnirelevanz« von Geschlecht (ursprünglich Garfinkel 1967, dt. Garfinkel 2020, feministisch adaptiert von West/Zimmerman 1987) wirkt:
»Although I am aware of the cliché that if you give someone a hammer everything looks like a nail, I’ve come to believe that human mating strategies permeate nearly every human endeavor. I see them everywhere. They shape status hierarchies among women and foster sexual treachery among men. They delay male puberty early in life while causing premature death at the other end – both products of mate competition.«
Buss 2016, S. ix
Die interpretativen Fallstricke einer solchen Perspektivverkürzung lassen sich an einem evolutionspsychologischen Standardbefund erläutern: der Orientierung moderner Frauen am sozialen Status männlicher Partner. In der Formulierung von Buss:
»An examination of traditional hunter-gatherer societies, which are our closest guide to what ancestral conditions were probably like, suggests that ancestral men had clearly defined status hierarchies. (…) Women desire men who command a high position in society because social status is a universal cue to the control of resources. Along with status come better food, more abundant territory, and superior health care. Greater social status bestows on children social opportunities missed by children of lower-rank males. (…) Women in the United States express clear preferences for potential mates who have high social status or a high-status profession, qualities that are viewed as only slightly less important than good financial perspectives.«
Buss 2016, S. 41 f.
Es fragt sich, wen Buss hier mit »ancestral men« meint. Die Jäger-und-Sammler-Gesellschaften, die er nennt, verfügen über nur geringen Spielraum für die Differenzierung von Status. Die wichtigste Statusdimension ist hier das Lebensalter, weil es für kumulierte Erfahrung steht. Auch würde eine »high position in society« zunächst mal eine nennenswerte hierarchische Höhe der sozialen Ordnung voraussetzen. Auch das ist in Bezug auf zahlenmäßig kleine Jäger-und-Sammler-Gesellschaften mit notorisch knappen, nicht monopolisierbaren Ressourcen eine unzutreffende Vorstellung. Wichtiger als Statuskonkurrenz ist in solchen Gesellschaften ohnehin der solidarische Zusammenhalt und das »Speichern von gegenseitigen Verpflichtungen« (Hrdy).
Noch fragwürdiger ist es, eine soziale Statusorientierung mit den Beobachtungen zu Statushierarchien unter Menschenaffen kurzzuschließen, die als Dominanzhierarchien aufgebaut sind. Ein Beispiel für einen solchen Kurzschluss finden wir in David Geary’s »Male, Female«, in einem Abschnitt über die »Benefits of Control«:
»Whatever the species, male-male competition is all about gaining access to reproductive females or control of the resources females need to reproduce. This is achieved by controlling others male’s access to females and resources and by limiting the expression of female choice. The same is true for female-female competition and competition over the resources needed for survival. (…) History’s despots illustrate the theme, as their behavior provides a glimpse into how some people use social influence and resource control in the absence of social and affective (e.g., guilt) constraints. (…) (S)uccessful despots and their coalitions gained control of the first six human civilizations – ancient Mesopotamia, Egypt, the Aztec and Inca empires, and imperial India and China. These men did not share their wealth and power but diverted the material and social resources of the culture to themselves and to their kin and used these resources in ways consistent with evolutionary predictions. The men, for instance, almost always had exclusive sexual access to scores of women, often many more.«
Geary 2010, S. 250
Diese Darstellung ist in zweierlei Hinsicht fragwürdig. Erstens springt sie von einer allgemeinen Beobachtung des Tierreichs (mit Schwerpunkt auf den Primaten) zu einer Beobachtung am Anfang der Epoche hochkultureller menschlicher Gesellschaften, die sich durch eine bis dahin präzedenzlose gesamtgesellschaftliche Erwirtschaftung beträchtlicher Ressourcenüberschüsse auszeichnet, welche überhaupt erst die Voraussetzungen für Monopolisierungsstrategien erschaffen. Der Millionen von Jahren währende Zeitraum der Humanevolution, in dem solche Voraussetzungen gerade fehlten, wird dabei übersprungen. Und zweitens erfolgt die Argumentation unter den Schlüsselbegriffen von »Control« und »Competition«. In dem von Geary leichtfüßig übersprungenen Zeitraum hat sich aber ein ganz anderes Merkmal des Menschen entwickelt: seine unvergleichlich hoch entwickelte Fähigkeit zur Kooperation. Geary erweckt somit den Anschein, als könne man menschlichen Sozialstatus als bruchlose Fortsetzung der Dominanzhierarchien unter Menschenaffen betrachten. Nach den Befunden, die von der mittlerweile Jahrzehnte währenden vergleichenden Forschung zu Menschen und Menschenaffen erarbeitet worden sind und auf die wir im vorhergehenden Abschnitt Bezug genommen haben, kann genau davon aber gar keine Rede sein.
Stattdessen kommt es im Verlauf der Hominisierung zu einer entscheidenden Transformation dessen, was die Evolutionspsychologie als »Status« bezeichnet. Unter Menschenaffen ist sozialer Status eindimensional: er beruht ausschließlich auf der physischen Überlegenheit einzelner Männchen und der dadurch konstituierten Dominanzhierarchie, wobei Schimpansen in größerem Maße als Gorillas mit anderen Männchen Koalitionen bilden, um Ansprüche (vor allem auf Weibchen) durchzusetzen oder zu verteidigen. Zudem wird in Bezug auf Primaten Status vom menschlichen Beobachter extern zugeschrieben, Menschenaffen verfügen über kein Konzept von Status, sondern nehmen nur fallweise Abwägungen von Erfolgs- und Schadenswahrscheinlichkeit vor. Beim Menschen beruht Status dagegen primär auf seiner Fähigkeit zur Kooperation. Es genügt nicht, ein guter Jäger zu sein – entscheidend ist es, ein kooperativer Jäger zu sein. Und wer kein guter Schütze ist und nicht die schärfsten Augen hat, kann immer noch daran mitwirken, das Jagdwild zu treiben. Es genügt auch nicht, mit physischer Gewaltsamkeit mate guarding zu betreiben: der Mann muss sich vor seiner Sexualpartnerin als kooperativer Versorger qualifizieren und seine gewalttätigen Dispositionen zugunsten von Verpflichtungen innerhalb eines verwandtschaftlichen Netzwerks von Verpflichtungen zurückstutzen. Darüber hinaus wird durch die evolutionär neue Beteiligung des Mannes am parental investment in der neuartigen sozialen Rolle des Vaters auch sein Testosteronspiegel gedämpft.(Machin 2018, S. 126 ff.) Vaterschaft wirkt psychologisch und sozial befriedend. Und schließlich haben Menschen ein bewusstes Konzept von Status, dass um Gefühle von Scham und Schuld sowie um Ehrbegriffe organisiert ist.
Die zentrale Rolle von Kooperationsbeziehungen bedeutet nicht, dass Konkurrenz vollständig aufgehoben wäre. Aber solche Konkurrenz tritt nicht als Alternative zur Kooperation auf, sondern findet in einem Kontext moralischer Regeln statt, die überschießenden Egoismus und Gewaltgebrauch einschränken, damit das auf Gegenseitigkeit beruhende soziale Gefüge nicht zerstört wird. Menschliche Konkurrenz ist ursprünglich Konkurrenz unter Gleichen, die sich über ihre Konkurrenz verständigen können. Nur im Außenverhältnis der Gruppen kann der soziale Frieden prekär werden, und die ursprünglichen Verpflichtungsgleichgewichte geraten erst in dem Moment in Unordnung, in dem nacheiszeitliche Klimaveränderungen und stark wachsende Bevölkerungszahlen die Konflikte zwischen sozialen Großgruppen um Ressourcen und Lebensraum explodieren lassen. Erst jetzt tritt erstmals der Fall ein, dass Gruppen von Menschen in einer Größenordnung weit oberhalb der Dunbar-Zahl territorial koexistieren müssen, wenn sie sich nicht gegenseitig auslöschen wollen. Erst jetzt wird »Geschichte« zu jenem fortgesetzten Drama, von dem Hegel sagte, dass die Weltgeschichte nicht der Boden des Glücks sei, und die Perioden des Glücks die leeren Blätter in ihr. (Hegel 1986, S. 42)
Und schließlich definieren Menschen Status in ganz unterschiedlichen Dimensionen: zum Beispiel durch kämpferische Überlegenheit (die nicht primär von physischer Stärke, sondern vor allem von Geschicklichkeit im Waffengebrauch abhängt), durch Aspekte »ökonomischer« Leistungsfähigkeit wie handwerklichem Geschick, durch besonderes Geschick in der Redekunst oder auch durch besondere moralische oder religiöse Auszeichnung. Status organisiert sich damit entlang der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und hat schon früh Ausdruck gefunden in den unterschiedlichen Funktionen der indoeuropäischen Gesellschaftsordnung mit ihrer Dreigliederung in Krieger, Priester und Bauer bzw. Kshatriya (Krieger), Vaishya (Kaufleute, Handwerker, Bauern) und Brahma (Priester). Der Streit um den Vorrang von weltlicher oder geistlicher Statushierarchie zieht sich durch das ganze lateinische Mittelalter.
Wenn David Buss also wie oben zitiert feststellt, dass amerikanische Frauen auf angesehene Berufe und gutes Einkommen bei potentiellen männlichen Partnern achten, dann setzt das allererst die institutionelle Definition von Geschlechterbeziehungen als Kooperationsbeziehungen mit moralischen Ansprüchen auf bestimmte reziproke Verhaltensweisen voraus, und somit die ganze Millionen Jahre alte deep history, die Homo sapiens von den Menschenaffen trennt. Die Quelle von Status unter Menschenaffen ist physische Dominanz. Die ursprüngliche Quelle von Status unter Menschen ist die moralisch bewertete Fähigkeit zur Kooperation. Alle anderen Formen von Status beim Menschen sind hiervon abgeleitet.
Die evolutionspsychologische Perspektivverkürzung auf menschliche Partnerwahl unter den modernen Bedingungen einer kulturellen Emanzipation verstellt leicht den Blick darauf, dass Moral und Kultur evolutionäre Bedeutung für die Entstehung des Menschen hatten, indem sie obligate Kooperation zur Grundlage der Geschlechterbeziehungen gemacht haben. »Kultur« wird nicht erst durch Prozesse kultureller Gruppenselektion evolutionär relevant, die erst im Zeitalter zunehmender Bevölkerungsverdichtung und Gruppenkonkurrenz auftreten, sondern bereits für die biologische Evolution der Homininen selbst, indem sie aus dem größer werdenden Gehirn der Homininen ein »soziales Gehirn« macht. Dieses »soziale Gehirn« wird durch seine höhere kognitive Kapazität allein nicht hinreichend beschrieben: diese erschöpfen sich nicht einfach darin, sich eine höhere Zahl von Gesichtern merken zu können und dadurch eine höhere Gruppengröße zu ermöglichen. Sondern »Kultur« nutzt die Kapazitäten dieses Gehirns für die »Erfindung« einer Moral der Kooperativität als Ursprung menschlicher Moral schlechthin.
Es ist diese Moral, die das Soziale am »sozialen Gehirn« ausmacht, und es war diese Moral, die als der entscheidende evolutionäre Selektionsvorteil auf dem Weg zu Homo sapiens wirksam wurde. »Kultur« wurde durch Enzephalisierung nicht nur möglich, sondern sorgte dafür, dass diese Enzephalisierung evolutionär relevant wurde. Gerhard Roth hat darauf hingewiesen, dass es aufgrund anatomischer Gesetze zu einem Wachstum des Gehirns kommt, wenn die Körpergröße zunimmt und die Homininen ihr größeres Gehirn (genauer: die Großhirnrinde) sozusagen »umsonst« bekommen haben. (Roth 2003, S. 86 ff.) Es war aber Kultur, die durch die Art der Nutzung dieser neu gewonnenen Gehirnkapazität einen entscheidenden Überlebensvorteil daraus gemacht hat.
Noch einmal anders formuliert: so interessant Faktoren wie Waist-Hip-Ratio, Status und andere individuelle Merkmale sind, um Präferenzen der Partnerwahl unter den Rahmenbedingungen libertinistischer moderner Gesellschaften zu untersuchen: evolutionär entscheidend für den Prozess der Menschwerdung war das mit dem »sozialen Gehirn« entstehende moralische Verpflichtungsgefüge des obligaten alloparentalen Investments im Rahmen verwandtschaftlich strukturierter Gruppen, und das heißt: die Entstehung von Kultur.
Damit können wir abschließend noch einmal auf den Begriff der blank slate eingehen. Die These, das menschliche Gehirn und das menschliche Verhaltenssystem insgesamt sei eine »blank slate«, ein bei der Geburt unbeschriebenes Blatt, auf dass das menschliche Verhalten erst durch rein kulturelle Lernprozesse geschrieben würde, lässt sich nicht verteidigen. Daraus darf jedoch nicht andersherum ein biologischer Determinismus menschlichen Verhaltens abgeleitet werden.
Der scheinbare Widerspruch lässt sich auflösen, wenn wir zur Kenntnis nehmen, dass es »das« menschliche Verhalten ebenso wenig gibt wie »das« menschliche Gehirn. Das menschliche Gehirn ist ein anatomisch und funktionell hochgradig gegliedertes Organ. Auf der untersten funktionalen Ebene befindet sich die Regulation der vegetativen Prozesse, die darum zuverlässig funktionieren, weil sie automatisch funktionieren. Die menschliche Verdauung ist nicht Gegenstand philosophischer Debatten zur Willensfreiheit. Aber bereits früh in der biologischen Evolution entstehen Organismen, die nicht mehr nur solche vegetativen Verhaltensautomaten sind.
Denn freie Verhaltens- und Entscheidungsspielräume von Organismen sind selbst eine Errungenschaft der biologischen Evolution. Bereits im Begriff der Evolutionspsychologie selbst ist impliziert, dass höhere Organismen über eine eigenständige Ebene der Verhaltensregulation verfügen, die wir als Psychologie bezeichnen. Damit gewinnen sie die Freiheit, auf nicht vorhersagbare Variationen ihrer Lebensumwelt zu reagieren. Ihr Verhalten wird flexibler, und diese Flexibilität ist selbst ein evolutionäres Fitness-Kriterium. Je unvorhersagbarer, die Umwelt, desto mehr fällt die Fähigkeit zu situationsbezogenen Entscheidungen ins Gewicht. Reptilien sind zielgerichtet, Säugetiere sind zusätzlich intentional (sie entwerfen Handlungspläne vor der Ausführung der Handlung), Menschenaffen sind zusätzlich rational (sie führen eine reflexive Kontrolle ihrer Handlungspläne durch), Menschen schließlich sind zusätzlich normativ (sie bilden kollektive Handlungsagenten). (Tomasello 2024, S. 194 ff.)
Es ist Homo sapiens, der Mensch, der unter allen Organismen dieses Planeten über die höchste Verhaltensflexibilität verfügt. Dies darum, weil er mit Prozessen sprachlicher Symbolisierung, die seine Fähigkeit zur geteilten Intentionalität und Hyperkooperativität zur Voraussetzung haben, beliebig komplexe Aussagen über die Welt formulieren und testen kann und als Folge davon diese Welt in einem präzedenzlosen Ausmaß technisch beherrscht. Auch diese Fähigkeit ist in seinem Gehirn lokalisiert, nämlich in Gestalt des Orbitofrontalkortex, dessen evolutionäre Funktion darin besteht, die Freiheitsgrade einer ausschließlich durch konventionelle Geltung gebundenen symbolischen Kommunikation zu ermöglichen.
Das heißt: in Gestalt des Orbitofrontalkortex verfügt Homo sapiens über ein »blank slate«-Modul, dessen evolutionäre Funktion darin besteht, ein unbeschriebenes Blatt zu sein. Dass das menschliche Verhaltenssystem nicht als Ganzes auf einer blank slate beruht, liegt daran, dass der Mensch nicht 24 Stunden am Tag damit beschäftigt ist, Weltherrschaftspläne zu schmieden. Er kümmert sich zudem noch um sein Essen, seine Freunde, Verwandten, Kinder und Partner. Und wäre es nicht biologisch vorgeprägt, dass er Spaß am Sex hat, dann würde er sich nicht fortpflanzen. Dann wäre es sehr schade um seine Pläne zur Weltherrschaft.
Literatur
Barkow, Jerome H.; Cosmides, Leda; Tooby, John (1992), The Adapted Mind. Evolutionary Psychology and the Generation of Culture. New York – Oxford: Oxford University Press
Buss, David M. (2016), The Evolution of Desire. Strategies of Human Mating. Revised and updated edition. New York: Basic Books
Butler, Judith (1991), Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
Chapais, Bernard (2010), Primeval Kinship. How Pair-Bonding Gave Birth to Human Society. Cambridge – London: Harvard University Press
Dux, Günter (1992), Die Spur der Macht im Verhältnis der Geschlechter. Über den Ursprung der Ungleichheit zwischen Frau und Mann. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Dux, Günter (1994), Geschlecht und Gesellschaft. Warum wir lieben. Die romantische Liebe nach dem Verlust der Welt. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Feldman, Marcus W.; Aw, Alan J.; Zeng, Tian Chen (2018), Cultural hitchhiking and competition between patrilineal kin groups explain the post-Neolithic Y-chromosome bottleneck. In: Nature Communications 9. DOI: 10.1038/s41467-018-04375-6.
Fischer, Joachim (2022), Philosophische Anthropologie. Eine Denkrichtung des 20. Jahrhunderts. 2., durchgesehene Auflage. Baden-Baden: Karl Alber
Fletcher, Garth J. O. et al. (2015), Pair-Bonding, Romantic Love, and Evolution: The Curious Case of Homo sapiens. In: Perspectives on Psychological Science 10 (1), S. 20–36. DOI: 10.1177/1745691614561683.
Gamble, Clive; Gowlett, John; Dunbar, Robin I. M. (2016), Evolution, Denken, Kultur. Das soziale Gehirn und die Entstehung des Menschlichen. Berlin – Heidelberg: Springer Spektrum
Garfinkel, Harold (2020), Studien zur Ethnomethodologie. Frankfurt a. M., New York: Campus Verlag
Geary, David C. (2010), Male, Female. The Evolution of Human Sex Differences. 2nd ed. Washington, D.C: American Psychological Association
Habermas, Jürgen (2001), Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1986), Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
Hrdy, Sarah Blaffer (2011), Mothers and Others. The Evolutionary Origins of Mutual Understanding. Cambridge: Belknap
Junker, Thomas (2008), Die Evolution des Menschen. München: C.H.Beck
Lerner, Gerda (1986), The Creation of Patriarchy. New York – Oxford: Oxford University Press
Lévi-Strauss, Claude (1977), Strukturale Anthropologie I. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
Lévi-Strauss, Claude (1993), Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
Lippold, Sebastian et al. (2014), Human paternal and maternal demographic histories: insights from high-resolution Y chromosome and mtDNA sequences. In: Investigative Genetics (http://www.investigativegenetics.com/content/5/1/13)
Machin, Anna (2018), The Life of Dad. The Making of the Modern Father. London: Simon & Schuster
Mansperger, Mark C. (1990), The precultural human mating system. In: Human Evolution (5), S. 245–259. (DOI: 10.1007/BF02437241)
Miller, Geoffrey F. (2010), Die sexuelle Evolution. Partnerwahl und die Entstehung des Geistes. Heidelberg: Spektrum
Nakahashi, Wataru; Horiuchi, Shiro (2011), Evolution of ape and human mating systems. In: Journal of Theoretical Biology, 296, S. 56–64. (DOI: 10.1016/j.jtbi.2011.11.026.)
Roth, Gerhard (2003), Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert. Neue, vollständig überarbeitete Ausgabe. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
Sikora, Martin et al. (2017), Ancient genomes show social and reproductive behavior of early Upper Paleolithic foragers. In: Science (358), S. 659–662. (https://science.sciencemag.org/content/358/6363/659)
Stoverock, Meike (2021), Female Choice. Vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation. Stuttgart: Tropen
Suhr, Dierk (2018), Das Mosaik der Menschwerdung. Vom aufrechten Gang zur Eroberung der Erde: Humanevolution im Überblick. Berlin – Heidelberg: Springer
Tomasello, Michael (2002), Die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens. Zur Evolution der Kognition. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
Tomasello, Michael (2014), A Natural History of Human Thinking. Cambridge – London: Harvard University Press
Tomasello, Michael (2016), A Natural History of Human Morality. Cambridge – London: Harvard University Press
Tomasello, Michael (2024), Die Evolution des Handelns. Von den Eidechsen zum Menschen. Berlin: Suhrkamp
West, Candace; Zimmerman, Don H. (1987), Doing Gender. In: Gender and Society 1 (2), S. 125–151

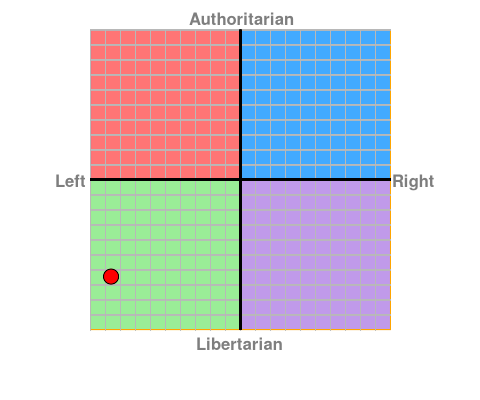
Ja, danke für diese erweiterte Rezension!
@Jochen Schmidt:
Abgesehen davon, dass ich meine Texte auf meinem Blog sammeln möchte (dürfte jetzt abgeschlossen sein), war das in der erweiterten Form eine für mich nötige Zwischenbilanz, um aus kulturanthropologischer Sicht mein Verständnis von Evolutionspsychologie glattzuziehen. Inklusive der therapeutischen Funktion eines »Alles-Evolution«-Detox, um mich nicht länger unnötig an die dort geläufigen Verzeichnungen zu binden. 🙂
»Alles-Evolution«-Detox …? Kannst Du dazu vielleicht ein paar Hinweise geben, oder Quellen nennen?
Natürlich ist nicht “alles” Evolution – aber inwiefern gibt’s da eine Notwendigkeit zur Detox-Therapie? Weil, mit dem Verweis auf die evolutionäre Entwicklung sagt man ja nicht, dass das betreffende Phänomen gut sei, oder gar alternativlos. Man sagt auch nicht, dass man es nicht irgendwie besser machen könnte oder gar müsste.
Man erklärt ja erst mal nur bestimmte Phänomene. Wenn also z. B. ein junger Kerl keine weibliche Partnerin für sich gewinnen kann, so kann es für für ihn lehrreich, vielleicht sogar hilfreich sein, wenn er über evolutionäre Strategien der Partnerwahl und Fortpflanzung etwas dazulernt. Er hat dann etwas verstanden – aber natürlich (erst mal) immer noch keine Partnerin.
Aber auf der Basis dieser Einsicht(en) kann er sich dann überlegen, ob er diese evolutionäre “Spiel” überhaupt mit- oder weiterspielen will, oder unter welchen Bedingungen er an diesem Spiel teilnehmen will.
Oder wenn man verstehen will, warum bestimmte Leute so vehement die Möglichkeit der Abtreibung ablehnen (in Deutschland wohl nicht so, aber z. B. in den USA), dann ist es doch ungemein lehrreich zu erkennen: Hierbei geht’s gar nicht um kleine Babies (oder gar Föten): Nö, es geht um “lediglich” um eine evolutionär verfestigte Fortpflanzungs-Strategie der Frauen, und den Bruch mit dieser Strategie durch Pille und radikal durch Abtreibung. Frauen, die abtreiben, sind also “Cheater”, die sich unberechtigt Vorteile bei der Partnerwahl (als Voraussetzung einer erfolgreichen Fortpflanzung und Aufzucht) verschaffen.
Ich würde also fast sagen: Wir benötigen kein Evolutions-Detox, sondern vielmehr eine “Alles Evolution”-Therapie 😉
Mit diesem »Detox« meine ich tatsächlich nur meine persönliche Arbeitsstrategie, mich aus dem Bann der Schwerpunktsetzungen von Christians Blog zu lösen. Dass die Evolutionspsychologie für bestimmte Gegenwartsprobleme (wie Du beispielhaft welche nennst) sinnvolle Antworten liefert, will ich gar nicht in Abrede stellen. Die unglücklichen Bewußtseine moderner Subjekte werden heute von den evolutionspsychologischen Beraterstäben der Pickup-Branche umlagert, die den Verwirrten zu erklären versuchen, wie Sexualität von »Mutter Natur« ursprünglich mal gemeint gewesen ist. Nachdem der Psychoanalytiker vom Amt des Seelenhirten des modernen entfremdeten Individuums abgedankt hat, ist der Evolutionspsychologe an seine Stelle getreten. Das meine ich jetzt nicht ganz so sarkastisch, wie es klingt. Und für den Einspruch gegen die Gender-Ideologie ist es allemal wichtig.
Mir ist bloß irgendwann aufgefallen, dass ich für die Fragen, die mich selber viel mehr interessieren, nämlich die Grundlagen einer soziologischen Anthropologie und der Prozess der Hominisierung, dort gar keine Antworten finde, weil das Thema konsequent im Windschatten der Gegenwartsprobleme steht. Und mir ist aufgefallen, dass der angebliche Widerspruch von Soziologie und Evolutionspsychologie, der so vielen Forendiskussionen implizit zugrunde lag, eine Engführung darstellt, die im ursprünglichen Ansatz gar nicht drin war.
Die flexible Gestaltung seiner Hand mit ihrer Fähigkeit zu Operationen wie dem »Drei-Punkte-Feingriff«, dem »Fünf-Punkte-Korbgriff« und dem »schrägen Pressgriff« (Suhr 2018, S. 153 ff.) erwies sich als Präadaption, die in einem späteren Abschnitt der Humanevolution zu einer Voraussetzung der Technologieentwicklung wurde.
Präadaption – ein sehr wichtiger Begriff, mit weitreichenden Implikationen. Ich empfehle dazu
SJ Gould, ES Vrba, 1982: “Exaptation – A Missing Term in the Science of Form”
(Präadaption und Exaptation meint dasselbe)
sowie die Arbeiten von S. Kauffmann zum “adjacent possible”, als Startpunkt siehe beispielsweise hier:
https://medium.com/@SeloSlav/what-is-the-adjacent-possible-17680e4d1198
Kauffmann ist insofern interessant, als er explizit darauf abzielt die Kluft zwischen Wissenschaft und Kultur zu überwinden – also genau das Problem, an dem die reduktionistischen Ansätze der Evolutionspsychologie oder des Feminismus kranken.
Danke, ich schaue mir die beiden Verweise mal an! Insbesondere Kauffmann scheint mir von allgemeinem kosmologischen Interesse zu sein. Den Selbstorganisationsgedanken hatte in den 80er Jahren Ilya Prigozhin ausgeführt, Kauffmann scheint ungefähr in diese Richtung zu gehen.
Kauffmann setzt Selbstorganisation sozusagen als gegebenes Phänomen, und beschäftigt sich mit den Auswirkungen und Implikationen davon. Speziell im Kontext Evolution und Entwicklung von komplexen Lebensformen. Ich finde seine Gedanken eine sehr erfrischende Ergänzung zu den üblichen Evo-Psych Theorien, deren Mängel du ja in deinem Artikel ausführlich beleuchtet hast.
Viele der typischen Evo-Psych “Erklärungen” sind gar keine solchen. Es läuft i.d.R. auf eine tautologisches “dieses und jenes ist so, weil es sich evolutionär so entwickelt hat – und wir wissen, dass es sich evolutionär so entwickelt hat, weil dieses und jenes eben so ist” hinaus. Ich finde so etwas erklärt überhaupt nichts. Es setzt an die Stelle einer Erklärung lediglich den Glaubenssatz “hat sich evolutionär entwickelt”.
Ich vermute, die Komplexität des heutigen Lebens ist in vielen Bereichen so groß (bzw. so überfordernd), dass solche scheinbar einfachen “Erklärungen” eine große Anziehungskraft ausüben. Das ist ja auch ok – solange man nicht dem Irrglauben verfällt, damit tatsächlich in einem mechanistischen Sinn etwas zu “erklären”.
In diesem Sinn finde ich viele der soziologischen Ansätze tatsächlich ehrlicher, nämlich insofern als diese wenigstens nicht der Illusion erliegen mit einer “einfachen” Theorie quasi alle Phänomene hinreichend erklären zu können. Und in diesem Sinne unterstütze ich ein “Alles-Evolution Detox” ausdrücklich. 😉
»Es läuft i.d.R. auf eine tautologisches “dieses und jenes ist so, weil es sich evolutionär so entwickelt hat – und wir wissen, dass es sich evolutionär so entwickelt hat, weil dieses und jenes eben so ist” hinaus. Ich finde so etwas erklärt überhaupt nichts. Es setzt an die Stelle einer Erklärung lediglich den Glaubenssatz “hat sich evolutionär entwickelt”.«
Ich halte das allerdings für einen bloßen Anwendungsfehler. Der besteht darin, dass man sich (abstrakt) für evolutionäre Mechanismen interessiert, aber nicht (konkret) für Naturgeschichte. Denn Naturgeschichte ist das Resultat von Evolution. Das heißt, der Glaubenssatz »hat sich evolutionär entwickelt« hört auf, ein Glaubenssatz zu sein, wenn ich zumindest einen in empirischen naturgeschichtlichen Daten begründeten Vorschlag machen kann, welche naturgeschichtliche Konstellation welche Herausforderung dargestellt hat, auf die eine Spezies dann »evolutionär erfolgreich« reagiert hat. Damit beseitigt man die Beliebigkeit des betreffenden Glaubenssatzes. Und für den Prozess der Hominisierung gibt es solche plausiblen Vorschläge. Nur findet man die paradoxerweise nicht auf Christians Blog. Weil sich dort kaum jemand für Geschichte interessiert, insbesondere auch nicht für Naturgeschichte.
»In diesem Sinn finde ich viele der soziologischen Ansätze tatsächlich ehrlicher, nämlich insofern als diese wenigstens nicht der Illusion erliegen mit einer “einfachen” Theorie quasi alle Phänomene hinreichend erklären zu können.«
Solche Tendenzen gibt es in der Soziologie freilich auch, und damit meine ich nicht nur die Gender-Theorien, sondern vor allem die weit verbreitete Neigung, überall mit ökonomischen Modellen des rationalen Nutzenmaximierers zu arbeiten. Das hat dazu geführt, dass sich »soziologische Anthropologie« üblicherweise mit der fiktiven Anthropologie des ökonomischen Menschenbilds zufrieden gibt, anstatt eine empirische Anthropologie zugrunde zu legen. Diese Lücke hat, wie mir scheint, auch das Vordringen der Gendertheorien begünstigt, weil es dadurch in den Sozialwissenschaften keinen nennenswerten anthropologischen Widerstand dagegen gab. Sogar ein (kultur)anthropologisch ausgebildeter Soziologe wie Pierre Bourdieu hatte hier nicht den wünschenswerten Weitblick.
Von daher halte ich eine »recht verstandene« Evolutionspsychologie, die darauf verzichtet, »Kultur« und »Biologie« gegeneinander auszuspielen, für ein unverzichtbares Fundament der Sozialwissenschaften. Das heißt, das »Detox« ist für mich weiterhin keine allgemeine Empfehlung, sondern strikt persönlich gemeint. 🙂
Ich denke es ist nicht bloß ein Anwendungsfehler, das Problem geht tiefer. Es besteht darin, dass unter Rückgriff auf evolutionäre “Mechanismen” versucht wird Verhalten zu erklären, siehe beispielsweise Jochens Post weiter oben. Dabei wird aus den grundsätzlich guten Ideen Evolution und Genetik grauenhaft extrapoliert: Es sind deine Gene (dein Charakter) die reflektieren bzw bestimmen wie du dich verhältst, nicht so sehr deine konkrete Situation und die Umstände und Möglichkeiten die sich dir bieten. Insofern finde ich den Hinweis auf konkrete Naturgeschichte richtig und wichtig.
Ich denke die Idee, dass die Evolution unser Verhalten “optimiert” hat – nur halt auf andere Umstände als die, die wir heute vorfinden – wird in der Bedeutungslosigkeit versinken, wenn sie mit sorgfältigen Experimenten konfrontiert wird. Unser Verhalten scheint viel adaptiver und anpassungsfähiger zu sein, und weniger durch die Evolution optimiert. Es scheint offensichtlich, dass sich unsere Gehirne ganz spezifisch dafür entwickelt haben, dass wir uns möglichst schnell an neue Gegebenheiten anpassen können. Weshalb der Versuch, unser (heutiges) Verhalten durch Evolution zu “erklären”, i.d.R. vorhersehbar in just-so Cocktail-Party Geschichten endet.
Deine Kritik am ökonomischen Modell des rationalen Nutzenmaximierers teile ich vollumfänglich. Die ganze expected utility theory – immerhin die Basis unserer heutigen Wirtschaftswissenschaften – ist ein ähnliches Fiasko wie die naive Evolutionspsychologie: Sie beansprucht zu erklären, wie wir Entscheidungen treffen. Und scheitert damit regelmäßig an der Wirklichkeit, wenn die Menschen sich einfach nicht so verhalten. Anstatt den ganzen Ansatz in die Tonne zu werfen, versteigen sich Ökonomen in einem Anfall von Hybris dazu, das von der Theorie abweichende Verhalten als “Irrationalität” zu deklarieren.
Hier eine erhellende Diskussion über die Probleme der heutigen Ökonomie:
https://www.thegreatsimplification.com/episode/rr03-erickson-farley-raworth-keen
Ein sehr interessanter Ansatz, der die Kritik an EUT explizit macht, ist ergodicity economics:
https://ergodicityeconomics.com/
Im Zusammenhang mit Evolution führt das zu Einsichten, die tatsächlich Erklärungskraft haben. Siehe beispielsweise folgende Arbeit über das Zustandekommen von Kooperation:
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2020.0425
Von daher halte ich eine »recht verstandene« Evolutionspsychologie, die darauf verzichtet, »Kultur« und »Biologie« gegeneinander auszuspielen, für ein unverzichtbares Fundament der Sozialwissenschaften.
Ja, das ist sehr schön gesagt.
»Unser Verhalten scheint viel adaptiver und anpassungsfähiger zu sein, und weniger durch die Evolution optimiert.«
Das ist nur dann ein Widerspruch, wenn man »evolutionär optimiert« mit einem genetischen Determinismus gleichsetzt (eine wiederum bei AE weit verbreitete Überzeugung). Tomasellos neuestes Buch zeigt dagegen etwas ganz anderes: die Evolution bringt selbst Handlungsagenten mit immer weitergehenden Handlungsfreiheiten hervor, weil solche nicht festgelegten Handlungsfreiheiten ihrerseits Adaptionsvorteile darstellen. Damit bekommt der Begriff der Evolutionspsychologie seinen (wie ich finde) eigentlichen Sinn: »Psychologie« ist der Name für interne Feedbacksteuerungssysteme eines Organismus, für einen Bereich nicht automatisch festgelegten Verhaltens, der über eine biologische Festverdrahtung von Verhaltensmustern hinausgeht. »Evolutionspsychologie« ist somit nur dann überhaupt ein sinnvoller Begriff, wenn ich bereits Psychologie (und nicht erst Soziologie) von Biologie kategorial unterscheide. Damit erledigt sich die Annahme, es gäbe irgendeinen direkten Durchgriff vom Genom auf das Verhalten, von selbst.
Für Tomasello beginnt eine so verstandene Psychologie bereits mit den Landlebewesen, das heißt: den Echsen, und setzt sich über die Säugetiere, Menschenaffen und Menschen fort.
»Es scheint offensichtlich, dass sich unsere Gehirne ganz spezifisch dafür entwickelt haben, dass wir uns möglichst schnell an neue Gegebenheiten anpassen können.«
Genau darum geht es, und die Pointe ist, dass auch das ein Resultat »evolutionärer Optimierung« ist. Aber dazu muss man Annahmen eines genetischen Verhaltensdeterminismus über Bord werfen. Ein solcher gilt nur für Lebewesen weit unten in der naturgeschichtlichen Entwicklungsreihe. Aus demselben Grund ist es auch irreführend, vom Gehirn im Singular zu sprechen, wie in »das menschliche Gehirn«. Das Gehirn ist massiv modular aufgebaut, und die Naturgeschichte ist in der funktionellen Gliederung des Gehirns zwischen Kleinhirn und Orbitofrontalkortex gleichsam abgebildet.
Die ökonomischen Themen knöpfe ich mir vor, sobald ich Zeit für Flassbecks »Grundlagen einer relevanten Ökonomik« finde.
Off topic:
Eine weitere Verschwörungs-Theorie hat sich der Wahrheit bemächtigt – how dare you.
A top Dutch government official has admitted that the Covid was a “military operation” and revealed that her nation was taking orders from the North Atlantic Treaty Organization (NATO) during the pandemic. Dutch Health Minister Fleur Agema has revealed that the “military operation” was led by NATO and the Netherlands’ National Coordinator for Security and Counterterrorism (NCTV).
During a speech in the Dutch parliament, Fleur Agema acknowledged that the Dutch pandemic policy is taking place “under the direction of National Coordinator for Security and Counterterrorism (NCTV) and Defense.” She noted that the government responded to the pandemic by complying with “NATO obligations.” In doing so, she confirmed the pandemic policy was a “coup d’état” by the NCTV.
Quelle:
https://slaynews.com/news/dutch-government-official-admits-covid-pandemic-military-operation-ministry-health-obeys-nato/
https://x.com/Slay_News_/status/1855300088236536115
Von Frank Bergman gibt’s noch andere gute Artikel:
https://slaynews.com/author/frank-bergman/
Kleiner Nachtrag:
https://www.globalresearch.ca/new-dutch-health-minister-fleur-agema-nato-obligations/5872252
https://debbielerman.substack.com/p/in-holland-and-germany-pandemic-response
Hast Du’s mitgekriegt? Boris Johnson im Rundfunk:
“Let’s face it: We’re waging a proxy war [in Ukraine], but we’re not giving our proxies the ability to do the job. For years now, we’ve been allowing them to fight with one hand tied behind their backs and it has been cruel.”
https://www.telegraph.co.uk/news/2024/11/28/uk-troops-should-help-defend-ukraine-border-in-ceasefire/
https://youtu.be/01DdfMqP4-g?t=1672
@Jochen Schmidt:
Ja, ich habe mir den Youtube-Clip auch gleich heruntergeladen. Faszinierend, wie die Masken von den Gesichtern fallen wie die Blätter von den Bäumen! Vielen Dank für den Link zu Fleur Agema! Das fällt ja in dieselbe Kategorie. Ich bin inzwischen überzeugt, dass man die Geschichte der letzten dreißig Jahre nach dem Prinzip verstehen kann (frei nach Arthur C. Clarke): »Oligarchie, die weit genug fortgeschritten ist, ist von Verschwörung nicht zu unterscheiden!«
Die Frage ist nur noch, wie diese Verschwörung westlicher Finanz- und Industrieoligarchen im Zusammenhang mit dem politischen Deep State im Einzelnen konstruiert (gewesen) ist. Thomas Röper hat da mit seinem »Inside Corona« schon einen wichtigen Baustein geliefert. Aber der rote Faden scheint mir klar: »Verschwörung« ist das, was man erwartbar bekommt, wenn man der politischen Theorie des Neoliberalismus mit ihrer Heiligsprechung »der Märkte« und »des freien Unternehmertums« freie Bahn lässt: dann reduziert sich der Staat zum exekutiven Wurmfortsatz von Big Money, Big Data und in Zukunft von Big Pharma.
Diese Verhältnisse haben auch einen Vorteil: sie sind so klar ersichtlich, dass es »nur noch« darauf ankommt, sie sauber zusammenzufassen, um eine politische Kritische Masse zu bilden.
»Verschwörung« ist das, was man erwartbar bekommt, wenn man der politischen Theorie des Neoliberalismus mit ihrer Heiligsprechung »der Märkte« und »des freien Unternehmertums«
Ja, nee, das ist aber nun wirklich eine Verschwörungs-Theorie 😉
“… , dass es »nur noch« darauf ankommt, …”
Aber Du weißt schon: Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis GRÖßER als in der Theorie :-))
Wie kommst Du eigentlich mit Deinem neuen Buch so voran?
Oh, mit dem Buch bin ich fleißig zugange! (Tatsächlich hänge ich den größten Teil meiner Freizeit da rein.) Das Anthropologie-Kapitel ist so gut wie fertig, und der Übergang zur Hegel-Interpretation sowie mein roter Faden durch Hegel ist mir inzwischen klar. Und wenn ich über den philosophischen Berg mal drüber bin, wird der historische Teil eine vergleichsweise bequeme Talfahrt. Die beginne ich hoffentlich nicht später als zum nächsten Frühjahr, und dann rechne ich noch mit einem halben Jahr Fleißarbeit. Also bis zur nächsten Frankfurter Buchmesse könnte es klappen! 😀
“Senator, I believe if you can defeat a strategic adversary and not use any U.S. troops, you are at the acme of professionalism, because letting the Ukrainians defeat that, it takes a strategic adversary off the table and then we can focus what we should be focusing against our primary adversary, which is China at this time.”
Lieutenant General Keith Kellogg (Co-Chair of the Center for American Security at the American Foreign Policy Institute) at:
COMMITTEE ON ARMED SERVICES UNITED STATES SENATE HEARING TO RECEIVE TESTIMONY ON THE CONFLICT IN UKRAINE,
Tuesday, February 28, 2023, Washington, D.C.
800.FOR.DEPO (800.367.3376)
https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/23-03_02-28-20231.pdf
Yesterday’s conspiracy theory, today’s congressional report:
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/12/12.04.2024-SSCP-FINAL-REPORT.pdf
Ah … nothing to see here! Disperse …!
Der Beweis: Seit 2020 hat die sogen. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) des U.S. Department of Homeland Security (DHS) folgendes getan:
– Manipulation der Öffentlichkeit
– Überwachung der Öffentlichkeit
– Zensur der Öffentlichkeit
– Begrenzung und Eindämmung der Öffentlichkeit (e.g., “demonetization and de-platforming of individual Americans to monitor and target constitutionally protected speech by American citizens”).
Quelle:
https://aflegal.org/america-first-legals-lawsuit-against-cisa-further-exposes-deep-state-reliance-on-the-censorship-industrial-complex-to-monitor-social-media-narratives-on-covid-19/
DHS-1255-003711 06/26/2024
https://media.aflegal.org/wp-content/uploads/2024/12/19115013/COVID-19-CFITF-Reporting-and-Analysis-AFL.pdf