15. April 2018
Mit dem nachstehenden Blogpost möchte ich auf die von Forent und Mit-Blogger Jonas formulierten Einwände gegen meine Zurückweisung des Patriarchatsbegriffs im voranstehenden Blogpost antworten. Ich steige direkt in die Argumentation ein und schicke nur eine Bemerkung vorweg: wenn ich von Macht und Herrschaft rede, lege ich die Weberschen Definitionen zugrunde, weil sie minimalistisch genug sind, um universell angewendet zu werden: Macht ist die Chance, seinen Willen auch gegen Widerstand durchzusetzen, Herrschaft ist die Chance, für einen Befehl Gehorsam zu finden, legitime Herrschaft ist der Glaube der Herrschaftsunterworfenen an die Rechtmäßigkeit der Herrschaft.
Kommunikative Gleichrangigkeit
Nähern wir uns allmählich dem historischen Augenblick, an dem ein Begriff des Patriarchats überhaupt erstmals irgendeinen Sinn machen könnte. Am Anfang haben wir die »kulturelle Null-Lage«: einen biologisch-anthropologisch in seinen geistigen Kapazitäten »ausentwickelten« Homo sapiens, der über eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und einen evolutionspsychologisch beschreibbaren Satz von geschlechtstypischen, aber nicht strikt geschlechtsspezifischen Verhaltensdispositionen verfügt, die zu dieser ursprünglichen Arbeitsteilung »passen«. Er lebt in nichtsesshaften Kleingruppen, stammt aus Afrika und erschließt sich nach dem jüngeren von mutmaßlich zwei Out-of-Africa-Events und einer »mitochondrialen Eva« aufgrund seiner kulturellen Anpassungsfähigkeit sukzessive die meisten ökologischen Zonen unseres Planeten, während er andere Frühmenschen wie den Neandertaler dabei verdrängt.
Die ursprüngliche Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern hat mit irgendeinem »Patriarchat« nichts zu tun: sie ist funktionell geboten und evolutionär erfolgreich und legt Männer sozialräumlich auf den »Perimeter« und die »Exosphäre« der Gruppe fest, Frauen auf die Endosphäre und den räumlichen Nahbereich der Gruppe. Sie beruht zudem darauf, dass um der erfolgreichen Fortpflanzung willen Frauen zu schützen und Männer »disposable« sind. Diese Kleingruppen beruhen auf Kommunikationsbeziehungen im sozialen Nahbereich, in denen sich Funktionen und Kompetenzen von Männern und Frauen wechselseitig ergänzen. Teil dieser Konstellation sind die intimen Beziehungen zwischen den Geschlechtern. Das Geschlechterverhältnis beruht einerseits auf ererbten Mechanismen der sexuellen Attraktion, ist aber andererseits zugleich als Kommunikationsverhältnis Teil der Kultur: es gehört zum Kern einer Sicherung personaler Identität durch »Resonanz und kommunikative Bestätigung«. (Dux 1994, S. 157) Sowohl Männer als auch Frauen reorganisieren in ihren erwachsenen Intimbeziehungen ihre Kindheitserfahrung, (zunächst) von Müttern aufgezogen worden zu sein. Sofern es dabei nicht zu pathologischen Fehlentwicklungen kommt, besteht kein Anlass, vom Prinzip eines kommunikativen Grundvertrauens in den Partner abzuweichen, weshalb die spätere Partnerin »von innen her«, über die reaktivierte intime Vertrautheit, Zugang zur Emotionalität des Mannes und darauf beruhend Einfluss behält.
Das ist darum wichtig, weil auf diese Weise die primären Kommunikationsbeziehungen unbeschadet anderer Asymmetrien grundsätzlich auf die Gegenseitigkeit von Partnern angelegt bleiben. Ein historisch spätes und seltenes, aber sehr markantes Beispiel ist die Geschichte von Roxolane (Hürrem Sultan), der vierten Frau Sultan Süleymans des Prächtigen (1494-1566), die sich einen kometenhaften Aufstieg von einer russischstämmigen Sklavin zur Hauptfrau des Sultans erkämpfte, den sie neben ihrer Attraktivität vor allem ihrer Intelligenz verdankte, die sie zu einer gleichwertigen Kommunikationspartnerin und Beraterin Süleymans selbst in Staatsangelegenheiten machte (wer die Story als Historienschmonzette mag, kann sich auch die Serie »Das prächtige Jahrhundert« anschauen). Solche Konstellationen unter Randbedingungen, die »eigentlich« ein Inbegriff »patriarchaler Verhältnisse« sind, wären prinzipiell undenkbar, wenn die Kommunikationsbeziehungen intimer Vertrautheit zwischen den Geschlechtern nicht grundsätzlich auf Gleichrangigkeit ausgelegt wären. Oder, etwas genereller formuliert:
»Es war zu allen Zeiten der Geschichte so. Immer haben die Geschlechter sich verbunden, immer hat es Liebe zwischen Mann und Frau gegeben.«
Dux 1994, S. 158
Der familiale Kern der Gesellschaft
Günter Dux, dessen Argumentation ich hier folge, sieht eine familiale Organisation der Geschlechtergemeinschaft als universelles Merkmal der menschlichen Kultur an:
»Für die rezenten Jäger-Sammler-Gesellschaften ist die Universalität der familialen Organisation erwiesen; für die historischen Gesellschaften des Paläolithikums sind wir darauf beschränkt, sie rekonstruktiv einsichtig zu machen: Die Bedingungen, unter denen sie sich gebildet haben, waren derart, daß sich gleiche soziale Organisationseinheiten ausbilden mußten. Die Gleichheit der Bedingungen berechtigt uns, auf ihre Strukturkonformität mit den uns bekannten Jäger-Sammler-Gesellschaften zu schließen. Ganz generell können wir deshalb feststellen: In allen Gesellschaften findet sich die Familie als Grundstock der gesellschaftlichen Organisation, und zwar immer mit jenem Kern, den wir auch aus unserer Gesellschaft kennen, der filiativen Dyade von Mutter und Kind, der konjugalen der Heiratspartner und der Beziehung zwischen dem Mann und den Kindern der Frau.«
Dux 1994, S. 164 f.
Dux ist sich dessen bewusst, dass diese These von der Universalität der Familie als Behauptung der Universalität einer speziellen Familienform missverständlich ist und in der wissenschaftlichen Diskussion auch missverstanden wurde, weshalb er ergänzt:
»Allein, so richtig … es ist, darauf hinzuweisen, daß die Kernfamilie unserer Tage nicht als familiale Regelform auch für frühere Epochen und andere Gesellschaften angesehen werden kann, Murdock hatte mit der Definition ›nuclear family‹ etwas anderes im Sinn. Nur das ist gemeint: In allen Gesellschaften hat sich eine familiale Organisationsform entwickelt, die einen harten Kern kennt, um den herum sich die Gesamtorganisation formiert hat. In allen Gesellschaften kommt diesem Kern auch eine besondere Bedeutung zu. Dieser Kern wird aus den konjugalen und filiativen Beziehungen gebildet.«
Dux 1994, S. 167
Die Familie ist zudem – gerade unter Bedingungen der Sesshaftigkeit – die fundamentale ökonomische Einheit, wie Klaus E. Müller in seiner ethnologischen Synopse der Siedlungsgemeinschaft darlegt:
»Familien stellen zwar nicht vollends autarke, aber doch weitgehend selbständige ökonomische Einheiten dar. Ihre Basis bildet die Kooperation. Alle Mitglieder, bis auf die Kleinkinder, arbeiteten je nach Erfahrung, Fertigkeit, Wissen und Kompetenz einander zu. (…) In den Aufgabenbereich der Senioren … fielen Organisation und Kontrolle, die Aufsicht über die Vorräte, den Güter- und Besitzstand und die Pflege der religiösen Verpflichtungen, das heißt in der Hauptsache des familiären Ahnendienstes. Aber alle teilten das gemeinsam Erwirtschaftete, wenn auch in gewissen Abstufungen nach Geschlecht, Alter und Status. Denn nur geschlossen, im kooperativen Verbund, konnten alle bestehen.«
Müller 2010, S. 87 f.
Wie wenig eine solche Organisationsform Männer »privilegiert«, zeigt eine Beobachtung von Claude Lévi-Strauss, von der er in den »Elementaren Strukturen der Verwandtschaft« berichtet:
»Vor allem auf den primitivsten Stufen, wo die Härte der geographischen Umwelt und der rudimentäre Stand der Techniken sowohl die Jagd wie den Gartenbau und das Sammeln zu einem Wagnis machen, wäre das Dasein für ein auf sich selbst gestelltes Individuum fast unmöglich. Einen der stärksten Eindrücke meiner ersten Felderfahrungen hinterließ mir ein junger Mann in einem Eingeborenendorf Zentralbrasiliens, der mit düsterer Miene, ungepflegt, schrecklich abgemagert und, wie es schien, im Zustand völliger Verwahrlosung stundenlang in der Ecke einer Hütte kauerte. Ich habe ihn mehrere Tage beobachtet: er ging selten hinaus, außer, um allein zu jagen, und wenn um die Feuerstellen die Familienmahlzeiten begannen, hätte er die meiste Zeit fasten müssen, wenn nicht eine Verwandte von Zeit zu Zeit ein bißchen Nahrung neben ihn gestellt hätte, die er stumm verzehrte. Als ich, von diesem ungewöhnlichen Schicksal verwirrt, schließlich fragte, wer dieser Mensch sei, bei dem wir irgendeine schwere Krankheit vermuteten, lachte man mich aus und sagte: ›Das ist ein Junggeselle‹; tatsächlich war das der einzige Grund für diesen offensichtlichen Fluch. Diese Erfahrung haben wir seither noch häufig gemacht. Der klägliche Junggeselle, der nichts zu essen hat, wenn sich die Mahlzeit nach einer erfolglosen Jagd- oder Fischfangexpedition auf die Früchte des Sammelns und zuweilen des Gartenbaus, beides weibliche Tätigkeiten, beschränkt, ist ein charakteristisches Bild der Eingeborenengesellschaft. Aber nicht nur das unmittelbare Opfer befindet sich in einer unerträglichen Situation: seine Verwandten oder Freunde, von denen in solchen Fällen sein Überleben abhängt, ertragen seine stumme Furcht mit Mißmut; denn jede Familie kann mit den vereinten Anstrengungen des Ehemanns und seiner Frau oft gerade so viel erzeugen, um nicht zu verhungern. Ohne Übertreibung darf man also sagen, daß die Ehe in diesen Gesellschaften für jedes Individuum von doppeltem Interesse ist: nicht nur für sich selbst eine Gattin zu finden, sondern auch seiner Gruppe jene beiden Übel der primitiven Gesellschaft zu ersparen: den Junggesellen und das Waisenkind.«
Lévi-Strauss 1993: 90 f.
Lévi-Strauss zitiert auch Aussagen über die Vorstellungen der Mandäer, einer orientalischen religiösen Gemeinschaft, die auf den spätantiken Manichäismus zurückgeht, sowie der Navaho:
»›Für einen Mann, der keine Frau hat, gibt es kein Paradies im Himmel und kein Paradies auf Erden … Wäre die Frau nicht geschaffen worden, dann gäbe es weder Sonne noch Mond, keine Landwirtschaft und kein Feuer.‹ Wie die Ostjuden und die alten Babylonier halten auch die Mandäer das Zölibat für eine Sünde. Die Junggesellen beiderlei Geschlechts (insbesondere Mönche und Nonnen) sind den Machenschaften der Dämonen schutzlos ausgeliefert; aus ihnen entstehen die bösen Geister, welche die Menschheit heimsuchen. Die Navaho-Indianer teilen diese Theorie: sogar in den drei ersten der vier unteren Welten bestehen noch die Teilung der Geschlechter und ihrer Beziehungen, so schwer fällt es den Eingeborenen, sich eine Form des Daseins vorzustellen, und sei es die niedrigste und erbärmlichste, die diese Wohltaten nicht besäße. Nur in der vierten Welt sind die Geschlechter getrennt, und die Ungeheuer sind die Frucht der Masturbation, zu der jedes Geschlecht genötigt ist.«
Lévi-Strauss 1993: 92
Die neolithische Revolution und der Patrimonialstaat
Bis an die Schwelle der neolithischen Revolution, also der Erfindung oder Entdeckung von Ackerbau und Viehzucht haben wir keinen Anlass, in dieser komplementären Asymmetrie der Geschlechtergemeinschaft und den familialen Verbänden so etwas wie eine patriarchale Ordnung zu sehen. Die neolithische Revolution selbst führt dann zu mehreren weitreichenden Veränderungen: (a) einer Bevölkerungszunahme aufgrund der veränderten Ernährungsgrundlage, (b) einer Bevölkerungsverdichtung aufgrund der durch die nacheiszeitliche Warmphase bedingten Schrumpfung für die agrarische Produktionsweise geeigneter Siedlungsräume, (c) einer Zunahme gesellschaftlicher Reichtümer durch technologische Fortschritte und Ausdifferenzierung einer gesellschaftlichen Arbeitsteilung mit (u.a.) spezialisiertem Handwerk und (d) einer konflikthaften Zuspitzung des Regelungsbedarfs am »Perimeter« und in der »Exosphäre«, welche die der männlichen Rolle zugeordneten Problemlösungsstrategien zu einer grundsätzlichen Weiterentwicklung zwingen. Erst jetzt kommt es zu einem zunehmenden Zwangscharakter sozialer Beziehungen, d. h. der Entstehung von Herrschaftsverhältnissen, weil unterschiedlicher Erfolg unter den Bedingungen der neuen Produktivkräfte zu einer sozialen Schichtung mit stark differentiellen Machtchancen führt, die ökonomische und politische Abhängigkeits- und Ausbeutungsbeziehungen ermöglichen, es entsteht also ein starker Begriff von Besitz und Eigentum und im Zuge dessen auch ein erhöhter Bedarf an Vererbungsstrategien, mit denen der Erfolg der eigenen Lineage über die Generationenfolge hinweg zu sichern versucht wird. Darüber hinaus muss mit dem aus der Bevölkerungszunahme und -verdichtung hervorgehenden Konfliktpotentialen umgegangen werden, was zu explizit normierten und sanktionierten Vorstellungen gesellschaftlicher Ordnung führt. Die Kombination von strafrechtlicher Sanktionierung sozialen Verhaltens und systematischer strategischer Ausrichtung der einem familialen Verband zur Verfügung stehenden Machtmittel schlägt auch auf die Binnenordnung dieser familialen Verbände durch und führt zu einer strikteren Reglementierung auch weiblichen Verhaltens.
Diese striktere Ordnung des Verwandtschaftsverbandes und der Geschlechtergemeinschaft kann man (sofern sie tatsächlich patrilinear und patrilateral organisiert ist und nicht zu den bedeutenden Ausnahmen wie z. B. der irokesischen Gesellschaft zählt) sinnvollerweise als »patriarchale Herrschaft« bezeichnen – aber welcher Sinn sollte darin liegen, den Begriff auf die Idee einer patriarchalen Gesellschaft hin zu erweitern? Denn die patriarchalen Strukturen des Verwandtschaftsverbandes entstehen in einer Epoche, in der die Gesellschaften durch historisch neuartige, über Verwandtschaftsverhältnisse hinausweisende Integrationsmechanismen geordnet werden: explizite staatliche Ordnung und politische Macht in solchen Gesellschaften, die unterhalb der Schwelle staatlicher Organisation verharren. Und sie entstehen innerhalb dieser Epoche auch nicht zwangsläufig. Der zentrale Ordnungsbegriff der altägyptischen Zivilisation beispielsweise, »Ma’at«, enthält abgesehen davon, dass er als Göttin symbolisiert wird, auch keinerlei patriarchale Konnotationen. Einerseits ist der Begriff auf den König ausgerichtet:
»Der König ist das Sinnzentrum des Landes, bei ihm liegt alle Initiative, alles Handeln geschieht auf seinen Befehl hin und findet in seiner Anerkennung sein Ziel. Man sagt und tut die Ma’at, weil der König sie liebt – das heißt nichts anderes als: Die Ma’at ist der Wille des Königs.«
Assmann 2001, S. 54 f.
Aber der König selbst ist irdischer Repräsentant eines Kosmos, in dem es nicht auf die Herrschaft eines Gottvaters ankommt, sondern dessen Pantheon in männlich-weiblichen Dualitäten ausbalanciert ist, während die Ma’at selbst den Gedanken einer sozialen Gerechtigkeit verkörpert, eines solidarischen Handelns der Menschen füreinander:
»Der zur Ma’at erzogene Mensch weiß sich für sein Tun und Reden verantwortlich; daher ist er des Vertrauens der anderen würdig. Er hat ein ›geduldiges Herz‹, das sich dem Anderen zuwendet, zuhören, zu warten und, vor allem, zu verzeihen vermag, in seinem Tun und Reden alles vermeidet, was den mitmenschlichen Zusammenhang zu stören vermag und alles dafür tut, ihn aufrechtzuerhalten.«
Assmann 2001, S. 91
Aber für entscheidend halte ich einen anderen Punkt: die Integrationsmechanismen der Gesellschaft, die eine Vielzahl lokaler Gemeinschaften zusammenfasst, welche nicht mehr durch Beziehungen direkter Interaktion untereinander, sondern über Mechanismen der Stellvertretung und der Repräsentation zusammengehalten werden, weisen prinzipiell über Herrschaftsverhältnisse hinaus, die auf der direkten Interaktion eines »Patriarchen« mit den Angehörigen seines Haushaltes beruhen. »Patriarchale Herrschaft« im Sinne eines Autoritätsvorrangs von Männern über Frauen ist an die direkte Interaktion innerhalb eines Verwandtschaftsverbandes gebunden. Man beachte auch die Begrenzung der Herrschaftsgewalt durch Fürsorgepflicht und Interessenwahrung der Herrschaftsunterworfenen, die zumindest in der Weberschen Definition damit verbunden ist:
»Patriarchalismus heißt der Zustand, daß innerhalb eines, meist, primär ökonomischen und familialen (Haus-)Verbandes ein (normalerweise) nach fester Erbregel bestimmter Einzelner die Herrschaft ausübt. Entscheidend ist dabei: daß diese Herrschaft zwar traditionales Eigenrecht des Herren sei, aber material als präeminentes Genossenrecht, daher in ihrem, der Genossen, Interesse ausgeübt werden müsse, ihm also nicht frei appropriiert sei. Das, bei diesen Typen, völlige Fehlen eines rein persönlichen (›patrimonialen‹) Verwaltungsstabs des Herren ist dafür bestimmend. Der Herr ist daher von dem Gehorchenwollen der Genossen noch weitgehend abhängig, da er keinen ›Stab‹ hat. Die Genossen sind daher noch ›Genossen‹, und noch nicht: ›Untertanen‹.«
Weber 2014, S. 165
Die darüber hinausgehende Form der Herrschaft bezeichnet Weber als »Patrimonialismus«:
»Mit dem Entstehen eines rein persönlichen Verwaltungs- (und: Militär-)Stabes des Herren neigt jede traditionale Herrschaft zum Patrimonialismus und im Höchstmaß der Herrengewalt: zum Sultanismus: die ›Genossen‹ werden nun erst zu ›Untertanen‹, das bis dahin als präeminentes Genossenrecht gedeutete Recht des Herren zu seinem Eigenrecht, ihm (prinzipiell) gleicher Art appropriiert wie irgendein Besitzobjekt beliebigen Charakters, verwertbar (verkäuflich, verpfändbar, erbteilbar) prinzipiell wie irgendeine wirtschaftliche Chance. Äußerlich stützt sich patrimoniale Herrengewalt auf (oft: gebrandmarkte) Sklaven- oder Kolonen- oder gepreßte Untertanen- oder – um die Interessengemeinschaft gegenüber den letzteren möglichst unlöslich zu machen – Sold-Leibwachen und -Heere (patrimoniale Heere). Kraft dieser Gewalt erweitert der Herr das Ausmaß der traditionsfreien Willkür, Gunst und Gnade auf Kosten der patriarchalen und gerontokratischen Traditionsgebundenheit. Patrimoniale Herrschaft soll jede primär traditional orientierte, aber kraft vollen Eigenrechts ausgeübte, sultanistische eine in der Art ihrer Verwaltung sich primär in der Sphäre freier traditionsungebundener Willkür bewegende Patrimonialherrschaft heißen. Der Unterschied ist durchaus fließend. Vom primären Patriarchalismus scheidet beide, auch den Sultanismus, die Existenz des persönlichen Verwaltungsstabs.«
Weber 2014, S. 165
Das, was Weber »patrimoniale« Herrschaft nennt, führt somit eine Innovation ein: den polizeilichen bzw. militärischen »Erzwingungsstab«, also Truppen, die einen Herrschaftswillen allein durch ihr Gewaltpotential – als Drohung oder im tatsächlichen Gebrauch – stellvertretend für den Herrscher durchsetzen, ohne dass dieser in jedem Fall persönlich anwesend sein müsste (obwohl er es auf bedeutenden Kriegszügen häufig ist). Gelingt es, dieses Gewaltpotential zu einem territorialen Gewaltmonopol auszubauen, kann daraus eine staatliche Ordnung entstehen, die über Kontexte direkter Interaktion in lokalen Gemeinschaften hinaus Bestand hat. Ein Beispiel hierfür ist die Gründung des altägyptischen Staates selbst:
»Ägypten wächst als Staat nicht allmählich aus der Vorgeschichte heraus, wie etwa die sumerischen Stadtstaaten, sondern verdankt sich einem Stiftungsakt, der in zweifacher Form, mythisch und historisch, geformt wird. In seiner mythischen Form handelt es sich um den Sieg des Horus (Oberägypten) über Seth (Unterägypten) mit nachfolgender Versöhnung und Vereinigung, in seiner historischen Form handelt es sich um die Tat eines Königs ›Menes‹, der Unterägypten erobert und die ›Weißen Mauern‹, d. h. die neue Landeshauptstadt Memphis, gegründet haben soll. In jedem Falle wird der Prozeß zugespitzt auf die dramatische Herstellung von Einheit aus vorgängiger Zweiheit, und zwar durch Krieg und Versöhnung.«
Assmann 2001, S. 51 f.
Während die Ordnung des familialen Verbandes und der Geschlechtergemeinschaft ein universeller Vorgang ist, der für das Überleben primitiver Gesellschaften zwingend erforderlich ist, aber aus sich heraus keine zwingende Notwendigkeit kennt, eine patriarchale Form anzunehmen, ist die Etablierung einer patrimonialen Herrschaft ein spezieller Vorgang, der sich nur unter spezifischen historischen Bedingungen ereignet und als Kehrseite des Gewaltmonopols erstmals eine soziale Zwangsordnung etabliert, die auch auf die Familienverbände als Zwangsordnung zurückschlägt. Erst jetzt, in dem Augenblick, in dem der Horizont der Verwandtschaftseinheit und der Geschlechtergemeinschaft hin zu einem politischen und territorialen Verband überschritten wird, wirkt sich die Asymmetrie der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern auch im Sinne eines Herrschaftseffekts eines Geschlechts über das andere aus – als etwas, das sich als »Patriarchat« beobachten, sich aber nicht im analytischen Sinne als »Emanation« einer Geschlechterherrschaft fassen lässt. »Gesellschaft« lässt sich darum nicht als »patriarchal« modellieren, weil die Anforderungen, die zu ihrer Entstehung führen, dem Geschlechterverhältnis extern sind.
Der feministische Denkfehler
Damit befinde ich mich im direkten Gegensatz zu den feministischen Theorien, die an dieser Stelle die neuen Herrschaftsformen aus ihrem »Sündenfallmodell« der Männlichkeit hervorgehen lassen. Als Beispiel dafür kann die Sichtweise von Carola Meier-Seethaler stehen:
»Der Mann empfand sich ursprünglich nicht nur als Außenseiter gegenüber einer weiblich geprägten Sozietät, sondern darüber hinaus als der Außenseiter des Lebens, an dessen rekreativer Magie er nicht unmittelbar teilhatte. Umso schmerzlicher musste er die Leiden des Lebens empfinden, gegen die aufzukommen der nie erfüllten Arbeit des Sisyphos glich. (…) Aus dem Gefühl des Ausgeschlossenseins von den Mysterien des Lebens und aus dem Gefühl der Fremdheit gegenüber deren immanenter Tragik erwacht das männliche Bewusstsein: Zweifelnd und hadernd erhebt es sich über die eigene Situation und über die kreatürliche Situation als solche und stellt den Mächten der Natur und dem blinden Zufall des Schicksals seinen Kampf um Selbstbestimmung und seinen Willen nach rationaler Klärung und rationaler Kontrolle entgegen. Deshalb ist das männliche Kollektivbewusstsein von Grund auf aggressiv konstituiert, entweder im Sinne der Überkompensation eine eigenen Mangels oder im Sinne der Empörung über die Mangelhaftigkeit des Daseins.«
Meier-Seethaler 2011, S. 261 f.
Meier-Seethaler sieht diese Entwicklung durchaus ambivalent und konzediert dem »männlichen Kollektivbewusstsein« eine »aufbauende« Rolle für die menschliche Zivilisation. Auch für sie steht aber fest, dass die Entstehung eines »Patriarchats« letztlich aus der Psychodynamik des Mannes zu erklären und in einer Defizitperspektive zu bewerten ist:
»Das eigentlich Paradoxe am patriarchalen Herrschaftssystem aber ist, dass … die Emanzipation des Mannes im psychosozialen Bereich im Wesentlichen misslang. (…) Dieses zentrale Scheitern der männlichen Emanzipation … ist in seinem vollen Ausmaß vielleicht nur der psychoanalytischen Sicht zugänglich: Der Preis für die Autonomie des männlichen Bewusstseins ist die Verdrängung der Abhängigkeitsgefühle ins Unbewusste oder ihre Verschiebung ins Irrational-Romantische, und daraus folgt die emotionale Infantilität des patriarchalen Mannes und der modernen Mentalität überhaupt. Den brillanten Errungenschaften unserer rationalen Kultur steht die Unfähigkeit zur Bewältigung emotionaler Probleme gegenüber, die Hilflosigkeit angesichts psychischer Leiden, Alter und Tod und die Unfähigkeit, mitmenschliche Beziehungen offen und partnerschaftlich zu gestalten.«
Meier-Seethaler 2011, S. 265
Bis zur Karikatur grobschlächtig ist demgegenüber das Bild, das Marilyn French völlig ernst gemeint von einem sehr buchstäblich genommenen »männlichen Urputsch« zeichnet. Sie nimmt an, dass das »frühe Patriarchat« eine »völlige Umkehrung« der von ihr unterstellten, vorangehenden matrizentrischen Gesellschaftsordnung gewesen sei:
»Die Verkehrung des traditionellen Wertsystems erforderte nicht unbedingt Veränderungen der realen Lebensweise. Denkbar ist vielmehr, daß die Männer – ähnlich wie es die Frauen in den Selbsterfahrungsgruppen der sechziger Jahre taten – bei geheimen kultischen Zusammenkünften gemeinsam tradierte Denkmuster in Frage stellten. Reale Veränderungen setzten erst später ein. Als die Kulte genügend Anhänger besaßen und ausreichend gefestigt waren, den übrigen Gesellschaftsmitgliedern ihre Überzeugungen aufzuzwingen, mögen die Männer ihre größere physische Stärke als unschlagbares Argument eingesetzt haben. Dafür mußten sie jedoch davon überzeugt sein, daß sie ihr neues Selbstverständnis nur rechtfertigen konnten, indem sie sich als ›Männer‹ erwiesen und die Frauen ihrer Herrschaft unterwarfen.«
French 1988, S. 104
Das Ziel meiner Argumentation sollte klar geworden sein: »patriarchal« können Gemeinschaften erst in dem Moment werden, in dem sie eine explizite Ordnung für die Familienverhältnisse einer Gesellschaft festlegen müssen, weil aufgrund von Sesshaftigkeit und Bevölkerungszunahme ein genereller Ordnungsbedarf für das Zusammenleben entstanden ist, also seit der neolithischen Revolution. Aber diese Gesellschaften haben zugleich einen Ordnungsbedarf, der über die Ordnung von Geschlechterbeziehungen hinausgeht und aus diesen nicht abgeleitet werden kann. In diesem Sinne ist das feministische Modell des »Patriarchats« systematisch verzerrt. Hier ist die feministische Perspektive auf eine noch viel grundsätzlichere Weise traditionell als in der Übernahme der modernen Misandrie, die von Christoph Kucklick beschrieben worden ist. Denn sie übernimmt die traditionell weibliche Perspektive schlechthin. In dieser traditionell weiblichen Perspektive realisiert die Frau ihre erweiterten Interessen über den Mann – nicht, weil ein »Patriarchat« etabliert wäre, sondern weil das aus der primären Arbeitsteilung der Geschlechter hervorgeht. In primitiven Gesellschaften ist das auch unproblematisch, weil Perimeter und Exosphäre noch nicht jene Komplexität angenommen haben, die sie zum primären und privilegierten Ort des Erwerbs gesellschaftlicher Macht und Status für die familiale Zelle erhebt. Erst dieses Komplexitätswachstum führt dazu, dass die komplementäre Asymmetrie der primären Geschlechterbeziehung durch eine signifikante Chancenasymmetrie in Bezug auf den Erwerb von Status und Macht (und abgeleitet: Wohlstand) überformt wird.
Man kann das, da der Frau typischerweise der Wechsel in die Exosphäre und damit die Partizipation an diesen Chancen verwehrt bleibt, als »Patriarchat« bezeichnen, legt sich damit aber auf die Privilegierung einer bestimmten Perspektive auf das Gesamtsystem fest. Dieses Gesamtsystem besteht aufgrund des Komplexitätswachstums nicht mehr nur aus einem Nebeneinander von nach Kriterien der Verwandtschaft angeordneten familialen Zellen, sondern etabliert einen neuartigen Integrationsmechanismus, nämlich den gesamtgesellschaftlichen Status und die Herrschaft bestimmter Lineages über alle anderen, eine Entwicklung, die vielfach auf der Stufe von »Häuptlingstümern« verharrt, auf der es noch keinen expliziten Staatsbegriff gibt, aber in den sogenannten »hydraulischen Kulturen« (vor allem: Ägypten, Mesopotamien, Induskultur, China) zur Entstehung der ersten Staaten führt, die ihren herrschenden Lineages ein solches Übermaß an Charisma zuschreiben, dass es zu einer Vergöttlichung kommt (vgl. Breuer 1990) – die ersten Staaten sind »Theokratien«, die die gesellschaftliche Ordnung zu einer sakrosankten, »himmlischen« Ordnung erklären, welche durch die königliche Lineage repräsentiert und irdisch realisiert wird (im abendländischen Kontext am reinsten im Alten Ägypten umgesetzt). In der traditionell weiblichen und in der feministischen Perspektive repräsentiert der Mann das Gesamtsystem.
Der zentrale feministische Denkfehler – der in den feministischen Begriff des »Patriarchats« eingeht – besteht nun darin, nicht den Mann als Produkt der gesellschaftlichen Verhältnisse zu sehen, an die er sich (qua neuartiger Größenordnung gesellschaftlicher Komplexität) in einer Position der systematischen Überforderung und Überverantwortlichkeit mal besser, mal schlechter anzupassen versucht, sondern umgekehrt die gesellschaftlichen Verhältnisse als Emanation einer spezifisch männlichen Psyche aufzufassen, die dann üblicherweise mit psychoanalytischen Modellen erklärt wird. Die Merkmale der Gesellschaft verschwinden in der feministischen Perspektive in bzw. hinter der den angeblichen Merkmalen einer männlichen Psyche. Wie in der traditionell weiblichen Perspektive wird der Mann hier zum Stellvertreter der gesellschaftlichen Verhältnisse, und darum werden Änderungserwartungen an eine Reform dieser männlichen Psyche adressiert. Das ist in meinen Augen zugleich auch die tiefste Wurzel des geschlechtsspezifisch sortierten Täter-Opfer-Schemas. Auch solche Theorien wie James DeMeos »Saharasia«-These, die eine tiefgreifende Änderung von Umweltbedingungen zu berücksichtigen versuchen, legen sich auf einen psychoanalytisch verstandenen »Monotypus« der männlichen Psyche fest, der angeblich daraus entsteht und zur Reproduktion der Gesamtstruktur führt (bei DeMeo unter Rückgriff auf Wilhelm Reich).
Der Patriarchatsbegriff enthält und begründet somit das ganze, radikal vereinseitigte feministische Wahrnehmungsprogramm, das sich in historisch-empirischer Hinsicht als verheerend einseitige Fehlbilanzierung, um nicht zu sagen: Bilanzfälschung ausprägt. Alles, was wir seit Warren Farrell über männliche Kosten der Teilnahme am Zivilisationsprozess gelernt haben (bereits im Alten Reich führt das pharaonische Ägypten eine Wehrpflicht ein), bleibt in dieser Perspektive ausgeblendet. Der Begriff schränkt den Blickwinkel monoman auf die Wahrnehmung von »Frauenunterdrückung« ein und verstellt zudem den Blick auf die Zivilisationsgeschichte als einer Sukzession von mal mehr, mal weniger konstruktiven und erfolgreichen Lösungsversuchen für das im Neolithikum entstandene soziale Komplexitätsproblem, die am Ende unter anderem auch die Voraussetzungen für die Frauenemanzipationsbewegung selbst hervorbringen.
Erwiderung auf konkrete Einwände
Auf der Grundlage dieser Argumentation möchte ich jetzt noch auf einzelne konkrete Kritikpunkte von Jonas eingehen:
»Auch Hitlers Führerstaat folgt der traditionellen Vorstellung eines Staates als Haushalt, der einen männlichen Hausvater hat. Der gesamte Nationalismus ist von genau dieser (ursprünglich kirchlichen) Vorstellung des Staates als Hausgemeinschaft beseelt.«
Im Nationalsozialismus ist – wie auch im radikalen Islamismus – der Rückgriff auf die Tradition ein ideologisches Feigenblatt, unter dem sich der Übergang zu modernen Sozialformen versteckt. Mit patriarchaler Herrschaft hat das jenseits des Vokabulars nichts mehr zu tun, es geht um das Finden von Legitimationsgründen für die totalitäre Herrschaft über eine moderne, industrielle Massengesellschaft.
»Der Feudalismus des Mittelalters ist sowieso patriarchale politische Herrschaft in Reinform, denn hier ist das Land der Besitz eines patriarchal geführten Adelshauses.«
Die politische Herrschaft des Mittelalters ist gerade nicht das »Patriarchale« an ihr. Es trifft zu, dass vor allem die adligen Verwandtschaftsverbände intern typisch patriarchal strukturiert sind. Aber hinsichtlich der Institutionen des Königtums, Kaisertums und des Papsttums, also allen Institutionen, die den Horizont der mittelalterlichen adligen familia überschreiten, haben wir es mit sakral überformten Herrschaftsideen zu tun, die ohne das Christentum nicht zu verstehen sind, dessen Patriarchatsidee die paradoxe Form annimmt, dass sie sich tendenziell gegen das Patriarchat der Familienverbände stellt. Auch wenn die christliche Herrschaftsideologie auf die patriarchalen Formen des Alten Testaments zurückgreift, müssen wir hier zumindest festhalten, dass die primäre Funktion auch dieses »Patriarchats« nicht darin besteht, eine männliche Herrschaft über Frauen sicherzustellen, sondern eine gesellschaftliche Gesamtordnung zu definieren, in der die irdischen Formen der Herrschaft am Ende, in Gottes Heilsplan, überwunden werden sollen.
»Wie die Geschlechter moralisch gewertet werden ist hier nicht von Belang, sondern von Belang ist: Wer erbt? welcher Name wird weitergegeben? wer vertritt die Hausgemeinschaft rechtlich nach außen? zu wem zieht die Braut (oder der Bräutigam)? und ähnliche Fragen.«
Die Entstehung der modernen Gesellschaft ist natürlich ein Prozess, in dem sich die Überreste des Ancien Régimes schrittweise und nicht ohne Rückschläge und restaurative Phasen auflösen. Aber nach der Französischen Revolution sind das nur noch zum Untergang verurteilte, ephemere Oberflächenstrukturen.
»Doch können wir. Denn sie haben als gemeinsames Merkmal die patriarchale Familie und eine dementsprechende Prägung der Gesellschaft, auch wenn dieses Patriarchat sich in der Neuzeit schrittweise auflöst. Das heißt natürlich nicht, dass die gesellschaftlich Struktur immer gleich war, sondern es heißt nur, dass es ein gemeinsames Charaktermerkmal gab.«
Die Formulierung von der »dementsprechenden Prägung der Gesellschaft« ist genau die perspektivische Verzerrung, die uns der feministische Patriarchatsbegriff eingehandelt hat und die ich kritisiere. Dieses »gemeinsame Charaktermerkmal« ist eine optische Täuschung, weil es die gesamte sonstige historische Entwicklung, die sich währenddessen vollzieht, aus dem Blickfeld rückt. Die Gesellschaft ist nicht »dementsprechend« geprägt, sondern umgekehrt: der Familienverband bleibt genau so lange »patriarchal« fixiert, wie die Überdeterminierung durch das Problem der Organisation komplexer Gesellschaften nicht beendet werden kann. Der Feminismus entsteht nicht durch plötzlichen himmlischen Geistesblitz, sondern weil auf dem Weg zur modernen Gesellschaft die verhindernden Determinanten wegfallen. Darum ist die Fixierung auf die patriarchale Familienstruktur in analytischer Hinsicht entweder schädlich oder mindestens unergiebig.
»Wenn es zum Beispiel die Regel gibt, dass alle freien Männer (Familienoberhäupter) sich zum Thing, Kriegszug, Vorstandsitzung, Parlament, Symposion, Konvent, Kneipen, Ältestenrat etc pp.. treffen, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft (oder Subgesellschaft) zu entscheiden, dann ist dies eine patriarchale Gesellschaft.«
Nein. Dann ist dies nur eine Gesellschaft mit geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung, weil es in primitiven bzw. frühgeschichtlichen Gesellschaften noch gar keinen Sinn ergibt, dass Frauen sich an diesen Tätigkeiten beteiligten. Und Thing und Vorstandssitzung in demselben Satz zu nennen, halte ich für unzulässig, gerade weil es den historischen, institutionellen Entwicklungsunterschied zwischen Thing und Vorstand plattmacht. Thing und Vorstandssitzung finden nicht in demselben Typ von Gesellschaft statt, und sie über die Charakterisierung als Männergremium gleichzusetzen, ist exakt der feministische Taschenspielertrick, der keine anderen Kriterien als dieses gelten lassen will.
Ausblick
Sigmund Freud hatte von drei Kränkungen der narzisstischen Eigenliebe des Menschen gesprochen: die kosmologische Kränkung (der Mensch bzw. die Erde ist nicht Mittelpunkt des Weltalls), die biologische Kränkung (der Mensch ist aus der Tierreihe hervorgegangen) und schließlich die psychologische Kränkung: Freuds eigene Theorie des Unbewussten. Die biologische Kränkung ist heute außerhalb religiös-fundamentalistischer Kreise erfolgreich verarbeitet – mit einer Ausnahme: der Umstand, dass die Herkunft des Menschen aus dem Tierreich auch Auswirkungen auf die menschliche Geschlechtlichkeit hat, wird im Feminismus auf eine Art und Weise verdrängt, die sich der Verdrängung der Darwinschen Lehre im Kreationismus analogisieren lässt. Das betrifft nicht so sehr die unhaltbare Behauptung, die differentielle Geschlechtlichkeit des Menschen hätte deterministische Konsequenzen als vielmehr die Kränkung, die aus der Tatsache einer primordialen Asymmetrie des Geschlechterverhältnisses hervorgeht – obwohl sich eine Überlegenheit eines Geschlechts über das andere daraus nicht herleiten lässt. Kränkend ist der Umstand, dass auch der moderne, zivilisierte Mensch immer noch mit biologisch fundierten Prägungen seines Empfindens und Verhaltens rechnen muss, obwohl er prinzipiell die Möglichkeit gewonnen hat, sich reflektierend über diese zu stellen (ein Kernthema praktisch aller sogenannter »Hochreligionen« ist die ethische Überwindung der menschlichen Natur). Die feministische Verwechslung von Gleichwertigkeit und Gleichartigkeit hat meines Erachtens in dieser nicht verwundenen narzisstischen Kränkung ihre tiefste Wurzel – und welche narzisstische Kränkung hätten Feministinnen jemals verwunden?
Literatur:
- Assman, Jan (2001), Ma’at. Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten. München: C. H. Beck
- Breuer, Stefan (1990), Der archaische Staat. Zur Soziologie charismatischer Herrschaft. Berlin: Dietrich Reimer
- Dux, Günter (1994), Geschlecht und Gesellschaft. Warum wir lieben. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
- French, Marilyn (1988), Jenseits der Macht. Frauen, Männner und Moral. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt
- Lévi-Strauss, Claude (1993), Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
- Meier-Seethaler, Carola (2011), Ursprünge und Befreiungen. Eine dissidente Kulturtheorie. Stuttgart: opus magnum
- Müller, Klaus E. (2010), Die Siedlungsgemeinschaft. Grundriß der essentialistischen Ethnologie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Weber, Max (2014), Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie. Unvollendet 1919-1920. Studienausgabe der Max-Weber-Gesamtausgabe Band I/23. Tübingen: Mohr (Siebeck)

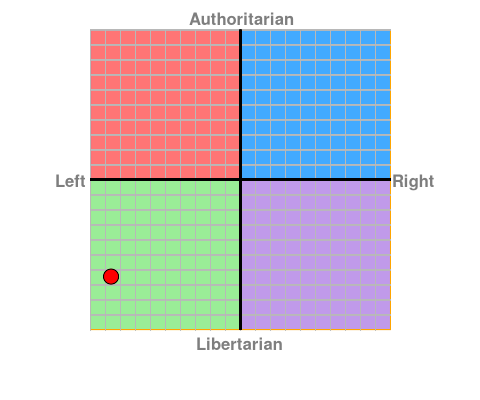
Schreibe einen Kommentar