(20. März 2015)
Meine Auseinandersetzung mit Carol Pateman zieht sich in die Länge, weil sie mit intensiver Text- und Quellenarbeit verbunden ist, und ich werde sie vermutlich aufschieben, bis ich mit meinen sonstigen Arbeiten beim Thema der modernen Gesellschaft angekommen bin. Damit ich mich aber nicht schon wieder, wie beim letzten Mal, hinter dem Rock hübscher Russinnen verstecke, möchte ich Arnes vor einer Woche gestellte Frage aufgreifen, ob eine Männer nicht abwertende Gesellschaft überhaupt möglich sei:
»Ist eine Gesellschaft, die nicht auf Männer herabscheißt, überhaupt realistisch vorstellbar oder ist es eine reine Utopie? Werden wir Männerrechtler vor allem deshalb so massiv dämonisiert, weil diese von uns propagierte Utopie der menschlichen Zivilisation allzu fremd ist?«
Ich nutze dabei die Möglichkeit eines Blogs, dies im Stile einer zwanglosen Plauderei zu tun, die sich ein gewisses Maß an spekulativem und ungeschütztem Denken gestattet.
Was zunächst einmal gegen eine solche Gesellschaft spricht, ist die ursprüngliche Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. Die historische Beobachtung, dass Frauen von Männern beschützt werden, und sei es gegen ihren Willen, identifiziert ebenso ein evolutionär geprägtes Muster wie die Beobachtung, dass Männer disponibel und verheizbar sind und ihr Wert daran gemessen wird, wie weit sich ihre Arbeits- und Körperkraft in Schutz- und Versorgungsleistungen konvertieren lässt. In Zeiten, in denen der Tod leicht zu haben ist, ist auch ein Männerleben nicht viel wert, denn der Tod des Mannes steht zwischen der externen Gewalt und dem Tod der Gruppe.
Der gesellschaftliche Wert der Frau ist konstant und an ihre generelle Reproduktionsfähigkeit gebunden, der gesellschaftliche Wert des Mannes ist kontingent und von individuellen Leistungen abhängig. Der Krieger kommt besser auf dem Schild – also tot – zurück als ohne Schild, also als Feigling. Der Mann ist nicht nur dazu verurteilt, zwischen der äußeren Natur und dem Untergang der Gruppe zu stehen, sondern dazu, sich notfalls gezielt dazwischen zu werfen.
Ein Scheitern an der äußeren Natur bezahlt er mit dem eigenen Tod, und auf diese Weise mit den unerbittlichen Kausalitäten der Umwelt konfrontiert, die keine Fehler dulden, lernt er die Bedeutung des »Objektiven« kennen, mit dem er schließlich auf Gedeih oder Verderb identifiziert wird. Auch die Lösungen, die er in dieser Sphäre für die Gemeinschaft ersinnt, erfolgen auf Gedeih oder Verderb: sie sind fallibel und unsicher, aber sie sind zugleich alles, was die Gruppe als Ganze an Wissen für ein Überleben in ihrer Umwelt aufbieten kann. Das soll nicht bedeuten, dass Frauen nichts zum kollektiven Wissen beigetragen hätten – das haben sie innerhalb ihrer eigenen Sphäre durchaus getan.
Es bedeutet aber, dass der Rang des von Frauen erzeugten Wissens davon abhängig war, in vergleichsweise »ruhigem Fahrwasser« zu erfolgen, also beispielsweise in jenen Epochen, die rückwirkend zu »Matriarchaten« stilisiert wurden, weil die Gewichte zwischen den Geschlechtern tatsächlich einigermaßen ausbalanciert waren. Sobald die menschliche Geschichte endgültig in jenes dynamische Ungleichgewicht rutscht, in dem wachsende Erfolge gegen die äußere Natur laufend mit neu entstehenden Abhängigkeiten von ihr konterkariert werden, erringt die männliche Funktionsrolle jenes funktionelle Übergewicht, welches ihr irrigerweise als »Privilegierung« ausgelegt wird, weil die vorgeblich kritische Bilanz sich weigert, die männlichen Kosten zu verbuchen. Simone de Beauvoir hat grundsätzlich Recht, wenn sie die Unterscheidung von Immanenz und Transzendenz auf die Geschlechter bezieht:
»Tatsächlich verwirklicht sich der Mann, selbst wenn er sich als gegeben, passiv, den Zufällen von Sonne und Regen preisgegeben begreift, zugleich auch als Transzendenz, als Entwurf; schon bejahen sich Geist und Wille in ihm gegen die Verwirrung und Zufälligkeit des Lebens. (…) (D)ie Frau … unterhält das Leben des Stammes, indem sie ihn mit Kindern und Brot versorgt, aber das ist auch alles: sie bleibt der Immanenz verhaftet; von der Gesellschaft verkörpert sie nur den statischen, den in sich geschlossenen Aspekt, während der Mann unaufhörlich neue Funktionen übernimmt, die diese Gesellschaft nach der Seite der Natur und in bezug auf die Gesamtheit der menschlichen Gemeinschaft ausweiten; … Krieg, Jagd und Fischfang repräsentieren die Ausdehnung der Existenz, ihr Überschreiten in der Richtung auf die Welt; der Mann allein verkörpert die Transzendenz.«
Simone de Beauvoir (1951), Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, S. 80
Der Niedergang dieser zutreffenden Diagnose setzt erst in dem Moment ein, in dem die spezifischen Sphären, Kompetenzen und Neigungen von Männern und Frauen psychologistisch und intentionalistisch kurzgeschlossen werden, indem nach männlichen Minderwertigkeitskomplexen (oder gar genetischen Minderwertigkeiten) gefahndet wird, die der Mann mit der Errichtung des Patriarchats überzukompensieren versucht habe, während auf der anderen Seite ebenso psychologistisch der Voluntarismus und das subjektive Befinden der Frau, ihre »Betroffenheit«, zum Angelpunkt ihrer Emanzipation erklärt wird.
Das Überlebensdrama einer Gemeinschaft von Männern und Frauen inmitten einer übermächtigen Natur wird eingedampft auf jenes bürgerliche Ehedrama, in dem nur noch die Beziehung zwischen den Geschlechtern selbst gesehen wird und, nach seiner zivilisatorischen Entlastung, der Funktions- und Überlebensbezug der geschlechtsspezifischen Arbeit aus dem Blick gerät. Die Legenden, die der Mann über seinesgleichen erzählt, um die Brüchigkeit seiner äußeren Erfolge ertragen zu können, werden als Legenden kritisch dekonstruiert, aber die Weigerung, sie wörtlich zu nehmen, schlägt sogleich um in die Unfähigkeit, den Grund zu würdigen, aus dem sie allemal erzählt werden – das »Empowerment« befreiter Frauen ist nur zu oft ein narzisstisches, das nicht zu sehen vermag, dass Männer in ihrer klassischen Funktionsrolle mit echten Problemen konfrontiert sind, die sich auf die Logik und den Imperativ, einer Frau zu gefallen, nicht reduzieren lassen.
Und so, wie die Kostenseite der männlichen Funktionsrolle nicht verbucht wird, so verleugnet der neuere Feminismus auch den privilegierten Aspekt der weiblichen Funktionsrolle: nämlich jenem vom Leib und Geist des Mannes abgefangenen Teil des »Reichs der Notwendigkeit« nicht mit eigenem Leib und Geist ausgesetzt zu sein, es nur über die Stellvertretung des Mannes überhaupt wahrzunehmen und somit teils als Scheinproblem, teils gar als vom Manne gemachtes und ohne ihn erst gar nicht nicht bestehendes Problem denunzieren zu können.
So kann sich die Frau für die bessere Hälfte der Gesellschaft halten, während sie tatsächlich das alte, asymmetrische Gleichgewicht des Gebens und Nehmens zwischen Männern und Frauen, in welchem die Frau dem Mann gibt, weil der Mann der umgebenden Natur geben muss, durch einen systematischen Transferleistungsparasitismus ersetzt, in dem das Geben des Mannes zugleich eingefordert wird und nichts zählt, und umfassend systematisch nur eingefordert werden kann, weil es nichts zählt. An der Wurzel des neueren Feminismus liegt somit eine fundamentale Unverantwortlichkeit.
Liegt der Ausweg also in einer Rückkehr zu den alten Funktionsrollen, in denen »die Welt noch in Ordnung« war? Eine solche These würde versäumen, durch die menschliche Geschichte einen Längsschnitt zu legen. Bei aller berechtigten Skepsis gegenüber sozialutopischen Ideologien, denen man sich schon seit Calvin und Robespierre nicht mehr naiv anschließen kann (und die mithin die anthropologische Reserve des modernen Konservatismus rechtfertigt), ist doch die Negation der modernen, von innerer und äußerer Natur emanzipierten Gesellschaft durch die Nutzer von Antibiotika, Pille und Smartphones ein veritables Luxusprodukt, und ein ebensolches wäre die Vorstellung, man könne Frauen aus der Welt des Geistes, der Bildung und des selbstverantwortlichen Erwerbs in ihre alte Funktionsrolle zurückbefördern.
Und wie sieht es mit der männlichen Funktionsrolle aus? Macht der suprematistische Feminismus noch ein bis zwei Generationen Schule, so wird diese zu einem Arbeitsdrohnenstatus stalinistischer Art deklassiert, welche einen Großteil der eigenen Bevölkerung in aus dem zivilen Leben verbannte, kasernierte Zwangsarbeiter verwandelt hatte, und eine geschlechtsständische Gesellschaft hervorbringen, in dem Männer um ihrer patriarchalen Erbsünde willen das Produkt ihrer Arbeitsleistung an den privilegierten Stand der zivilisatorisch überlegenen Frauen abtreten. Und wer diese Dystopie komplett machen möchte, darf sich noch Valerie Solanas’ freiwillige Vergasungsanstalten für gebrochene Männer hinzudenken, die dann eine echte Chance auf institutionelle Realisierung haben werden.
Beantworte ich Arnes Frage also pessimistisch? Dystopien antizipieren den schlechtesten aller möglichen Fälle, um destruktive kulturelle Entwicklungen bereits in der Gegenwart kenntlich zu machen. Unsere Gesellschaft kann in dem Moment aufhören, auf Männer herabzuscheißen, in dem sie die Probleme der männlichen Funktionsrolle von den Männern selbst trennt, indem sie also, in Christoph Kucklicks Worten, herausfindet, dass Männlichkeit nicht zerstört und Weiblichkeit nicht rettet, in dem sie feststellt, dass Frauen in männlichen Funktionsrollen exakt denselben Gefahren charakterlicher Verwüstung ausgesetzt sind wie ihre männlichen Kollegen und ihnen auch mitnichten besser widerstehen. Dazu muss sie es aber fertigbringen, die Funktionsprobleme moderner Gesellschaften – etikettieren wir sie in aller Ambivalenz des Begriffs, im Guten wie im Bösen, als »kapitalistische« Probleme – als solche in den Blick zu nehmen, anstatt sich die Sicht durch moralische Kampagnen zu verstellen, die im Gewande der Aufklärung eine calvinistische Sündentheologie etablieren.
Um eine alte, fast verschüttete Denkfigur von Jürgen Habermas neu zu beleben: die Welt, in der wir leben, droht durch unzureichend verstandene und institutionell nicht eingehegte »Systemlogiken« aus den Fugen zu geraten, denen nicht mit Moral, sondern nur mit intelligenter gesellschaftlicher Feinsteuerung jenseits des überstrapazierten Gegensatzes von Markt und Staat beizukommen ist, damit sie die menschlichen »Lebenswelten« nicht sukzessive auffressen. Wie aber sollten sich menschliche Lebenswelten als verteidigungswürdig begreifen und behaupten lassen, wenn sie in ihren intimsten Grundlagen, nämlich durch den falschen Gegensatz männlicher und weiblicher Lebenswelten, blockiert und unsere zivilisatorischen Kräfte im vermeintlichen Nullsummenkampf dieser Lebenswelten gegeneinander aufgezehrt werden?
Eine Gesellschaft, die nicht mehr auf Männer herabscheißt, ist eine Gesellschaft, die begriffen hat, dass Männer und Frauen in erster Linie Verbündete sein müssen, die das gemeinsam Lebenswerte verteidigen. Heute ist es paradoxerweise das Geschäft des Feminismus, genau jenen den Männern zugeschriebenen zivilisatorischen Untergang der Menschheit aktiv zu befördern, indem er die Kräfte eines möglichen kooperativen Widerstands dagegen zugunsten einer Machtergreifung von Privilegienmuschis lähmt und die aufwärtsmobile Mittelschichtfrau dabei zum Inbegriff der Privilegienmuschi macht. Die heute global herrschende »Superklasse« dankt es den Feministinnen durch Kooptation in die Eliten, damit die Scheiße, die auf uns heruntertropft, ab sofort quotiert männlich und weiblich sei.

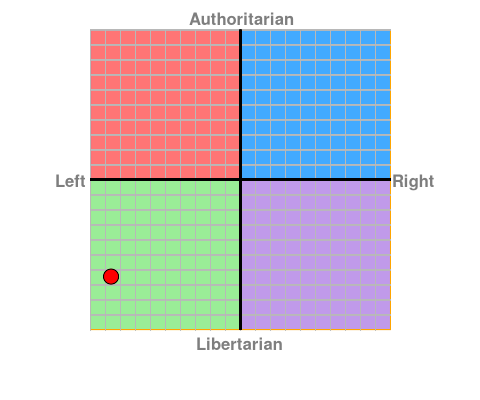
Schreibe einen Kommentar