20. November 2015
gleichheitunddifferenz hat auf ihrem Blog einen »Appell an Männerrechtler« veröffentlicht, in dem sie kritisiert, dass Männerrechtler sich die falschen Gegner wählen, wenn sie ihr Hauptaugenmerk auf eine Kritik des Feminismus legen:
»Was genau bringt es euch, wütend und oft offen neidisch auf „den Feminismus“ und Mädchen- bzw. Frauenförderung einzudreschen?
Ihr verausgabt euch, vergebt euer ganzes Potential, weil ihr euch in sinnlosen Schattenkämpfen abarbeitet.«
Der Blogpost deutet an, dass der Feminismus im Wesentlichen mit der Menge seiner »Graswurzelprojekte« identisch sei:
»Mädchenprojekte werden deshalb gefördert, weil sich Frauen hingestellt haben und genau das gefordert haben, weil sie sich in Vereinen, in Gremien, in Ausschüssen politisch und außerpolitisch dafür eingesetzt haben. (…) Die weibliche Rolle ist deshalb nicht mehr ganz so starr, weil sich nun bereits weit über ein Jahrhundert mutige Frauen (und Männer) dafür engagiert haben, dass sie geöffnet wird. (…) (D)as alles kam nicht von selbst, sondern es wurde laut gefordert und in jahrzehntelanger Kleinarbeit erkämpft.«
Aus diesem Grund empfiehlt sie der Männerbewegung, diese Strategie einer Graswurzelbewegung in größerem Rahmen als bisher zu adaptieren und den Angriff auf die feministische Ideologie als Energieverschwendung und Wahl des falschen Gegners zu erkennen.
»Weil der Feminismus nicht euer Problem ist. Sondern starre, traditionelle Vorstellungen von Männlichkeit.«
Ich denke, dass diese Ansicht nicht nur unzutreffend ist, sondern obendrein einer der Gründe, warum es tatsächlich einer ideologiekritischen Männerrechtsbewegung bedarf. Und zwar darum, weil sie trotz ihrer in den Details konzilianten Aussagen repräsentativ für eine öffentliche Meinung steht, die bezüglich der Probleme von Männern in grundsätzlichen Hinsichten ignorant bleibt.
(1) »Der Feminismus ist nicht euer Problem«: Die Diskussion darüber, was denn »der Feminismus« sei, ist so alt wie wiederkehrend. Derjenige Feminismus aber, der objektiv ein Problem für Männer darstellt, lässt sich klar benennen: es ist der institutionalisierte Feminismus, d.h. die Netzwerke jener Feministinnen (und jener wenigen Feministen), die in Politik, Behörden, Medien, Wissenschaft und Lobbyorganisationen überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert werden und einen prägenden Einfluss auf Gesetzgebung, öffentliche Budgetvergabe und öffentliche Meinung ausüben, und darüber hinaus diejenigen Netzwerke, die diesen institutionalisierten Feminismus mit publizistischen Mitteln ideologisch flankieren (wozu auch wenigstens ein Teil der sich als feministisch verstehenden Bloglandschaft gehört).
Und von diesen feministisch geprägten Institutionen geht eine ebenso klar benennbare Ausübung von Macht und Herrschaft aus, wovon die Ausübung einer öffentlichen Diskursherrschaft nicht der geringste Teil ist. Wie weitgehend (und totalitär) diese Herrschaft sein kann, lehrt derzeit das Beispiel der Etablierung einer Paralleljustiz an amerikanischen Universitäten im Zuge eines Kampfes gegen eine angebliche »rape culture«, durch die mittlerweile Grundrechte außer Kraft gesetzt werden.
Feministische Männerfeindschaft ist kein Hirngespinst, sondern lässt sich an einer Vielzahl von Fällen klar belegen, und ebenso klar lässt sich belegen, dass sie kein Nischenphänomen darstellt, sondern den öffentlichen Diskurs aus herrschender Position durchdringt.
gleichheitunddifferenzens Reduzierung des Feminismus auf eine Graswurzelbewegung halte ich daher für merkwürdig kurzsichtig und naiv. Es scheint, als habe die Autorin implizit bereits eine Einschränkung auf das vorgenommen, was sie persönlich für »guten« Feminismus hält. Daraus resultiert der falsche Schluß, dass männerrechtliche Kritik, wenn sie auf diesen von der Autorin gemeinten Feminismus nicht passe, überhaupt kein unter den Begriff Feminismus fallendes legitimes Ziel habe.
Pointiert gesagt: männerrechtliche Kritik greift einen zur Bonzenherrschaft geronnenen Feminismus an, also das sozialwissenschaftlich durchaus erwartbare Resultat der Institutionalisierung einer sozialen Bewegung – erwartbar darum, weil es einem typischen Muster entspricht, das man mit Robert Michels als das »eherne Gesetz der Oligarchie« bezeichnen kann. Die Annahme, die Frauenbewegung würde in ihrem historischen Verlauf dieser sozialen Dynamik nicht folgen, ist eine idealisierende Selbsttäuschung. Michels hatte im Jahre 1911 unter diesem Begriff die negativen Aspekte der Entwicklung der wilhelminischen Sozialdemokratie von einer Bewegung zu einem Apparat beschrieben:
»Die Organisation ist die Mutter der Herrschaft der Gewählten über die Wähler, der Beauftragten über die Auftraggeber, der Delegierten über die Delegierenden. Die Bildung von Oligarchien im Schoße der mannigfaltigen Formen der Demokratie ist eine organische, also eine Tendenz, der jede Organisation, auch die sozialistische, selbst die libertäre, notwendigerweise unterliegt.
Robert Michels, Soziologie des Parteiwesens, Kröner 1989, S. 370 f.
Wir fügen hinzu: selbst die feministische Bewegung unterliegt dieser Tendenz. Die Protagonistinnen der feministischen Bewegung dagegen treten weiterhin so auf, als sei der Feminismus tatsächlich immer noch wesentlich eine Graswurzelbewegung und der Verweis auf die massiven Belege für ihre Oligarchisierung nur die üble Nachrede ihrer politisch und kulturell rückständigen männerrechtlichen Gegner. Diesem Irrtum erliegt offenkundig auch gleichheitunddifferenz, wobei der Vorwurf der Rückständigkeit bei ihr als Stehenbleiben in veralteten Rollen gefasst wird:
(2) »Das Hauptproblem von Männern sind starre, traditionelle Vorstellungen von Männlichkeit«: Diese Behauptung stellt zum einen eine unangemessene Psychologisierung dar. Denn in der Auseinandersetzung mit dem institutionalisierten Feminismus vertritt männerrechtliche Kritik legitime Interessen, die sich beispielsweise auf Wortlaut und praktische Anwendung von Gesetzen mit Folge einer objektiven Schlechterstellung von Männern beziehen. Solche Schlechterstellungen wirken sich unabhängig von männlichen »Rollenvorstellungen« aus.
Zum anderen impliziert diese These des Blogposts, solche »Rollenvorstellungen« seien etwas, mit dem sich Männer qua Selbstzuschreibung selbstverschuldet selbst im Wege stehen. Die These, bei diesen Vorstellungen handele es sich wesentlich um Selbstzuschreibungen, ist aber ebenso wenig haltbar. Zu den massivsten Schlechterstellungen und Schädigungen von Männern zählen diejenigen, die die Rolle des Vaters in Bezug auf seine (Ex-)Frau und seine Kinder betreffen. Faktisch wird damit der männliche Versuch bestraft, die Rolle des in der Erziehung abwesenden Mannes zu durchbrechen, der hauptsächlich durch die aus seiner Erwerbstätigkeit stammenden finanziellen Mittel in der Familie präsent ist.
Ebenso gehört es zum Standardrepertoire des öffentlichen feministischen Diskurses, dissidente Männer in ganz traditionellem Sinne als »Jammerlappen« und ähnliches zu denunzieren. Männern wird damit bedeutet, dass sie keinen Grund hätten, sich über ihre objektive gesellschaftliche Situation zu beschweren (hier folgt meist implizit oder explizit die Unterstellung von der männlichen Privilegiertheit), und das einzige ihnen zugestandene Leiden wird begrifflich als Leiden an einer selbstverschuldeten Rolle gefasst.
Aus der Perspektive der feministischen Oligarchie gibt es einen wichtigen Grund für diese diskursive Taktik: ihr ist schon aus Gründen der Selbsterhaltung als Apparat daran gelegen, die Funktion des Mannes als anonymer Transferleistungszahler aufrecht zu erhalten, weil dies über das Phänomen der »entsorgten Väter« hinaus auf gesamtgesellschaftlicher Ebene die Voraussetzung dafür ist, die Ressourcenversorgung für den Unterhalt einer feministischen Bürokratie, also die öffentliche Finanzierung feministischer Projekte und damit die Legimitierung des Feminismus bei der eigenen weiblichen Klientel aufrecht zu erhalten. Das läuft unter anderem über die Unterstellung, Frauen wären nicht selbst dafür verantwortlich, eine einträgliche Berufswahl zu treffen – der realsatirische Klassiker zum Thema sind Frauen, die »Gender Studies« studieren, um sich zu beschweren, dass es zu wenig Frauen in der Informatik gibt.
Das funktioniert aber nur dann, wenn die Funktion des Mannes als gesellschaftlich primärem Erwirtschafter von Einkommen einerseits eingefroren, andererseits mithilfe von Stigmatisierungsstrategien so weit wie möglich abgeschöpft wird. Dieser Zusammenhang ist das, was man in einem präzisen Sinne als »Staatsfeminismus« bezeichnen kann.
Insofern ist die allgemeine These, dass es einen auf Männer wirkenden Rollen- und Konformitätsdruck gibt, tatsächlich zutreffend. Sachlich falsch und analytisch irreführend ist aber die Implikation, es handele sich dabei um ein primär psychologisch zu erklärendes Stehenbleiben von Männern bei veralteten Selbstbildern – eine Variation des vielfach zu vernehmenden Vorwurfs, Männer würden sich »nicht verändern«. Das ist bereits aus historischen Gründen unzutreffend: die »Aufweichung« der männlichen Rolle beginnt lange bevor es eine Erfindung namens Feminismus gibt: mit dem Beginn der Neuzeit wird das Ideal des Kriegers sukzessive durch das Ideal des Händlers und Arbeiters, mithin des »Bürgers« ersetzt: das ist das Kernstück der modernen, »bürgerlichen« Gesellschaft, inklusive neuer Ideale wie der »Empfindsamkeit« und »Kommunikationsfähigkeit«, die auch für Männer als neues Kriterium der Zivilisiertheit gelten. Genauso wie Frauen mussten sich auch Männer an die gewandelten Rollenanforderungen der modernen Industriegesellschaft anpassen.
Das geht sogar so weit, dass die alte, »patriarchale« Ungleichwertung der Geschlechter in einer eigenen kopernikanischen Revolution völlig auf den Kopf gestellt wurde: auch dem als Händler und Arbeiter modifizierten Mann wird der Vorwurf der »Rohheit« und »Seelenlosigkeit« gegenüber der moralischen Überlegenheit der (bürgerlichen) Frau gemacht – aber hinter diesem Vorwurf steht kein Tatbestand, sondern es handelt sich um einen Bestandteil der Ideologie der bürgerlichen Gesellschaft. Insofern ist die Forderung nach dem »Neuen Mann« so alt wie die bürgerliche Gesellschaft selbst und auch keine feministische Erfindung, und insofern ist auch die These von der »unmenschlichen männlichen Rolle« schon historisch völlig verunglückt.
Der moderne Feminismus leidet ganz entgegen seinem Selbstverständnis an dem Problem, dass er in seinem Anspruch, den moralischen Fortschritt der Menschheit zu befördern, wahrzunehmen versäumt, wie sehr er selbst ein Produkt dieser bürgerlichen Gesellschaft ist, der ihre kulturellen Muster repliziert anstatt sie zu überwinden.
(3) Fazit: Tatsächlich ist es heute ganz wesentlich der institutionalisierte, »oligarchische« Feminismus selbst, der Männer in einem double bind, in einer »Beziehungsfalle« unvereinbarer Rollenanforderungen festhält. Auf der einen Seite sorgt die faktische Deklaration einer weiblichen Unterverantwortlichkeit mit ihren ganzen juristischen und diskursiven Konsequenzen dafür, dass Männer in einer komplementären Position der Überverantwortlichkeit festgehalten werden, und zugleich wird ihnen diese Überverantwortlichkeit über die psychologisierende Zuschreibung einer Disponiertheit zu »männlicher Hegemonialität« als Ausübung »patriarchaler Herrschaft« angekreidet.
Was Männern also im Wege steht, ist nicht diese oder jene Rolle und »Vorstellung von Männlichkeit«, sondern die inkonsistente Vermengung von Anforderungen aus unterschiedlichen Rollenmustern, und es ist eine aus dieser Inkonsistenz resultierende Lähmung, die den Eindruck von Stillstand erzeugt.
Dass in dieser Situation in der Männerbewegung zwei Reaktionsmuster entstehen, sollte nicht überraschen, denn formell gesehen gibt es aus dieser Beziehungsfalle zwei Ausgänge in einen Gleichgewichtszustand: das eine Muster akzeptiert die männliche Überverantwortlichkeit, fordert aber als Ausgleich die weibliche Unterordnung unter eine männliche Dominanz. Das zweite Muster fordert eine konsequente Aufhebung der weiblichen Unterverantwortlichkeit, aber damit zugleich auch ein Ende des auf männlicher Arbeit beruhenden Transferleistungssystems.
In beiden Fällen aber ist der Kampf gegen die feministische Ideologie und Oligarchie eine notwendige Voraussetzung für die Weiterentwicklung eines männlichen Rollenselbstverständnisses.

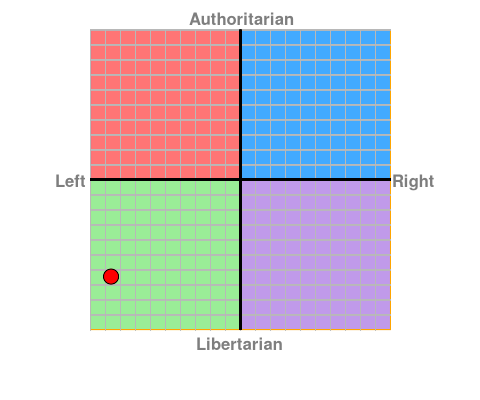
Schreibe einen Kommentar