20. Mai 2016
Im Folgenden rezensiere ich ausführlich das Buch Machonomics der schwedischen Journalistin Katrine Marçal. Ich rezensiere es ausführlich, weil es in meinen Augen ein mustergültiges Beispiel dafür darstellt, wie das kritische Vermögen einer eigentlich nicht unklugen Autorin durch ideologische Voreingenommenheiten beeinträchtigt wird und das Resultat ihrer Arbeit bei aller sprachlichen Eleganz zum Fließbandprodukt einer feministischen Bewusstseinsindustrie werden lässt, dem am Ende die Bestätigung vorgefasster Ansichten wichtiger ist als eine Ausschöpfung des kritischen Potentials des von ihr angeschnittenen Themas.
Das eigentliche Thema der Autorin ist das ökonomische Menschenbild, also diejenigen anthropologischen Fiktionen, die den modernen ökonomischen Theorien seit Adam Smith zur Beschreibung des wirtschaftlich handelnden Menschen unterlegt wurden. Sie versucht aber, diesem Thema eine zusätzliche feministische Wendung zu geben, indem sie dieses Menschenbild auf die Rolle des Mannes in der modernen Gesellschaft bezieht. Die englische Sprache bietet hierzu einen rhetorisch günstigen Anknüpfungspunkt, nämlich die Doppelbedeutung von »economic man«: »Mensch« und »Mann«. Damit ist zugleich auch schon die Kritikfigur benannt, derer sich Marçal bedient: die alte, vom Feminismus adaptierte These Georg Simmels von der Identifizierung des Männlichen mit dem Neutralen und Objektiven, angereichert um eine Kritik der theoretischen Vernachlässigung der Reproduktionssphäre. Für das Material ihrer Argumentation zieht die Autorin einen historischen Längsschnitt durch die Geschichte der ökonomischen Theorien – beginnend mit Adam Smith, und endend mit dem »neoliberalen Menschenbild«. Wie formuliert die Autorin ihre Kritik dieses Menschenbildes, und wie wirkt sich ihr feministischer Standpunkt auf diese Kritik aus?
Kapitel 1: Adam Smith
Adam Smith bringt die Klarheit der Gesetze der Newtonschen Physik in eine Theorie der Gesellschaft ein – er formuliert eine naturgesetzliche Mechanik der Gesellschaft. Dazu zerlegt er die Gesellschaft in ihre Atome: die Individuen. Individuen handeln nach einem unveränderlichen Prinzip: ihrem Eigeninteresse.
»So wie sich die Physik den unteilbaren Atomen widmete, befasste sich die aufkeimende Nationalökonomie mit unabhängigen Individuen, weil man davon ausging, dass die Gesellschaft nichts anderes als die Summe dieser Individuen sei.«
S. 17
Den gesetzmäßigen Mechanismus, der die Einzelentscheidungen der Individuen zu einem sinnvollen Ganzen zusammenfügt, nennt er die »unsichtbare Hand«. Mit dem Anspruch, klare Gesetzmäßigkeiten gefunden zu haben, stellte sich die ökonomische Theorie als alternativlos dar.
»Der Markt war ein Teil der menschlichen Natur, das heißt, wenn die Ökonomie den Markt erforschte, erforschte sie zugleich den Menschen.«
S. 18
Die feministische Kritik an diesen Vorstellungen ist naheliegend: sie beanstandet erstens, dass dasjenige, was später Reproduktionsarbeit genannt werden wird, in der Ökonomie keinen Platz hat, weil es nicht als produktiv verstanden werden kann, und sie beanstandet zweitens, dass die Trennung in produktive und reproduktive Arbeit eine geschlechtsspezifische ist. Diese Koinzidenz erlaubt es dann, das ökonomische Modell auf der Folie von Simone de Beauvoir zu kritisieren:
»So wie es ein ›anderes Geschlecht‹ gibt, gibt es auch eine ›andere Ökonomie‹. Es ist die Arbeit, die traditionell von Männern verrichtet wird, die zählt. Sie definiert das ökonomische Weltbild. Die Arbeit der Frau ist ›das Andere‹. Das, was er nicht tut, doch worauf er angewiesen ist, um tun zu können, was er tut.«
S. 20
Diese Kritik trifft zunächst einmal zu: der bürgerlichen Arbeitsteilung ist eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung unterlegt, und als produktiv gilt das, was aus den Zyklen der Reproduktion des Lebens ausbricht, indem es in der linearen Perspektive eines kontinuierlichen Wachstums dem menschlichen Leben Güter hinzufügt, die es zuvor nicht gab, und auf diese Weise den gesellschaftlichen Wohlstand mehrt. Zugleich aber kündigt sich in den Formulierungen der Autorin, zunächst ganz leise und unscheinbar, eine Perspektive an, die den zutreffenden Befund verzeichnet und in Schieflage bringt. Sie steckt beispielsweise in dem folgenden bereits genannten Satz: »Es ist die Arbeit, die traditionell von Männern verrichtet wird, die zählt.« Diese Formulierung öffnet die Tür zu einem psychologischen Kurzschluss. Sie will den Sinn des ökonomischen Produktionsbegriffs aus dem Umstand gewinnen, dass diese produktive Arbeit von Männern verrichtet wird.
Dass sie von Männern verrichtet wird, erscheint als der wesentliche kausale Grund dafür, dass sie als produktiv wertgeschätzt wird. Männer stellen produktive Arbeit über reproduktive Arbeit, weil es ihre Arbeit ist. Sie verteidigen ihre gesellschaftliche Überlegenheit und ihre Privilegien. Diese Deutung wird nicht explizit ausgesprochen, aber sie wird in einem Kontext, einem »framing« feministischer Theorien praktisch zwangsläufig nahegelegt, und sie begünstigt eine Kausalerklärung, die auf eine angebliche psychische Grundverfassung des Mannes abhebt: der Mann verhält sich »hegemonial«, was bedeutet, dass er stets und allezeit persönlich motiviert ist, seine beanspruchte Überlegenheit aufrechtzuerhalten.
Das Problem dieses Erklärungsmodells liegt in dem, was es übersieht und übersehen macht: erstens, dass die vom modernen »ökonomischen Mann« verrichtete Arbeit tatsächlich etwas wesentlich Neues darstellt. Sie ist nicht einfach eine Fortsetzung der »traditionell von Männern verrichteten« Arbeit. Die moderne Ökonomie durchbricht das zyklische Schicksal aller vorhergehenden Gesellschaften, indem es – gewissermaßen als fleischgewordene Heilsgeschichte – die Perspektive einer linearen Kumulation von gesellschaftlichem Wohlstand eröffnet. Das traditionelle ökonomische Handeln wird auf fundamentale Weise durchbrochen.
»Produktiv sein« bedeutet von nun an, aus dem zyklischen »Rad der Fortuna« auszusteigen, das den Menschen bald nach oben und bald nach unten befördert hat, ohne seine Lage von einer Umdrehung des Rades zur nächsten wesentlich zu verändern. Und in dieser neuen Perspektive wird nicht nur der gesellschaftliche Wohlstand als Ganzer, sondern auch der Wohlstand des Bürgertums als Klasse, also für beide Geschlechter, vermehrt. Was immer an Kritik dieser Ökonomie noch folgen mag – sie muss anerkennen, dass mit ihr die Welt der traditionellen Zyklen zugunsten eines empirisch messbaren Wohlstands und Fortschritts durchbrochen wurde.
Das von der Autorin vertretene Modell lässt zweitens übersehen, dass sich in diesem Veränderungsprozess auch der Charakter des Mannes ganz wesentlich geändert hat: er wird vom Heros zum Händler, vom Krieger zum Buchhalter, vom selbstherrlichen Subjekt zum Rädchen im Getriebe. Die moderne Ökonomie bringt eine tiefgreifende »Entheroisierung« des Mannes mit sich. Nicht Heldenmut wird ihm abverlangt, sondern stromlinienförmige Anpassung an eben jene Gesetzmäßigkeiten, die die ökonomische Theorie zu entdecken beansprucht.
Denn dass der ökonomische Mann sein Eigeninteresse verfolgt, beschreibt nur seine Motivation, nicht aber die Verrenkungen und Anpassungen, die er vollziehen muss, um seinen Eigeninteressen auch zum Erfolg zu verhelfen. Und hierzu komplementär, und in einer gegensinnigen Bewegung, verändert sich die Stellung der Frau: sie wird von der zumindest im Prinzip dienstbaren Stellung als Magd des Mannes zum Garant der menschlichen Kultur schlechthin erhoben, indem ihre »Herzensbildung« und moralische Überlegenheit allein den Mann davor bewahrt, sich der gesetzesgetriebenen Maschinerie, die ihn bestimmt, gänzlich anzuverwandeln.
In ökonomischer Hinsicht ist ihre Arbeit keine Produktion, aber ihr Beitrag zur modernen Zivilisation wird, anders als Marçal und die von ihr zitierte Beauvoir nahelegen, gerade nicht verkannt. Im Gegenteil: der kulturelle Anteil der Reproduktionsarbeit wird geradewegs sakralisiert. Die »Produktionsferne« der Frau ist das Fundament, das ihre überlegene Tugendhaftigkeit ermöglicht. Es kann also keine Rede davon sein, dass sich in der theoretischen Stellung der produktiven Arbeit einfach »traditionelle Männlichkeit« fortschreibt. Sowohl Männlichkeit als auch Weiblichkeit werden in ihren kulturellen Zuschreibungen revolutioniert, und zwar insbesondere auch hinsichtlich einer moralischen Wertung der Geschlechter, indem sie im Vergleich zur vorangehenden Epoche auf den Kopf gestellt werden.
Obige ausführliche Deutung mag als heillose Überinterpretation eines kurzen Satzes der Autorin erscheinen. Ich beanspruche aber, mit dem Vorauswissen des Rezensenten, der das ganze Buch schon gelesen hat, zeigen zu können, dass sich dieses Deutungsmuster der Autorin durch alle Kapitel durchhält, kumuliert und verstärkt und am Ende zu einem höchst problematischen Gesamturteil führt.
Kapitel 2: Robinson Crusoe
»Robinson Crusoe ist das Paradebeispiel für den ökonomischen Mann.«
S. 26
Denn er ist auf seiner einsamen Insel ein von sozialen Bindungen gelöstes Individuum, das rationale Entscheidungen zum Zwecke seines wirtschaftlichen Überlebens trifft, und er ist obendrein sowohl Produzent als auch Konsument, der mit sich selbst eine Beziehung von Angebot und Nachfrage unterhält. Dies zwar nicht zeitgleich, aber von einem Tag auf den nächsten: was er heute produziert, kann er morgen konsumieren. Und da er allein lebt, ist er zugleich ein souveränes Subjekt seiner Interessen und Präferenzen.
»Ebenso wie Robinson Crusoe war der ökonomische Mann ein moderner Mann, der sich von der althergebrachten, irrationalen Tyrannei freigemacht hatte. Robinson Crusoe konnte sich selbst versorgen, und weder Kaiser noch König erteilten ihm Befehle. Er war sein eigener Herr, frei und niemand untertan. Und diesen neuen Menschen führte die Nationalökonomie in die neue Zeit.«
S. 27 f.
Diese Souveränität ist aber zugleich eine Fiktion:
»Gefühle, Altruismus, Empathie und Zugehörigkeit – all diese Eigenschaften sind laut den ökonomischen Standardtheorien kein Teil von ihm. (…) Für den ökonomischen Mann existiert keine Kindheit, keine Abhängigkeit und keine Gesellschaft, die ihn beeinflusst.«
S. 29
Die Infragestellung dieses Modells erfolgt noch zurückhaltend. Kritik liegt in einer einleitenden, sarkastischen Spitze:
»Gewiss könnte man fragen, was uns die Geschichte über einen weißen, rassistischen Mann, der siebenundzwanzig Jahre lang auf einer Insel lebt und sich schließlich mit einem ›Wilden‹ ankumpelt, über moderne Ökonomie verraten kann.«
S. 21
Aber auch darin, dass das männliche Subjekt der Robinson-Crusoe-Ökonomie mit einem weiblichen Opfer kontrastiert wird:
»Ausbeutung war nichts Persönliches mehr. Die Frau, die sich für sechs Dollar in der Stunde den Rücken ruiniert, tut dies nicht, weil ihr jemand etwas Böses will oder sie dazu verurteilt wurde. Niemand trägt die Schuld, niemand die Verantwortung. Dahinter steckt die Ökonomie, du Dummerchen!«
S. 30 f.
Erneut mag der Rezensent kleinlich erscheinen: ein kleiner polemischer Nadelstich gegen den »weißen, rassistischen Mann« und ein Hinweis auf eine ruinierte weibliche Gesundheit – das zu beanstanden, muss doch Überempfindlichkeit, wenn nicht Angst um die eigenen Privilegien sein! Entscheidend ist aber nicht die Reizstärke, sondern die Wiederholung eines Musters: indem der männliche Proletarier nicht erwähnt wird, wird uns erneut nahegelegt, den Kern des Problems als ein Problem der Geschlechtszugehörigkeit zu betrachten.
Indem aus der herrschenden Klasse die Frau und aus der ökonomisch beherrschten Klasse der Mann ausgeblendet wird, wird die Kategorie der Klasse als solche unsichtbar. Sie bleibt außerhalb des Lichtkegels, der von den Darstellungsentscheidungen der Autorin geworfen wird. Die Folie der im zweiten Kapitel geübten Kritik legt sich mit ähnlichen Umrissen auf diejenige des ersten Kapitels und verstärkt diese. In der Beiläufigkeit der Formulierungen lässt sich leicht übersehen, dass die Autorin hier eine Entscheidung bezüglich der Zulassung von Kausalzusammenhängen zum angestrebten Erklärungsmodell trifft, ohne die analytischen Kategorien explizit auszuweisen.
Kapitel 3: Chicago
Das dritte Kapitel resümiert zu Beginn noch einmal die Arbeitsteiligkeit der klassischen bürgerlichen Geschlechtsrollen:
»Während der Mann für das Eigeninteresse stehen sollte, war es die Aufgabe der Frau, die fragile, zu konservierende Liebe zu verkörpern.«
S. 32
Dann leitet das Argument allerdings zur Chicago School of Economics über, deren Vertreter die Ansicht entwickelten,
»dass jede menschliche Aktivität mithilfe ökonomischer Modelle analysiert werden könne, selbst die ökonomische Aktivität der Frau.«
S. 33
Sie begannen,
»die ökonomischen Standardmodelle um Phänomene wie Haushaltsarbeit, Diskriminierung oder die Organisation der Familie zu erweitern.«
S. 34
Da Frauen in der Mitte des 20. Jahrhunderts nicht mehr überwiegend vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden, verlagern sich die ökonomischen Erklärungsversuche auf den Zusammenhang von Erwerbsarbeit und Hausarbeit: darauf, warum Frauen mehr Hausarbeit und weniger Erwerbstätigkeit verrichten. Die Chicago-Schule nimmt nun an, dass Frauen hier eine rationale Wahl treffen:
»Sie waren nicht faul oder unbegabt, keineswegs, doch für eine Frau war es schlichtweg nicht rational, sich ebenso sehr ins Zeug zu legen wie ein Mann, würde sie ihre Karriere doch ohnehin für einige Jahre auf Eis legen, wenn sie erst einmal Kinder bekäme. Es gab keinen Grund, sich weiterzubilden oder vom Job zerschleißen zu lassen. Und weil Frauen weniger in ihre Karrieren investierten, verdienten sie weniger Geld.«
S. 36
Nun hört sich dies tatsächlich nach einer vernünftigen Erklärung an, aber Marçal ist damit nicht einverstanden. Sie stellt eine Gegenbehauptung auf:
»Viele Frauen investierten genauso viel in ihre Ausbildung wie Männer und verdienten dennoch weniger – ganz gleich, wie sehr sie sich anstrengen mochten. Der Grund schien etwas zu sein, das auf den Namen ›Diskriminierung‹ hörte.«
S. 36
Die Autorin geht im Anschluss daran zwar dazu über, uns darzulegen, wie Gary Becker (der von ihr hauptsächlich erörterte Chicago-Ökonom) am Beispiel der Rassendiskriminierung Diskriminierung zu erklären versucht, sie teilt uns aber nicht mit, in was genau die behauptete Frauendiskriminierung eigentlich bestehen soll. Wenn Marçal uns Beckers Argument korrekt wiedergibt, dann möchte dieser die Geringschätzung von Schwarzen durch Weiße als die »Präferenz« erklären, »sich nicht mit Schwarzen zu umgeben.« (S. 37) Das führe dann zu Segregationsprozessen auf dem Arbeitsmarkt und zur Verdrängung von Schwarzen in schlechter bezahlte Berufe.
Allerdings schien Becker anzunehmen, dass die Rassendiskriminierung auch durch Marktprozesse beseitigt werden würde, weil die Lohndifferenzen zwischen Schwarzen und Weißen Betriebe besserstellten, in denen überwiegend Schwarze arbeiteten, wodurch sich diese Differenzen früher oder später ausgleichen würden. Dass dieses Modell Beckers zu viele soziale und kulturelle Faktoren außer Betracht lässt, um eine befriedigende Erklärung – für das Fortbestehen der Rassendiskriminierung inbegriffen – bieten zu können, liegt auf der Hand. In ihrer Kritik an Becker laviert die Autorin aber geschickt um eine andere Frage herum: um die Frage nämlich, ob sich »Rassendiskriminierung« und »Frauendiskriminierung« zur Erklärung von Einkommensunterschieden überhaupt über die Vokabel »Diskriminierung« hinaus gleichsetzen lassen.
Denn die These eine Präferenz von Frauen für geringeres Eingespanntsein in die Anforderungen des Erwerbslebens bei bestehender Option für ein Familienleben wenigstens in Teilzeit ist weitaus plausibler als die These einer Präferenz von Schwarzen für die Arbeit in schlechter bezahlten Einkommensgruppen. Die Analogisierung einer angeblichen generellen Frauendiskriminierung im Erwerbsleben mit der Rassendiskriminierung ist tatsächlich ein Trittbrettfahrer-Argument. Es ist entgegen Marçals Behauptung empirisch nicht triftig.
Was die Autorin also nicht in Betracht zieht ist, dass ein Präferenzmodell für die Erklärung von Einkommensunterschieden aufgrund von Rassendiskriminierung falsch, für die Erklärung von Einkommensunterschieden anstelle einer angeblichen Frauendiskriminierung aber zutreffend sein kann. Denn wir befinden uns in Bezug auf die zu erklärenden Einkommensunterschiede nicht mehr im 19.Jahrhundert mit seinen faktischen Berufsverboten für Frauen, und auch nicht mehr in der Epoche von »Leichtlohngruppen«, die tatsächlich eine Form von Lohndiskriminierung darstellten. Sondern wir müssen erklären, wieso diese Einkommensunterschiede bis in unsere Gegenwart fortbestehen. Gegen Ende des Kapitels verweist die Autorin noch auf »familiäre Konflikte«, die von der Annahme einer Nutzenfunktion des Haushalts unsichtbar gemacht würde:
»Doch in Wahrheit kann die Erwerbstätigkeit außerhalb der heimischen vier Wände die Machtverhältnisse innerhalb der Familie sehr wohl beeinflussen. Und das wiederum bedingt die Entscheidungen der Familie: Mama hat weniger zu sagen, weil Papa die Rechnungen bezahlt.«
S. 42
Trotz des einschränkenden »kann … beeinflussen« führt Marçal familiäre Machtverhältnisse mit überlegenem Mann und unterlegener Frau so ein, als handele es sich um den »standard mode of operation« moderner Familien. Dass die Mehrheit der modernen Familien das Familienbudget partnerschaftlich verwaltet und die ökonomisch schwächere Position der Frau mit rechtlichen Mitteln außerordentlich gut aufgewogen wird, fällt in Marçals Behauptung völlig unter den Tisch. Tatsächlich befestigt sie in ihrer Kritik der Chicago-Schule nur den Mythos vom angeblichen »Gender-Pay-Gap«. Sie versucht, sich die Zustimmung des Lesers zur These von der fortbestehenden Lohndiskriminierung der Frau mit einer inkohärenten und empirisch unplausiblen Argumentation zu erschleichen. Offenbar können die Theorien der Chicago-Schule zwar nicht alles, aber immer noch einiges erklären.
Marçal betrachtet sie jedoch als restlos gescheitert, für sie bleibt das komplementäre Modell der Geschlechter in Kraft:
»Der ökonomische Mann konnte nur deshalb Vernunft und Freiheit sein, weil jemand anderes das Gegenteil verkörperte. (…) Jemand anders muss Gefühl sein, damit er Vernunft sein kann. Jemand anders muss Körper sein, damit er drum rum kommt. Jemand anders muss abhängig sein, damit er selbständig sein kann. Jemand anders muss empfindsam sein, während er die Welt erobert. Jemand anders muss sich aufopfern, damit er selbstsüchtig sein kann.«
S. 42 f.
Der letzte Satz der voranstehenden Aufzählung schiebt uns gleichsam im Vorübergehen noch einmal ein Stück Ideologie unter: er ergänzt die mehr oder weniger deskriptiven Aspekte einer Komplementarität der Geschlechter mit einer scharfen Wertung: »Selbstsucht« gegen »Aufopferung«. Als sei es ausgeschlossen, das Engagement des Mannes in der Erwerbsarbeit ebenfalls als Aufopferung für die Familie zu betrachten, und als sei es ausgeschlossen, dass Frauen innerhalb der Familie selbstsüchtig handeln könnten. Wenn Marçal hier nur die Idealisierung der klassischen bürgerlichen Geschlechtsrollen meinen sollte, dann fehlt hier eindeutig die Abgrenzung von einer selbst vollzogenen Wertung. Dieses unmerkliche Changieren zwischen dem ökonomietheoretisch idealisierten und dem empirischen, moralisch bewertbaren Mann zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Buch.
Kapitel 4: John Maynard Keynes
Am Beginn des vierten Kapitels stellt uns die Autorin die politische Vision von John Maynard Keynes vor: Wachstum.
»Ökonomisches Wachstum war die Lösung. Würde es gelingen, die Ökonomie auf die Beine zu bringen, hätte der Mensch, jedenfalls in Europa und den USA, schon im Jahr 2030 keinen Grund mehr zur Besorgnis. Nach Keynes’ Berechnungen würde es uns sogar so gut gehen, dass wir im Grunde nicht mehr arbeiten bräuchten. Stattdessen könnten wir uns der Kunst, der Poesie, der Spiritualität und der Philosophie widmen, das Leben genießen und – wie Keynes es formulierte – die ›Lilien auf dem Felde‹ bestaunen. Wachstum war der Weg, die Lilien das Ziel.«
S. 45
Auf diesem Weg ist der ökonomische Mann – als Idealisierung und als empirisches Individuum – nur ein Durchgangsstadium. Keynes war dieser Mann unbehaglich:
»Doch sobald wir unsere ökonomischen Probleme gelöst hätten, würden wir uns erlauben können, den ökonomischen Mann für das anzusehen, was er in Wahrheit war: ›eine dieser semikriminellen, semipathologischen Anlagen, die man unter einem Schauern den Spezialisten für psychische Krankheiten anvertraut‹, wie Keynes es ausdrückte.«
S. 46
Marçals Kritik folgt auf dem Fuße: wir sind reich geworden, aber haben Keynes Lilien darüber vergessen.
»Unsere Gesellschaft ist von der Ökonomie besessen wie nie zuvor. (…) Die Ökonomie ist nicht in den Hintergrund getreten, damit wir uns der Kunst, der Spiritualität und einem Leben, wie Keynes es sich vorgestellt hatte, widmen können, ganz im Gegenteil. Die ökonomische Logik ist auf sämtliche Lebensbereiche übertragen worden – auch auf die Kunst, die Spiritualität und den Müßiggang.«
S. 47 f.
Ein unermesslicher Reichtum ist weltweit vorhanden, aber er ist auch bis zum Äußersten ungleich verteilt. Wir ahnen mittlerweile jedoch, in welcher Weise uns Katrine Marçal diese Ungleichheiten im Folgenden beschreiben wird:
»Die Hälfte der Weltbevölkerung lebt von weniger als zwei Dollar am Tag. Die meisten von ihnen sind Frauen. Armut hat sich zu einer Frauenfrage entwickelt.«
S. 50
Marçal stützt sich auf die Statistiken der UNFPA, des Bevölkerungsfonds der vereinten Nationen. Da ein Schwerpunkt der Organisation beim Thema der Familienplanung (und mittelbar bei einer Eindämmung schnellen Bevölkerungswachstums) liegt, ist es nicht überraschend, dass in der Arbeit dieser Organisation die Situation von Frauen, insbesondere unter dem Aspekt der Gesundheit und Gleichberechtigung, im Mittelpunkt steht. Männer werden in der Perspektive der UNFPA nur unter dem Aspekt ihrer tatsächlichen oder angeblichen Bindung an »veraltete Rollenstereotypen« in den Blick genommen. Nun mag man diese Ausrichtung des Bevölkerungsfonds als legitime Schwerpunktsetzung verteidigen oder als illegitime Perspektivverkürzung angreifen – ich möchte auf etwas anderes hinaus: auf die Einbindung des Fallbeispiels in Marçals Argumentation.
Erneut wendet sie die Denkfigur von der »Anderen Ökonomie« an: weil das Menschenbild der Ökonomie am Mann und an männlichen Tätigkeiten orientiert ist, zieht sie daraus die Folgerung, dass das Gegenbild dieser Ökonomie weiblich sein müsse. Dass weltweite Armut primär weiblich sei, folgt konsequent aus dieser Prämisse. Erneut liegt ihr Denkfehler im Changieren zwischen dem abstrakten Mann der Ökonomen und dem empirischen Mann der realen Welt. Die Frage, ob der empirische Mann in der ökonomischen Welt ein Gewinner oder Verlierer ist, stellt sich in dieser Perspektive nicht: er wird rein definitorisch als ein Bevorzugter dieses Menschenbildes klassifiziert.
Der tragende Gegensatz der gesamten Argumentation ist der Gegensatz von idealisiertem Mann und realer Frau. Der reale Mann dagegen wird gar nicht erst zum Thema – es sei denn in seiner impliziten Vereinnahmung als Gewinner der Verhältnisse. Und damit wird auch jegliche Form globaler Armut, die nicht Frauen, sondern Männer, oder vorzugsweise Männer betrifft (wie Obdachlosigkeit, einem Indikator für Einbindung in soziale Netzwerke, und ein ganz überwiegend männliches Problem), gar nicht erst zum Thema. Globale Armut ist weiblich, weil globale Armut von Männern gar nicht erst zu bestimmen versucht wird.
Ärgerlich ist dies insbesondere auch darum, weil Marçals Kritik am ökonomischen Menschenbild durchaus treffend ist. Dass die ökonomische Logik entgegen Keynes’ Vorstellung nicht an Bedeutung verloren, sondern sich auch auf nichtökonomische Bereiche wie »die Kunst, die Spiritualität und den Müßiggang« ausgedehnt hat, ist eine treffende Beschreibung unserer Gegenwart, und es wird nicht die einzige treffende Einsicht der Autorin bleiben:
»Achtzig Jahre nach Keynes würde kaum jemand die Aufgabe der Wirtschaftswissenschaften darin sehen, mit der Armut in der Welt aufzuräumen. Das Selbstbild der Ökonomie hat sich gewandelt. (…) Inzwischen sind Ökonomen mehr daran interessiert, ihre Theorien auf alle möglichen Themenbereiche zu projizieren – von Phänomenen wie Rassismus bis hin zu Orgasmen – als sich der Erforschung des realen Marktes zu widmen.«
S. 56
Das Potential dieser Kritik wird jedoch durch die Reduktion auf ausschließlich weibliche Problemlagen sogleich wieder verschleudert.
Kapitel 5: Betty Friedan
Das fünfte Kapitel eröffnet mit einer Betrachtung der ökonomischen Ungleichheit zwischen Frauen am Beispiel bezahlter Hausarbeit, die von als Kindermädchen arbeitenden Migrantinnen erledigt wird. Im Vergleich zu den Löhnen in ihren Herkunftsländern werden diese Kindermädchen sehr gut bezahlt, arbeiten aber in sehr langen Arbeitstagen (in den USA z. B. 14 Stunden) für die Familien berufstätiger Doppelverdiener.
»Auf der anderen Seite verdient eine philippinische Hausangestellte in Hongkong genauso viel wie ein männlicher Arzt auf dem philippinischen Land. In Italien verdienen Kinderfrauen oft sieben- bis fünfzehnmal mehr als in ihren Heimatländern. Sind sie Opfer? Und wenn ja, in Vergleich zu wem?«
S. 60
Haus- und Erziehungsarbeit ist also dann Erwerbsarbeit, wenn sie für andere getätigt wird, also gleichsam nicht dem Eigenbedarf dient, sondern einen Wert für andere darstellt bzw. erzeugt. Dieser Wert wird von den berufstätigen Frauen der reichen Länder nachgefragt, die sich dadurch von eigener Hausarbeit entlasten. Marçal beklagt, dass Erwerbsarbeit und Familienleben nur schwer vereinbar sind:
»Die Frau hat sich auf den Arbeitsmarkt begeben und sich von einem beträchtlichen Teil der Hausarbeit freikaufen können. Etwas anderes blieb ihr nicht übrig. Will man Karriere machen, gilt es, das Familienleben an den Haken zu hängen, sobald man das Büro betritt. (…) Der Arbeitsmarkt ist noch immer hochgradig von der Idee infiziert, Menschen seien körper- und geschlechtslose, nutzenmaximierende Wesen, ohne Familie und Kontext. Die rau muss sich entscheiden. Entweder sie verwandelt sich in ein solches Wesen oder sie ist das Gegenteil: das Unsichtbare und Selbstlose, das benötigt wird, damit die Gleichung aufgeht.«
S. 60
Marçals erwerbstätige Frau hat offenbar mehr als eine Motivation zur Verfügung: »sich von einem beträchtlichen Teil der Hausarbeit freikaufen« einerseits, »Karriere machen« andererseits. Das, was die Frau dabei zurücklässt, scheint aber nicht nur negativ besetzt zu sein: als berufstätige Frau muss sie »das Familienleben an den Haken … hängen«. Das hört sich nach einem Verlust an, nicht nach einem Gewinn. Offenbar hat »Familienleben« einen intrinsischen Wert, der über bloßes Verrichten von Hausarbeit hinausgeht, und das Leben in der Rolle der »Unsichtbaren und Selbstlosen« scheint auch seine Vorzüge zu haben. Anders ausgedrückt: Marçal möchte den Eigenwert einer Sphäre weiblicher Tätigkeit nicht völlig opfern, sondern in irgendeiner Weise bewahren. Das formuliert sie auch explizit:
»Um die Idee des ökonomischen Mannes als universales Prinzip aufrechtzuerhalten, gilt es, die Frau in das Modell hineinzustopfen, und zwar so, als wäre sie genau wie er. (…) Die Frau soll ihren Wert auf einem Arbeitsmarkt unter Beweis stellen, der sich noch immer vorwiegend auf den Bedürfnissen des Mannes gründet. Sie soll sich in Kategorien behaupten, die von und für Männer geschaffen wurden – auf Basis einer Wirklichkeit, die Frauen aussperrt.«
S. 63
Wir können hier erneut »Finde den Fehler« spielen. Am eklatantesten ist die begründungslos präsentierte Behauptung, der Arbeitsmarkt würde »auf den Bedürfnissen des Mannes« gründen. Wie hat die Autorin das geprüft? Wann und wo hat sie »die Bedürfnisse des Mannes« ermittelt? Auch hier verwischt sie wieder die Grenze zwischen dem ökonomisch idealisierten und dem empirischen Mann. Die implizite Kausalbehauptung lautet: das theoretische Ideal des homo oeconomicus wurde entwickelt, um den »Bedürfnissen des Mannes« zu dienen.
Da diese »Bedürfnisse des Mannes« jedoch gar nicht erst empirisch erhoben wurden, lässt sich diese Kausalbehauptung auch nicht falsifizieren. Würde sie explizit zur Diskussion gestellt, könnte man auch auf alternative Erklärungsmodelle verfallen: das Ideal des homo oeconomicus wurde entwickelt, um der Praxis jener bürgerlichen Erwerbstätigkeit gegenüber der alten Ständegesellschaft zu legitimieren, in der der Mann gesellschaftliche Reichtümer erarbeitet und es seiner Frau ermöglicht, gerade nicht in dieses Modell mit hineingestopft zu werden, weil ihre Tätigkeit für Familie und Haushalt als Transferleistung aus dem männlichen Einkommen bezahlt wird.
Hier wären also die Bedürfnisse und Interessen der bürgerlichen Klasse, und zwar beider Geschlechter, ausschlaggebend für die Entwicklung des theoretischen Idealbilds. Diese Formulierung würde aber die Möglichkeit einräumen, dass weibliche Hausarbeit eben nicht ausschließlich oder hauptsächlich aufopfernde Plackerei ohne intrinsischen und materiellen Gegenwert ist. Dem »Aussperren der Frau« aus dem Erwerbsleben entspräche dann ein »Aussperren des Mannes« aus dem Familienleben, und eine empirische statt einer bloß deklarativen Bestimmung der »Bedürfnisse des Mannes« könnte das Resultat erbringen, das auch der Mann mit dieser eigenen Aussperrung ein großes Opfer erbringt.
Denn in der frühneuzeitlichen Produktionsform des »ganzen Hauses«, exemplarisch verwirklicht in den Handwerker- und Großbauernfamilien, war der Mann trotz geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung im Haus anwesend und damit an der Kindeserziehung direkt beteiligt. Die Entstehung des homo oeconomicus kausal auf männliche Bedürfnisse einzudampfen, erliegt somit einem Fehler, den man wohl als den Kardinalfehler feministischer Analysen bezeichnen kann: das vollständige Außerbetrachtlassen von Kausalursachen für soziale, politische und kulturelle Veränderungen, die dem Verhältnis der Geschlechter extern sind, weil sie sich auf das Verhältnis einer menschlichen Gemeinschaft als Ganzer oder einer sozialen Schicht als Ganzer zu ihrer äußeren Umwelt beziehen.
Marçals Argument im fünften Kapitel dagegen endet bei Betty Friedan, die in ihrem Buch »Der Weiblichkeitswahn« festgestellt hatte, dass Hausfrauen nicht glücklich, sondern unglücklich sind:
»Angst, sexuelle Frustration, Verzweiflung – die wahren Gefühle dieser echten Hausfrauen standen in scharfem Kontrast zu den medial verbreiteten Bildern von glücklichen Frauen in glücklichen Vororten. (…) Unzufrieden, desorientiert, tablettensüchtig, in die Irre geführt von der Psychoanalyse, von der Gesellschaft ignoriert – das war die wahre Hausfrau.«
S. 64
Betty Friedan war in einem Exempel angewandter Ideologiekritik von der idealisierten zur empirischen Frau vorgestoßen. Diese Leistung aus dem Jahre 1963 können wir vorbehaltlos anerkennen. Aber auch mehr als fünfzig Jahre nach Friedans Pionierarbeit kommt Katrine Marçal nicht auf die Idee, in analoger Weise vom idealisierten zum empirischen Mann vorzustoßen.
Kapitel 6: Spieltheorie
Im sechsten Kapitel stellt uns die Autorin die moderne Spieltheorie und die Markteffizienzhypothese vor. Die Spieltheorie modelliert im Kern Situationen »doppelter Kontingenz«, d.h. solche Situationen, in denen das Ergebnis nutzenmaximierenden Handelns nicht nur von der Entscheidung eines Akteurs, sondern von der Entscheidung zweier Akteure abhängt, und zwar so, dass derjenige seinen Nutzen maximiert, der das Verhalten des jeweils anderen Akteurs korrekt errät. Einer der Väter der Spieltheorie, John von Neumann, war der Ansicht, dass sich menschliches Verhalten generell, also auch außerhalb von im engen Sinne ökonomischen Situationen, als Theorie rationaler Entscheidungen beschreiben ließe. Marçal bringt die Spieltheorie aber als Vorläufer von Modellen für das Verhalten von Finanzmärkten ins Spiel:
»Angespornt durch das Weltbild der Spieltheorie, fingen Ökonomen damit an, Roulette- und Würfelspiele zu studieren, um den Markt besser zu verstehen. Getreu dem Motto: Wenn die Welt ein Spiel war, war der Finanzmarkt ein großes Casino. (…) Aus diesen Prinzipien wurde allmählich die Markteffizienzhypothese (kurz EMH) geboren, welche besagt, dass sich auf Finanzmärkten der Marktpreis stets am wahren Wert einer Ware orientiert. Der Markt hat immer recht. Im Grunde können Blasen nicht entstehen, und tun sie es doch, wird der Markt sich selbst korrigieren.«
S. 75 f.
Die Markteffizienzhypothese war fehlerfrei – und zwar so genau lange, bis ein Fehler auftrat. Von einem solchen Fehler berichtet uns die Autorin aber erst im nächsten Kapitel, zu dem dieses hier nur eine Überleitung darstellt, an der wir ausnahmsweise nichts Grundsätzliches zu beanstanden haben.
Kapitel 7: Finanzmarktspekulation
Im siebten Kapitel erklärt uns die Autorin die Welt der Finanzmarktspekulationen: die Rede ist von Papiergeld, Zinsen, Optionen, Bonds, Ratingagenturen und schließlich vom Crash von Lehman Brothers, und der rote Faden sind die verschiedenen Erfindungen, mittels derer sich die Welt der Finanzmärkte immer weiter von der Wirklichkeit entfernt. Bonds zum Beispiel sind
»pure Magie. Man verlieh eine Milliarde, verkaufte das Darlehen und bekam eine Milliarde zurück, obgleich man im Grunde genommen bloß einen Batzen Schulden verkauft hatte.«
S. 86
Auch an diesem Kapitel haben wir nichts zu beanstanden. Dort, wo die Autorin es unterlässt, ihre Argumente ins Prokrustesbett der Geschlechterbeziehungen zu pressen, ist sie vergnüglich und mit Erkenntnisgewinn zu lesen.
Kapitel 8: Das empirische Scheitern des Economic Man
Im achten Kapitel erläutert uns die Autorin, wie das Modell des ökonomischen Mannes schließlich in die Kritik geraten ist. Der Rezensent möchte ergänzen: ohne, dass dazu Feministinnen befragt werden mussten. Der Untertitel des Kapitels lautet: »In dem wir sehen, dass noch nicht einmal Männer wie der ökonomische Mann sind«. Das stimmt uns zunächst hoffnungsvoll, vielleicht doch noch etwas über den empirischen Mann erfahren zu können. Immerhin lesen wir nun davon, dass auch Emotionen und kooperatives Verhalten als Faktoren für eine brauchbare ökonomische Theorie gefordert werden. Leider finden diese Einwände keinen Zugang zu den politischen und institutionellen Schaltstellen, an denen über die Zukunft der weltwirtschaftlichen Entwicklung Entscheidungen getroffen werden.
»Mehr denn je wird die Weltwirtschaft vom Markt regiert, und in den vergangenen Jahrzehnten haben wir den Ökonomen so viel Gehör geschenkt wie nie zuvor, trotz aller Krisen.«
S. 98
Trotz grundsätzlicher und wohlbegründeter Kritik am ökonomischen Menschenbild führt diese Kritik nicht zu praktischen Konsequenzen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum wir von der Autorin auch weiterhin nichts darüber erfahren, wie der Mann, der dem ökonomischen Mann nicht entspricht, denn tatsächlich beschaffen ist.
Kapitel 9: Vergebliche Anreizsysteme
Im neunten Kapitel erläutert uns die Autorin, wie Anreizsysteme, die auf einem unzureichenden Menschenbild beruhen, zu Fehlsteuerungen menschlicher Entscheidungen führen. Sie leitet ihre Argumentation ein mit einer Schilderung jener sprachlichen Wendungen, mittels derer wir »den Markt« wie eine Naturgewalt oder wie ein lebendes Wesen beschreiben.
»Wir sind in ständiger Sorge um sein Wohlbefinden. Der Markt kann zuversichtlich, ängstlich, hitzköpfig, glücklich und auch zornig sein. Er ist eine eigentümliche Kreatur voller Gefühle. Sein Wesen ist so komplex, dass einige der renommiertesten Zeitungen der Welt rund um die Uhr damit beschäftigt sind, jede noch so kleine Gefühlsregung zu dokumentieren. Manchmal denkt und reflektiert der Markt (…) Mal ist er bockig und zerknirscht (…) Mal aggressiv und brutal (…) Und bisweilen traurig (…) Wenn der Markt ganz besonders aufgebracht ist (klinisch depressiv oder in panischer Angst vor dem freien Fall), bringt ihm die Gesellschaft Opfer. In Form enormer Geldsummen, mit denen die Ökonomie ›stimuliert‹ werden soll. (…) ›Bei all dem Gefasel von Stimulation, möchte man beinahe glauben, der Markt sei eine riesige Klitoris‹, schreibt die amerikanische Journalistin Barbara Ehrenreich.«
S. 105 f.
Aber nicht nur der Markt wird »stimuliert«, sondern auch einzelne Marktteilnehmer, und auch menschliches Verhalten außerhalb von Märkten unter der Annahme, es sei konsequent von rationalen Entscheidungen angetrieben. So karikiert Marçal beispielsweise eine Sprache, die auch intime Partnerschaften in eine Bilderwelt der rationalen Wahl einordnet, wie zum Beispiel im Buch »Mehr Sex, weniger Abwasch« von Jenny Anderson und Paula Szuchman, in dem das fiktive Paar Howard und Jen für die konkreten Beispiele herhalten muss.
»Die Sexualität wurde von einem Ort des Spielens und der Begegnung zu einem Belohnungssystem. Howard wurde in eine Art bizarres Kind verwandelt, das mit Sex belohnt wird, damit es zu quengeln aufhört. Jens Körper ist nicht länger ein Teil ihrer Person, sondern ein Gebrauchsgegenstand, den sie einsetzt, um andere Menschen bei Laune zu halten.«
S. 109
Wir bekommen einige Beispiele genannt: die Prämie für Rattenschwänze im pestgeplagten Hanoi zu Beginn des 20.Jahrhunderts, die nicht zu einer Abnahme der Zahl von Ratten, sondern zu einer dramatischen Zunahme der Zahl schwanzloser Ratten führte, die zu dem Zweck gezüchtet wurden, die Prämie einzustreichen. Oder der israelische Kindergarten, in dem Eltern ihre Kinder nicht rechtzeitig abholten, woraufhin ein Bußgeld eingeführt wurde: mit dem Effekt, dass die Unpünktlichkeit der Eltern noch zunahm, weil sie das Bußgeld als einen Preis fürs Zuspätkommen betrachteten, der das Verpflichtungsgefühl vollständig eliminierte. In ähnlicher Weise fehlgesteuert sind viele Anreize im Finanz- und Wirtschaftssystem, angefangen mit Boni für Manager. Eine Prämie für gute Quartalsabschlüsse garantiert kein Bemühen um langfristiges Wachstum eines Unternehmens.
»Der ökonomische Mann stürzt sich blindlings in eine Situation und wirft dabei alle moralischen, emotionalen und kulturellen Aspekte über den Haufen, die, wie sich im Nachhinein herausstellt, grundlegende Voraussetzungen dafür waren, dass die Wirtschaft funktionieren und gedeihen konnte.«
S. 112
Kapitel 10: Krankenpflege
Im zehnten Kapitel geht es um Krankenpflege am Beispiel von Florence Nightingale. Wie auch noch der amerikanische Bürgerkrieg zählte der Krimkrieg zum »medizinischen Mittelalter«, was bedeutete, dass die Versorgung verwundeter Soldaten vom variablen Können der Feldscher genannten Chirurgiehandwerker abhängig war und darüber hinaus nicht systematisch organisiert wurde, was je nach Situation verheerende hygienische Bedingungen erzeugte. Florence Nightingale war die Pionierin, die das änderte. Aber das System, das sie einführte, beruhte nicht nur auf Nächstenliebe, sondern auf angemessener Entlohnung des Pflegepersonals.
»Gott und Mammon sind keine Feinde, konstatierte Florence Nightingale. Dass die Krankenschwestern ihre Arbeit im Auftrag Gottes ausführten, hieß nicht, dass sie nicht dafür entlohnt werden sollten. (…) Wir sind gefangen in der Vorstellung, dass man etwas entweder für Geld oder aus Nächstenliebe tut. Eine Vorstellung, die eng verknüpft ist mit unserem Bild der Geschlechterverhältnisse. Männer werden angetrieben von ihrem Eigeninteresse, und Frauen sind das ›andere‹, das die Gesamtheit zusammenhält.«
S. 119
Der Grund dafür, dass beides zusammenpasst, ist:
»Wir möchten uns in dem, was wir tun, respektiert und bestätigt fühlen, und Geld ist eine Möglichkeit, uns diese Bestätigung zu geben.«
S. 121
Die These, auf die Marçal hinauswill, lautet, dass es keinen Grund gibt, fürsorgliche Tätigkeit davon auszuschließen, zugleich eine bezahlte Tätigkeit zu sein. Wenn man Krankenpflegepersonal als Erwerbstätige bezahlen kann, dann auch alle, die in der sogenannten »Reproduktionssphäre« inklusive der Familie tätig sind.
Kapitel 11: Neoliberalismus und Einkommensschere
Das elfte Kapitel möchte uns daran erinnern, wie weit die real existierende Marktwirtschaft von dem zuletzt geäußerten Gedanken entfernt ist. Die Rede ist von Ronald Reagan und Margaret Thatcher und ihrer ökonomischen Doktrin, dem »Neoliberalismus«.
»Die Gewerkschaften sollten gezügelt, der Staat verkleinert und die Ökonomie des ehemaligen Empires reaktiviert werden. Sie hatten sich gesucht und gefunden – Thatcher und Reagan. Der Beginn einer neuen Ära. Der Neoliberalismus, der bis dato eine obskure politische Doktrin gewesen war, wurde nun ins Zentrum der Projekte Thatchers und Reagans gerückt. ›Gesellschaft – so etwas gibt es nicht‹, tat Thatcher kund. Nur freie Individuen und deren Familien. Keine Gemeinschaft, kein Kollektiv.«
S. 125
Immer noch verzichtet die Autorin darauf, ihre Schilderung wie in den ersten Kapiteln ihres Buches in die Genderperspektive zu pressen. Das erlaubt es ihr ein weiteres Mal, die Volten der ökonomischen Theorie plausibel und lesbar zu schildern. So zum Beispiel das moralische Menschenbild des Neoliberalismus:
»Ambitionierte Wohlfahrtsprogramme zerstören den Markt nur. Sicherheit betäubt die Menschen. Warum sollten sie dann noch arbeiten? (…) Bekommen sie, was sie brauchen, ohne zuvor darum kämpfen zu müssen, haben sie keinen Anlass, sich zu disziplinieren. Demnach wäre es schlicht unmoralisch, den Menschen etwas ausgehend von ihrem Bedarf und nicht aufgrund ihrer Leistung zu geben. Das nämlich wäre ihnen ein Anreiz, ihr Potential nicht gänzlich auszuschöpfen, folglich täte man ihnen keinen Gefallen. (…) Die Diszipliniertesten siegen und verdienen sich ihren Erfolg. Wer viel Geld macht, beweist, dass er ein redlicher Mensch ist, und Steuersenkungen für Spitzenverdiener scheinen angebracht. Ausbleibender Erfolg hingegen wird als Zeichen für mangelhafte Disziplin gedeutet. Folglich wäre es nur gerecht, wenn die Undiszipliniertesten den Diszipliniertesten dienen. Im lausig bezahlten Dienstleistungssektor wird es jede Menge Jobs für sie geben.«
S. 126 f.
Das Resultat dieser Politik bestand darin, etwas herbeizuführen, von dem Neoliberale nicht müde werden zu beteuern, dass sie es verabscheuen: Umverteilung! Es war allerdings keine Umverteilung von den »Leistungsträgern« zu den »Schmarotzern«, weshalb ihnen der Effekt auch nicht anstößig erschien. Es war eine Umverteilung von unten nach oben, von der Masse der Bevölkerung, die sich mit sinkenden oder stagnierenden Löhnen abfinden mussten, zu einer Menge von Superreichen, deren »Leistung« in der Vermehrung ihres Vermögens, von großzügigen Steuererleichterungen kaum geschmälert, an den Finanzmärkten bestand, also in dem, was das 19. Jahrhundert als »Kuponabschneiden« bezeichnet hatte.
»Der ökonomische Mann ist der Superheld unserer Welt. Er verkörpert ihr Bestreben und ihre Legitimierung zugleich. Er ist die Geschichte, durch die sie sich selbst einen Sinn gibt und ihre Botschaft predigt: Wenn die Reichen reicher werden, ist allen geholfen. Möge Gott uns beistehen. Der ökonomische Mann ist derjenige, der uns sagt, es gäbe keine Alternative, und solange wir versuchen, wie er zu sein, wird es auch keine Alternative geben.«
S. 133
Kapitel 12: Das neoliberale Menschenbild
Das zwölfte Kapitel ist das einzige in Marçals Buch, in dem wohl eher aus Versehen ein Beispiel genannt wird, in dem auch Männer als Opfer vorkommen: die Bauwirtschaft des Emirats Dubai am Persischen Golf. Die boomende Stadt wurde von ausländischen Gastarbeitern erbaut, die am Rande dieser Stadt unter ärmlichsten Bedingungen leben müssen. Bevor freilich unser Mitgefühl für männliche Opfer überhandnimmt, wird sogleich an die zahlreichen ausländischen Prostituierten erinnert,
»deren Körper von der Mafia in den Luxushotels der Stadt verkauft wurden, um ausländische Investoren anzulocken.«
S. 134
Dennoch akzentuiert Marçal im zwölften Kapitel noch einmal eine sehr wichtige und nachvollziehbare Pointe ihrer Kritik am ökonomischen Menschenbild: sie weist darauf hin, dass die neoliberale Ideologie die Realität, von der sie behauptet, dass sie die Grundlage ihres Menschenbildes und ihrer Theorien sei, allererst zu erzeugen versucht:
»Einerseits wird davon ausgegangen, der Mensch sei von Natur aus wettbewerbsorientiert, andererseits soll die Politik diesen Wettbewerb durch Anreize anfachen: Deregulierungen, Steuersenkungen und Ausverkäufe. Einerseits wird davon ausgegangen, der Mensch sei von Natur aus an Reichtum interessiert, andererseits sollen die Steuersätze gesenkt werden, damit sich reich werden überhaupt lohnt. Weiterhin wird behauptet, dass Konkurrenz die Basis jedweder sozialer Beziehungen sei. Dennoch sind es ebendiese Wettbewerbsbeziehungen, die von der Politik angeregt und geschaffen werden sollen. Es handelt sich eben nicht um einen natürlichen Zustand, sondern um etwas, das es zu konstruieren und aufrechtzuerhalten gilt. (…) Der Neoliberalismus will die Politik nicht abschaffen – er will sie dem Markt unterwerfen. Neoliberale vertreten keineswegs den Standpunkt, man solle die Wirtschaft in Ruhe vor sich hin köcheln lassen, ganz im Gegenteil. Um die Wirtschaft leiten, fördern und beschützen zu können, gelte es vielmehr, soziale Normen zu etablieren, die Konkurrenz und rationales Handeln stimulieren. Die neoliberale Theoriearbeit fordert die Politik nicht dazu heraus, die Finger vom Markt zu lassen, sondern seine Bedürfnisse zu befriedigen.«
S. 135 f.
Marçal rezipiert hier das 2015 erschienene Buch »Die schleichende Revolution« der Politikwissenschaftlerin Wendy Brown, welches den Beweis darstellt, dass Frauen kluge Bücher schreiben können, obwohl sie die Lebensgefährtin von Judith Butler sind. Brown wiederum stützt sich auf Michel Foucaults Jahrgangsvorlesungen am Collège de France von 1978/79: »Die Geburt der Biopolitik«. Was in Browns Buch drinsteht, fasst eine Rezension der »Frankfurter Allgemeinen« zusammen:
»Tatsächlich ist der Neoliberalismus nicht einfach das Paket ökonomischer Maßnahmen, als das er sich ausgibt. Er ist eine intellektuelle Theorie (und vor allem eine politische Praxis), der es darum geht, das Denken der Menschen zu prägen, nicht nur deren Handeln. (…) Erst diese Institutionalisierung seines Programms, erst das Vertrauen in seine erfolgreiche Verinnerlichung als Form der Rationalität, erlaubt dem Neoliberalismus, die Freiheit von staatlicher Intervention zur zentralen Forderung zu erheben. (…) Um aber die Voraussetzungen zu schaffen und aufrechtzuerhalten, von denen der Wettbewerb lebt, kann er auf den Staat gar nicht verzichten … . Die Freiheit, die der Markt benötigt, ist nur auf Basis ›permanenter Intervention‹ möglich.«
Aufgrund dieses Zusammenhangs von Markt und Staat greift auch der Einwand jener Armee der wahren Schotten nicht, die sich unweigerlich erhebt, sobald man etwas unter dem Begriff »Neoliberalismus« kritisiert: »Aber das ist doch gar kein echter Neoliberalismus!«
Wendy Brown räumt tatsächlich ein, dass das Zusammenfließen neoliberaler Ideologie mit einem als »Governance« verstandenem staatlichen Handeln in den ursprünglichen Ideen Friedmans und Hayeks nicht vorkommt. Dennoch ist neoliberale Governance keine traditionelle Ausübung staatlicher Souveränität. Sondern sie ist eine Form der Kooperation staatlicher Instanzen mit Vertretern marktwirtschaftlicher Akteure, durch die die Inhalte von Politik auf die »Bedürfnisse des Marktes« ausgerichtet werden – stets unter dem Schirm des Versprechens, dass dadurch, und nur dadurch, ein entscheidender Durchbruch in der Erwirtschaftung von allgemeinem Wohlstand möglich werde. Ein beliebter Einwand gegen diese Kritik besteht darin, das Anwachsen der zum Crash von 2008 führenden Immobilienblase der Politik als irrationales, weil Marktrationalität verletzendes Staatshandeln anzulasten, da der private Wohnungsbau auch bei geringen Einkommen staatlich gefördert worden sei.
Tatsächlich ist aber der Ursprung dieser Politik, der amerikanische Community Reinvestment Act von 1977, wesentlich älter als der Einstieg in die Immobilienblase, und zweitens lag der größte Anteil an der spekulativen Expansion der Hypothekenmärkte nicht bei den staatsnahen Banken Fannie Mae und Freddie Mac, sondern bei privaten Kreditgebern (vgl. Roubini/Mihm 2010, S. 75 f.) Es ist das ideologische Dogma von der »Markteffizienz«, welches die staatliche Souveränität unterläuft, indem sie sie auf dem Wege eines Putsches scheinbar neutraler Marktmetriken gegen scheinbar ideologische Normen- und Wertdiskurse delegitimiert.
Aber halt! Wir schweifen ab! Dies ist keine Rezension von Wendy Browns »Undoing the Demos«, sondern von Katrine Marçals »Who Cooked Adam Smith’s Dinner«! Wenn das gewichtigste Argument in Marçals Buch jedoch gar nicht von ihr entwickelt wurde, stellt sich die Frage, worin dann eigentlich dessen Originalität besteht. Die Autorin fasst Browns Argument treffend und verständlich zusammen. Aber ihre eigene These ist eine andere.
Kapitel 13: Trugbild Autonomie
Marçal bedient sich der Kritik neoliberaler Ideologie, um ihre eigene Kritik des ökonomischen Menschenbilds plausibel zu machen. Dass dieses Menschenbild keine anthropologische Realität abbildet, erscheint uns plausibel. Man könnte sogar sagen, dass es sich nach dem Scheitern des real existierenden Sozialismus um die allein übrig gebliebene liberale Variante des Versuchs handelt, auf ideologischer Grundlage einen »Neuen Menschen« zu erschaffen. Aber wie sieht Marçals eigenes Bild dieser Realität aus? Im dreizehnten Kapitel greift sie die mit dem economic man verbundene Vorstellung der Autonomie an und illustriert das durch die Embryonenfotografie von Lennart Nilsson:
»Der Embryo auf Nilssons Fotografien nuckelt am Daumen und starrt hinter geschlossenen Augenlidern ins Leere. Er ist umgeben von einem finsteren All, und irgendwo in der Ferne schwebt der Mutterkuchen wie eine Raumstation. Das war ein Schöpfungsmythos über freie Individuen, der ganz vortrefflich in seine Zeit passte. Veröffentlicht wurden die Bilder im Jahre 1965.«
S. 145
Doch die schönen Bilder vom autonom schwebenden Fötus haben einen gravierenden Schönheitsfehler: sie sind nicht mehr am Leben.
»In Wahrheit hatte Nilsson für die meisten Bilder tote Embryonen und Föten fotografiert. Das hatte ihm ermöglicht, mit Licht, Hintergründen und verschiedenen Einstellungen zu experimentieren. Heraus kamen fantastische Fotografien. Doch all das, was in Szene gesetzt worden war, um das Leben zu schildern, war in Wirklichkeit tot.«
S. 146
Der Verwendungszweck dieser Analogie liegt auf der Hand: die Unabhängigkeit des ökonomischen Mannes ist eine anthropologische Fiktion, die in diametralem Gegensatz zur anthropologischen Realität steht: »In seinem natürlichen Zustand steht der Mensch in totaler Abhängigkeit zu anderen.« (S. 150) Der Begriff der Abhängigkeit leitet zum nächsten Kapitel über.
Kapitel 14: Flucht vor dem Körper
Im vierzehnten Kapitel macht Marçal nunmehr endlich explizit geltend, dass der idealisierte Mann der ökonomischen Theorie und der empirische Mann der neuzeitlichen Geschichte einundderselbe Mann seien. Sie kehrt damit zu der Denkfigur zurück, die den roten Faden in ihrem Buch ausmacht: Simone de Beauvoirs These, dass die Frau das »andere Geschlecht« sei: dasjenige Geschlecht, das sich relational aus der Differenz zum männlichen Geschlecht bestimmt und damit negativ als alles das definiert wird, was der Mann nicht ist.
»Nur die Frau hat ein Geschlecht. Der Mann ist menschlich. Nur eines der Geschlechter existiert. Das andere ist eine Variante, eine Spiegelung, eine Ergänzung. (…) Der Frau wird nur dann Zutritt in die ökonomisch und politisch als wichtig erachteten Kategorien gewährt, wenn sie zuvor ihren Körper ablegt. Die Vorstellung, die Frau sei wertvoll, weil sie wie der Mann ist, ist eine Art ›Entlassung auf Bewährung‹.«
S. 154 ff.
Der Übergang von idealisierten zum empirischen Mann ist ein psychologischer: der reale Mann ist jemand, der aus inneren Beweggründen dem Autonomieideal der ökonomischen Theorie hinterherjagt:
»er hat sehr wohl Gefühle, Tiefe, Ängste und Träume, mit denen wir uns sehr stark identifizieren können. (…) Dass das Verhalten des ökonomischen Mannes nahezu karikaturesk einfach gestrickt ist, heißt nicht, dass er nicht aus tieferen inneren Konflikten heraufbeschworen worden ist. (…) Und weil seine Identität vor allem über Konkurrenz definiert wird, steht sie in einer vollständigen Abhängigkeitsbeziehung. (…) Er ist aggressiv und narzisstisch, in einem ständigen Konflikt mit sich selbst, der Natur und anderen Menschen begriffen. Er glaubt, nur Konflikte könnten die Dinge in Bewegung setzen. (…) Er ist ein Mann auf der Flucht.«
S. 158 f.
Und der Fluchtpunkt dieser Flucht ist das Ideal der Unabhängigkeit, welches eine besondere Anziehungskraft begründet, aufgrund derer wir an die Wahrheit des homo oeconomicus glauben wollen.
»Der ökonomische Mann befreit uns von den Dingen, die wir fürchten: Körper, Gefühle, Unmündigkeit, Angst und Schwäche. (…) Es gibt keine Ungleichheit, keine Schwäche, nichts, wovor man sich fürchten müsste. (…) Der ökonomische Mann … ist ein Symptom jener Facetten der Realität, die er auszumerzen versucht: Körper, Gefühle, Abhängigkeit, Unsicherheit, Schwäche. Jene Facetten, die die Menschheit seit Jahrtausenden mit der Frau assoziiert. Damit er behaupten kann, es gäbe sie nicht. Und warum? Weil er mit ihnen nicht umzugehen weiß.«
S. 160 ff.
Das ist Marçals Anthropologie des Mannes: ein Defizitwesen, das aus der inneren Schwäche heraus, keine Abhängigkeit ertragen zu können, zu Verleugnungen und Überkompensationen greift, zu deren Opfer die Frauen dieser Welt werden. Denn darauf läuft die Argumentation im nächsten, dem letzten argumentativ substanziellen Kapitel hinaus: die vom ökonomischen und empirischen Mann erzeugte Ungleichheit ist eine dominant geschlechtsspezifische Ungleichheit.
Kapitel 15: Erneut das Patriarchat
Marçals Theorie der modernen Gesellschaft ist eine weitere Theorie des Patriarchats. Die Grunddimension sozialer Ungleichheit in der globalisierten Moderne folgt ihr zufolge der Geschlechtskategorie.
»In einer Welt, in der rund 70 Prozent der ärmsten Menschen weiblich sind, und Frauen in der neuen globalen Superelite, die sich in der oberen Stratosphäre der Weltwirtschaft herausgebildet hat, im Prinzip nicht existieren, spielt das Geschlecht offenkundig sehr wohl eine Rolle. (…) In einer Welt, in der Frauen weniger verdienen, unter schlechteren Bedingungen arbeiten und den Großteil unbezahlter Arbeiten verrichten, von denen dann behauptet wird, sie hätten mit Wachstum nichts zu tun und in der ökonomischen Statistik nichts verloren. In einer Welt, in der Frauen von Normen, Kultur und Wertvorstellungen unterdrückt werden, nur weil sie Frauen sind, derweil die Wirtschaftswissenschaften behaupten, dass Normen, Kultur und Wertevorstellungen ökonomisch irrelevant seien und die Ökonomie völlig frei von all diesen Dingen sei. Der neutrale Inbegriff der wahren Natur des Menschen.«
S. 167 f.
Die Einseitigkeit dieser Bilanzierung ist atemberaubend. Warren Farrells »Myth of Male Power« ist bald ein Vierteljahrhundert alt, aber nicht ein einziges seiner Argumente – der disponible, »verheizbare« Mann als Brennholz der Zivilisation, die Selbstmord- und Obdachlosigkeitsraten, die unterschiedliche Lebenserwartung, die Verdammung zu den »Todesberufen« – ist bis zu Katrine Marçal durchgedrungen. Wie sie zu den 70 Prozent weiblicher Armut kommt, schlüsselt sie nicht auf. Nirgends in ihrem Buch berücksichtigt sie Transferzahlungen aus männlichen Einkommen oder männliche Beiträge zum Familieneinkommen. Hausarbeit gilt ihr prinzipiell als »unbezahlt«, weil sie kein selbständiges Erwerbseinkommen der Frau begründet. Über die tatsächliche Verwendung des von Männern erwirtschafteten Einkommens denkt sie in keinem Absatz nach.
Marçals feministische Kritik des ökonomischen Mannes und der modernen Gesellschaft beruht auf und funktioniert konstitutiv durch Ignoranz – durch eine flächendeckende Ignoranz und ein umfassendes Hinwegsehen über die Kosten, welche Männer für die Teilnahme an der menschlichen Zivilisation zu begleichen haben. Ihre Anwendung der Beauvoirschen Denkfigur vom »Anderen Geschlecht« ist eine mindestens fahrlässige, wenn nicht billigend in Kauf genommene Eskamotage jeglicher Klassenaspekte sozialer Ungleichheit. Ihre Behauptung, Frauen würden in der globalen Superklasse »im Prinzip nicht existieren«, weil sie unter den Konzernvorständen und Milliardären unterrepräsentiert sind, ist eine ziemlich dreiste Ignoranz der Tatsache, dass die Frauen dieser Superklasse diejenigen sind, die das Geld dieser Konzernvorstände und Milliardäre großzügig ausgeben und im Scheidungsfall großzügig einstreichen.
Texte wie »Machonomics« sind Industrieprodukte vom Fließband: Produkte einer feministischen Bewusstseinsindustrie, der nicht mehr zugemutet wird, kritische Arbeit am Begriff und an analytischen Modellen zu leisten. Die Form, welche feministische Stereotype aus dünnen Blechen stanzt, gehört zum geistigen Besitzstand eines Establishments, sie ist ebenso kanonisch wie dogmatisch. Diese Ignoranz männlicher Kosten wird ihrerseits nicht begründet, sondern durch ein Axiom legitimiert: dass Männer in »Jahrtausenden patriarchaler Herrschaft« durchgehend privilegiert und Frauen durchgehend unterdrückt gewesen seien. Diese Glaubenswahrheit wird nicht in Frage gestellt, und somit erscheint jede Geschichtsklitterung als legitimer Akt der Selbstbehauptung.
Das zieht sich bis in den Bereich der privaten Forderungen: weil der Mann als privilegiert gilt, wird die von ihm erbrachte Arbeit als selbstverständlich angesehen. Jede beliebige weibliche oder feministische Forderung an einen Mann oder Männer gilt als Einforderung einer fälligen Bringschuld. Weil er als »Patriarch«, »Macho«, »privilegierter WHM«, »hegemonialer Mann« und dergleichen mehr angesehen wird, und weil das Männliche als das Neutrale und Objektive gelte, erscheint die männliche Position als voraussetzungslos.
Hier zeigt sich ein Grundwiderspruch feministischer Theorie: einerseits wird die Voraussetzungslosigkeit männlichen Daseins als Mythos und Ideologie kritisiert und auf die implizite Voraussetzung der weiblichen Reproduktionsarbeit verwiesen. Zugleich aber wird imaginiert, – und hier ist die feministische Theorie in ihrem innersten Wesen narzisstisch angelegt – dass der Bezug des Mannes auf die Frau sein einziger Weltbezug sei. »Who cooked Adam Smith’s Dinner?«, heißt Marçals Buch im englischen Original: was immer der Mann ist und leistet, kann er nur sein und leisten, weil jemand anderes – die Frau – sein Abendessen kocht.
Ich möchte abschließend darstellen, was ich für den Kern des an Marçal exemplifizierten feministischen Denkfehlers halte: die Perspektive der Beauvoirschen Denkfigur vom »anderen Geschlecht«. Wie ein strukturalistischer Gedanke »avant la lettre« ist die Beauvoirsche Geschlechterbeziehung relational: die Frau ist das, was der Mann nicht ist, und umgekehrt. Dieser Gedanke schreibt sich fort bis zu Judith Butlers Versuch, sogar das biologische Geschlecht auf eine binäre Opposition, auf eine zweistellige Relation zu gründen. Die große Leerstelle dieser Art feministischen Denkens ist die äußere Umwelt der Gesellschaft, gegen die sich Männer und Frauen gemeinsam behaupten müssen.
Was der Mann ist, ist er nicht aus intrinsischen psychologischen Gründen, sondern weil er eine Funktionsstelle an der Außengrenze der gemeinsamen Gesellschaft besetzt. Wie sich diese Gesellschaft an ihrer Außengrenze bewährt, hat objektive Bedeutung für ihren Überlebenserfolg. Dass der Mann mit dem Objektiven identifiziert wird, liegt daran, dass er – jedenfalls in der evolutionsbiologisch und evolutionspsychologisch entstandenen ursprünglichen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung – die Auseinandersetzung mit diesem Objektiven stellvertretend auf sich nimmt. Mit dem »Objektiven« ist die Position des Mannes darum identifiziert, weil der Mann bei einer Fehlanpassung seines Verhaltens an die Lebensbedingungen an der Außengrenze der Gesellschaft dafür mit Invalidität und Tod bezahlt.
Aus Marçals Gleichnis von Adam Smiths Abendessen sind daher bereits alle diejenigen Männer ausgeklammert, die niemals mehr zum Abendessen zurückkehren werden, weil sie in ihrer Tätigkeit an der Außengrenze der Gesellschaft ihr Leben eingebüßt haben. Für diesen Außenbezug der männlichen Tätigkeit ist Marçals feministische Denkfigur nicht nur blind, sondern in dieser Blindheit zugleich auf konstitutive Weise narzisstisch.
Der tote Mann ist kein Teil der feministischen Rechnung, er ist gleichsam das neutrale Element der feministischen Arithmetik, denn er hat sich damit genau jener zweistelligen Relation von Frau und Mann entzogen, die aus narzisstischer und feministischer Perspektive den Nabel des Universums darstellt. »Auf Massengräbern stehen keine Kreuze, an ihnen weinen keine Witwen«, singt Wyssozkij – der tote Mann ist für immer in der Welt der Männer geblieben. Um meinen Blogpost mit einer Provokation zu beschließen: die Eigengesetzlichkeit des männlichen Standorts an der Außengrenze der Gesellschaft ist von jenem nationalkonservativen Dichter pointiert beschrieben worden, den Herbert Grönemeyer in dem Film »Das Boot« zitiert – Rudolf Bindings Schlacht – das Maß:
»Einmal vor Unerbittlichem stehn, | wo Gebete entrechtet, Gewinsel zu Gott | lächerlich ist, | wo keines Mutter sich nach uns umsieht, | kein Weib unsern Weg kreuzt, | wo alles ohne Liebe ist, | wo nur die Wirklichkeit herrscht | grausig und groß, | Unvergesslich und tiefer | rührt es ans Herz des Menschen | als alle Liebe der Welt.«
Das ist nicht nur die nationalkonservative Heroisierung des einsamen männlichen Opfers, sondern zugleich auch eine anthropologische Selbstbeobachtung – und in einer unreflektierten Tiefenschicht stellt die feministische Ignoranz des toten Mannes genau hierzu das Komplement dar. Die feministische Perspektive kann die extern induzierte Funktion der »männlichen Objektivität« nicht analytisch fassen, weil sie durch die männliche Funktionsstelle von ihr nicht ausgegrenzt, sondern abgeschirmt wurde – und genau darin macht sie die »traditionelle Männlichkeit« zur Voraussetzung ihres eigenen, vermeintlich kritischen Denkens.
Darum erhebt sich die Stimme des Feminismus erst in der Abenddämmerung der Zivilisationsgeschichte: in dem Moment, indem die Naturunterwerfung des Menschen von der Tragödie zur Farce geworden ist – in dem Moment, in dem sich die Menschheit den Luxus feministischer Kritik leisten kann, weil das Diktat des existenziellen Mangels schließlich durchbrochen wurde.
Literatur:
- Brown, Wendy (2015), Die schleichende Revolution. Wie der Neoliberalismus die Demokratie zerstört. Berlin: Suhrkamp
- Foucault, Michel (2006), Die Geburt der Biopolitik. Geschichte der Gouvernementalität II. Vorlesungen am Collège de France 1978-1979. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
- Marçal, Katrine (2016), Machonomics. Die Ökonomie und die Frauen. München: C. H. Beck
- Roubini, Nouriel; Mihm, Stephen (2010), Crisis Economics. A Crash Course in the Future of Finance. London: Allen Lane
- Staun, Harald, Das Gespenst der totalen Durchökonomisierung, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 26.10.2015

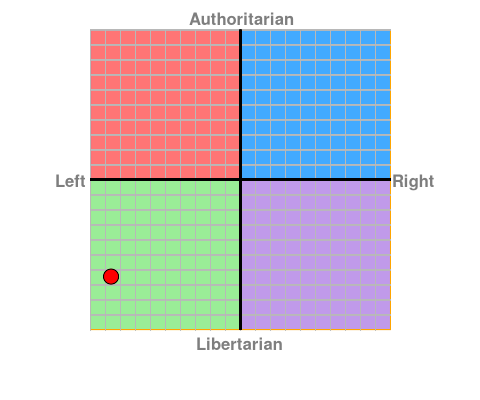
Schreibe einen Kommentar