(20. Oktober 2014)
Vorbemerkungen: Dieser Blogpost hat den Charakter eines Fachartikels oder »technical papers« und ist daher möglicherweise nicht immer leicht zu lesen. Auch wenn ich mich bemüht habe, Fachjargon zu vermeiden, habe ich im Zweifelsfall der Ausdrucksabsicht Vorrang vor der Einfachheit gegeben.
Einzelne, ggf.längere Zitate haben nicht die Funktion, eine Beleglast zu tragen (das kann nur in Auseinandersetzung mit der referenzierten Literatur geschehen), sondern sollen die Pointe bestimmter Gedankengänge illustrieren – insbesondere dann, wenn ihre Paraphrase auf ein wörtliches Zitat hinausliefe.
Ein erheblicher Anteil des hier betriebenen Begründungsaufwands entfällt auf die Positionierung zur Soziobiologie, wobei ich grundsätzlich der Absicht folge, deren Positionen, soweit sinnvoll, in eine »integrative« Perspektive einzubeziehen.
(1) Wenn wir daran gehen, aus der wissenschaftlichen Literatur eine naturalistische Grundlegung der menschlichen Kultur zu kompilieren, bietet es sich an, bei der neuronalen Plastizität des menschlichen Gehirns zu beginnen. Die Frage nach Freiheit und Determinismus des menschlichen Verhaltens findet hier das Kernstück ihrer Beantwortung. Das menschliche Gehirn und sein funktioneller Aufbau ist das entscheidende Resultat der Hominisierung, der zum anatomisch modernen Menschen führenden Evolution. Gehirnforscher wie Singer (Singer 2002: 44, 2003: 97 f.) und Roth (Roth 2003: 81) und Soziobiologen wie Wuketits (Wuketits 1997: 166) und wohl auch Wilson (Wilson 2014: 291) sowie Paläoanthropologen wie Mithen (Mithen 1998: 171 ff.) sind sich darin einig, dass sich unabhängig von fortlaufenden genetischen Anpassungen des Homo Sapiens der strukturelle Aufbau und die funktionelle Ausstattung des menschlichen Gehirns seit dem Zeitraum von 80.000 bis spätestens 30.000 Jahren vuZ nicht mehr verändert hat, einem biologischen Lehrbuch zufolge sogar seit »weit über 100.000 Jahren« nicht mehr (Thompson 2001: 444). Laut Hermann Parzinger »besteht inzwischen in der Forschung weitgehende Einigkeit, dass sich der Homo sapiens des Jungpaläolithikums ab 40.000 vor heute in seinen kulturellen Fähigkeiten nicht mehr grundlegend vom heutigen Menschen unterschied.« (Parzinger 2014: 62) Höhlenmenschen und Justizbeamte haben die gleiche Kapazität für Kultur (Wuketits), Kinder der jüngeren Altsteinzeit könnten in modernen Kulturen zu Wissenschaftlern oder Geigenvirtuosen heranwachsen (Singer) und »Einstein hat die Relativitätstheorie mit einem Steinzeit-Hirn ersonnen.« (Welsch 2012: 729)
(2.1) Genetisch determiniert sind der anatomische Aufbau einzelner Neurone sowie das Größenwachstum des Gehirns, nicht aber die Muster neuronaler Aktivität. Erstens ist die Anzahl der menschlichen Gene um mehrere Größenordnungen unzureichend für die immense Größe des neuronalen Zustandsraums, der von ihnen kodiert werden müsste. (Schurz 2011: 198) Zweitens reagieren neuronale Aktivitäten auf andere neuronale Aktivitäten – obwohl sich das einzelne Neuron deterministisch verhält, sind die Muster ihres Zusammenwirkens indeterministisch, da sie von lokalen Parametern wie der Anzahl hemmender und erregender Synapsen und der Ort ihres Ansetzens auf der Länge eines Neurons bestimmt werden (Roth 2003: 123) und der aus dieser Variabilität hervorgehende potentielle Zustandsraum »hyperastronomisch« groß ist. (Doidge 2007: 294) Die neuronale Aktivität stellt daher einen in sich geschlossenen, selbstreferentiellen und zirkulären Prozess dar, dessen Zustände weder durch irgendeine Art von genetischer Programmierung noch auch durch direkte Einwirkungen von Umweltreizen erzeugt werden. (Maturana 2000: 82 ff.) »Obwohl … jedes Neuron zu jedem Zeitpunkt deterministisch mit einer definiten Übertragungsfunktion arbeitet und ein definites Aktivitätsmuster in seinem Effektorbereich erzeugt, können sich die Übertragungsfunktionen und die Muster der Effektoraktivität in vielen Neuronen von einem Augenblick zum anderen verändern. (…) Kein Neuron kann eine festgelegte funktionale Rolle in der Produktion von Verhalten spielen, wenn es seine Mitwirkung fortlaufend verändern muß. Aus dem gleichen Grund kann auch eine festgelegte Anhäufung von Zellen nicht als eine funktionale Einheit des Nervensystems betrachtet werden. Nur Verhalten selber kann als funktionale Einheit des Nervensystems aufgefaßt werden.« (Maturana 2000: 39 f.) Für Doidge stellt die Plastizität des menschlichen Gehirns einen »nicht-darwinschen Weg zur Veränderung biologischer Strukturen« dar. (Doidge 2007: 294-296) Das Aktivitätsmuster des neuronalen Prozesses wird von Umweltreizen moduliert, nicht aber erzeugt, Umweltreize werden also in ein bestehendes Aktivitätsmuster eingepasst und können nur innerhalb eines präexistenten Zustandsraums verarbeitet werden, denn ein bestimmter Anteil der neuronalen Aktivität hat ausschließlich interne Referenzen und ist daher selbsterzeugend oder autopoietisch. (Maturana 2000: 106 ff.) Dies impliziert auch, dass das Nervensystem des Gehirns mit seinen eigenen internen Zuständen so interagieren kann, als ob diese Zustände unabhängige Gegenstände wären. (Maturana 2000: 49) Somit kann es auf der Grundlage von Erinnerungen an frühere Erfahrungen gedankliche, modellhafte Simulationen von Umweltverhalten und Eigenverhalten durchführen.
(2.2) Konstruktivismus: Für die »Biologen der Erkenntnis« Piaget und Maturana steht der menschliche Verhaltensspielraum durch seine Bindung an einen Organismus per se unter constraints: Für Piaget gilt, »daß … kognitive() Schemata keinen absoluten Anfang haben und sich durch zunehmende Äquilibrations- und Selbstregulationsprozesse entwickeln …, so daß die Erkenntnis letzten Endes von der biologischen Organisation als ganzer abhängt.« (Piaget 1992: 14) Glasersfeld bezeichnet den »Zwang«, dass neue Begriffe sich in ein bestehendes begriffliches Netzwerk einfügen müssen, als »Viabilität«. Der Begriff enthält eine Paradoxie: »Die Viabilität von Begriffen … wird nicht an ihrem praktischen Wert gemessen, sondern an dem Grad ihrer widerspruchs- und reibungslosen Einpassung in das größtmögliche begriffliche Netzwerk«, wodurch aus der Perspektive des Organismus »Viabilität in der Erfahrungswelt anstelle der Korrespondenz mit einer ontologischen Realität« zu einem Hauptkriterium erfolgreichen Erkennens wird. (Glasersfeld 1997: 122) Dieselbe Konsequenz zieht Maturana: »Die anatomische und funktionale Organisation des Nervensystems sichert die Synthese von Verhalten, nicht eine Repräsentation von Welt.« (Maturana 2000: 44) »Die Relevanz des durch jene Aktivitätszustände erzeugten Verhaltens für die Erhaltung des lebenden Systems ist jedoch geschichtsabhängig und kann sowohl durch die Stammesgeschichte der Art als auch durch vorausgegangene Erfahrungen des Organismus bedingt sein.« (Maturana 2000: 47)
(3.1) Eine wesentliche Fähigkeit des menschlichen Gehirns, die sich zumindest bei den Menschenaffen, aber in Ansätzen vielleicht auch bei anderen Primaten findet (Gerhard Roth hält es für »plausibel anzunehmen, daß nicht nur wir Menschen, sondern auch Affen, Hunde, Katzen usw. denken können, daß sie Geist und Bewußtsein besitzen.« (Roth 1996: 76)), besteht daher in seiner Modellierungskapazität. Damit ist gemeint, dass zwischen einem Verhaltensreiz und einer Verhaltensreaktion ein System innerer Zustände liegt, welches Aspekte der Außenwelt, aber auch die eigene Handlungsplanung intern repräsentiert. (Roth 1996: 27 ff.) Der Inhalt der subjektiven Erfahrung ist somit zum einen der Inhalt eines Modells der Welt. (Metzinger 2004: 210) Darüber hinaus ist aber auch »Intentionalität«, d.h. die eigene perspektivische Gerichtetheit auf Gegenstände der Welt, Inhalt der subjektiven Erfahrung (Metzinger 2004: 411 ff.), wodurch schließlich nicht nur ein Weltmodell, sondern auch ein bewusstes Selbstmodell gebildet wird. (Metzinger 2004: 427)
(3.2) Diese Modellierungskapazität erlaubt es den Individuen, nicht nur in einer stabilen Umwelt mit bestimmten Eigenschaften über erfolgreiche Verhaltensweisen zu verfügen, sondern diese Umwelten lassen sich auf individuelle, gegenüber den allgemeinen Eigenschaften der ökologischen Nische variable Situationen herunterbrechen, in denen das Individuum eine flexible Selbststeuerung seines Verhaltens nutzen kann. Anstatt ausschließlich auf fixe, »festverdrahtete« Reiz-Reaktions-Muster angewiesen zu sein, kann es seine konkrete Umwelt zu einem bestimmten Zeitpunkt, in einer individuellen Konstellation, intern neuronal repräsentieren und auf diese Weise Verhaltensalternativen simulieren, bevor eine gewählte Verhaltensweise zur Ausführung gelangt. Solche Verhaltensweisen sind nicht »programmiert«, sondern erlernt, d.h. sie werden in einem Gehirn, dessen Struktur und Funktionsweise genetisch festgelegt ist, unabhängig von genetischen Programmen in nach der Geburt stattfindenden Prozessen verschaltet. Darin liegt seine Plastizität und die Bedeutung von Lernprozessen, von denen einige nicht optional sind, sondern stattfinden müssen, damit das Individuum bestimmte Mindestanforderungen seiner Spezies erfüllt, wie Forschungen zur frühkindlichen sensorischen Deprivation nicht nur für Menschen, sondern auch für Affen zeigen. (Kandel 2008: 43 ff.) Mit der neuronalen Plastizität des Gehirns einher geht entsprechend die Verhaltensplastizität des jeweiligen Organismus.
(4) Eine weitere wesentliche Fähigkeit des menschlichen Gehirns, die aber bei Menschenaffen nicht oder nur sehr stark eingeschränkt vorliegt, besteht in der »Theory of Mind«: darin, dass es die Perspektiven anderer Individuen in seine Modellsimulationen einbeziehen kann, impliziert also die »Fähigkeit, Vorstellungen von Bewusstseinszuständen Dritter haben zu können«. (Voland 2013: 220) Hierzu sind auch Schimpansen im Grundsatz fähig: sie wissen, das andere Individuen (eigene Artgenossen, aber auch Menschen) Dinge sehen, Dinge wissen und in Bezug auf Dinge Folgerungen anstellen. (Tomasello 2014: 21) Diese Kompetenzen sind bei ihnen jedoch auf den Bereich kompetitiven Verhaltens eingeschränkt: sie nutzen dieses Wissen, um Artgenossen zu übervorteilen und bauen daher keine kooperativen Beziehungen auf. Stattdessen ist ihr Zusammenleben durch Dominanzhierarchien geregelt. (Tomasello 2014: 34 f.) Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass ihre »Theory of Mind« sozial rekursiv ist: ein Schimpanse, der ein praktisches Problem zu lösen hat, denkt darüber nach, was ich denke. Ein anderer Mensch dagegen denkt darüber nach, was ich denke, dass er denkt, und was ich denke, dass er denkt, dass ich denke. (Tomasello 2014: 38) Diese soziale Rekursivität der Theory of Mind bildet die Grundlage der Möglichkeit, menschliches Handeln mit den Mitteln der Spieltheorie zu modellieren – menschliche Entscheidungen sind interdependent, diese Interdependenz ist allen Beteiligten bekannt, und allen Beteiligten ist bekannt, dass sie allen Beteiligten bekannt ist (Holler/Illing 2006: 1, Axelrod 1984) Diese Rekursivität konstituiert als »doppelte Kontingenz« einen soziologischen Grundbegriff. (Luhmann 1984: 148-190) Die soziale Rekursivität ist auch gleichbedeutend mit einem Selbstbewusstsein und einem Bewusstsein von anderen, mir ähnlichen bzw. kategorial gleichen Bewusstseinen.
(4.1) Die »Theory of Mind« in der spezifischen Form des Menschen, d.h. in der spezifischen Form kooperativen Verhaltens, ist nicht auf höhere kognitive Funktionen und die Sprache eingeschränkt, sondern zeigt sich bereits bei Kleinkindern im vorsprachlichen Alter. Sie ist nicht erlernt, sondern angeboren und damit ein Resultat der Evolution zum homo sapiens. (Tomasello 2012: 19 ff.) Sie ist daher kein rein kognitives Phänomen, sondern umfasst die Entwicklung der menschlichen sozialen Bindungsfähigkeit insgesamt. Dieses geht auf die menschliche Version einer »Zunahme des Elterninvestments« (Voland 2013: 163) aufgrund »einer verlängerten Tragzeit und einer gesteigerten Unfertigkeit des Menschen bei der Geburt sowie einer langen Kindheitsphase« (Dux 1994: 188) zurück und entstammt vermutlich dem erforderlich gewordenen intensivierten Fürsorgeverhalten innerhalb der Mutter-Kind-Dyade (Dux 1994: 181 ff.), das in physiologischer und emotionaler Hinsicht durch hormonelle Steuerung abgesichert ist. (Roth 2003: 121, 371)
(4.2) Für Maturana drückt sich der sozial rekursive Charakter der menschlichen Kognition auf der Ebene des Gehirns als Entstehung konsensueller Bereiche durch strukturelle Koppelung aus. (Maturana 2000: 121 ff.) Ein konsensueller Bereich ist ein Bereich der internen Repräsentation von Objekten, in dem zwei oder mehr menschliche Organismen die internen Repräsentationen des jeweils anderen wechselseitig zu einem Kriterium der Beurteilung der eigenen Repräsentationen machen. (Maturana 2000: 124 f.) Dies geschieht im Medium der Sprache durch »Interaktionen in semantischen Begriffen«. (Maturana 2000: 197). Die rekursive, sprachlich koordinierte Modellierung des Denkens anderer Menschen bezeichnet er als konsensuellen Bereich zweiter Ordnung, also als einen Konsens darüber, dass ein konsensueller Bereich vorliegt. (Maturana 2000: 125) Maturanas eigentümlicher Sprachgebrauch wird davon bestimmt, dass er Kognition und Sprachhandeln als Aktivitäten biologischer Organismen verstanden haben will, für die jegliche kognitive oder sprachliche Operationen eine Fortsetzung und Erweiterung biologischer Prozesse darstellen. Dennoch handelt es sich um eine eigene, selbständige Ordnung der biologischen Prozesse eines Organismus, insofern sie vom »Grad der strukturellen Plastizität seines Nervensystems« abhängen. (Maturana 2000: 124)
(5) Wir entwickeln die Bedeutung von Sprache und Symbolisierung im Folgenden als Variante der Theorie des »sozialen Gehirns« (Social Brain Hypothesis). Ursprünglich entstammt diese Theorie der Beobachtung des Verhaltens von Schimpansen unter Bedingungen eines intensiven Kontakts mit Menschen, wie sie beispielsweise bei Verhaltensexperimenten, also unter Laborbedingungen vorliegen. Unter diesen Umständen vollbringen die Versuchstiere erstaunliche kognitive und kommunikative Leistungen, die sie in freier Wildbahn niemals zeigen. Die Social Brain Hypothesis folgert daraus, »Intelligenz sei die adaptive Antwort nicht auf ökologische Herausforderungen …, sondern auf soziale Herausforderungen. Intelligenz sei primär sozialen Ursprungs.« (Voland 2013: 219) In der Kulturanthropologie finden wir eine Anwendung dieser Idee auf den Menschen bereits Anfang der 60er Jahre bei Clifford Geertz: »(T)he human brain is thoroughly dependent upon cultural resources for its very operation; and those resources are, consequently, not adjuncts to, but constituents of, mental activity. (…) The human nervous system relies, inescapably, on the accessibility of public symbolic structures to build up its own autonomous, ongoing pattern of activity. This, in turn, implies that human thinking is primarily an overt act conducted in terms of the objective materials of the common culture, and only secondarily a private matter.« (Geertz 1973: 76 ff.)
(5.1) Die menschliche Sprache und ihre Produktion von Symbolen ist insofern mit der menschlichen Kognition verknüpft, als sie den Strom des Bewusstseins strukturiert, fixiert und objektiviert. Bereits Wilhelm von Humboldt konstatiert, dass das menschliche Denken zur Bildung seiner Einheiten der Vorstellung einer Bindung an sinnliche Bezeichnungen bedarf, die es in den sprachlichen Lautzeichen findet. (Humboldt 1995: 3 f.) Georg Simmel stellt in seiner »Soziologie« fest, dass keine unserer sprachlichen Äußerungen den tatsächlichen Verlauf unseres inneren Vorstellungslebens abbildhaft wiedergibt, sondern es handelt sich stets um eine »teleologisch gelenkte, aussparende und wieder zusammensetzende Umformung der inneren Wirklichkeit.« (Simmel 1992: 388) Denselben Gedanken entwickelt Ernst Cassirer im ersten, der Sprache gewidmeten Band seiner »Philosophie der symbolischen Formen«: »Das Zeichen bildet gleichsam für das Bewußtsein das erste Stadium und den ersten Beleg der Objektivität, weil durch dasselbe zuerst dem stetigen Wandel der Bewußtseinsinhalte Halt geboten, weil in ihm ein Bleibendes bestimmt und herausgehoben wird. (…) Durch das Zeichen, das mit einem Inhalt verknüpft wird, gewinnt dieser in sich selbst einen neuen Bestand und eine neue Dauer. Denn dem Zeichen kommt, im Gegensatz zu dem realen Wechsel der Einzelinhalte des Bewußtseins, eine bestimmte ideelle Bedeutung zu, die als solche beharrt.« (Cassirer 1994: I, 22) Es ist damit auch die sprachliche Äußerung, die dem Denken seinen Inhalt erst zu Bewusstsein bringt: »we don’t know what we think until we see what we say.« (Geertz 1973: 77) Sprache, Denken, Reflexion und Bewusstsein gehören daher untrennbar zusammen. Für Maturana folgt daraus, »daß das Selbst-Bewußtsein ein soziales Phänomen ist, weil die Sprache als Bereich der konsensuellen Koordinationen von Handlungen ein soziales Phänomen ist, und daß das Selbst-Bewußtsein daher nicht im Bereich der anatomischen Phänomene der Körperlichkeit der lebenden Systeme entsteht, die es erzeugen. Im Gegenteil, das Selbst-Bewußtsein liegt außerhalb des Körperlichen und gehört zum Bereich der Interaktionen als eine Art und Weise der Koexistenz.« (Maturana 2000: 205) Eine ähnliche Konsequenz zieht auch Lev Vygotskij: »Wir glauben …, dass das sprachliche Denken keine natürliche, sondern eine gesellschaftlich-historische Form des Verhaltens ist, die sich deshalb durch eine ganze Reihe spezifischer Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten, die in den natürlichen Formen des Denkens und Sprechens nicht aufzufinden sind, von Grund auf unterscheidet. (…) Damit überschreitet das Problem von Denken und Sprechen aber die methodologischen Grenzen der Naturwissenschaft und verwandelt sich in das zentrale Problem der historischen Psychologie des Menschen, d.h. der Sozialpsychologie.« (Vygotskij 2002: 170 f.)
(5.2) Die vorstehend beschriebene »konstruktivistische« Funktion der Sprache enthält zugleich eine komplementäre nicht-konstruktivistische Implikation, die leicht übersehen werden kann: Sprache ist mit dem Bewusstseinsstrom, indem sie ihn strukturiert, fixiert und objektiviert, gleichwohl und eben dadurch nicht identisch. Sie konstituiert zwar dessen reflexives Vermögen, und sei es als inneren Dialog, ihre Prägungskraft findet aber eine Grenze an dem Umstand, dass der »autopoietische« Prozess des Organismus auch vorsprachliche Ebenen der internen Verhaltensregulation aufweist. Sprachliche Strukturierung des Bewusstseins kann also die im engeren Sinne biologischen Anteile an der Ontogenese des Organismus möglicherweise überlagern, aber nicht auslöschen. Diese Aussage stellt eine nicht-sprachrelativistische Positionierung in Bezug auf das Verhältnis von Sprechen und Handeln dar: bereits dem vorsprachlichen Handeln wohnt Sinn und Intentionalität inne, und Sprechen kann, wie insbesondere die Sprechakttheorie zeigt, als eine besondere Form des Handelns gesehen werden (Austin 1980, Searle 1983). Die Strukturen des Handelns sind daher in Bezug auf die Strukturen der Sprache grundlegend. Diese Positionierung hat wiederum Konsequenzen insbesondere hinsichtlich der Einschätzung geschlechtsspezifischer Einflüsse auf das individuelle Verhalten. Generell leitet sich hieraus die Aufgabe ab, das Modell einer »vertikalen« Integration von unterschiedlichen Ebenen der Verhaltenssteuerung zu entwerfen. Dies erfolgt in Abschnitt 8.
(5.3.1) Wie entsteht im Medium der Sprache und sozial rekursiver Kommunikation Gesellschaft? Im ersten Schritt der menschlichen »Theory of Mind« entsteht geteilte Intentionalität: Menschen verstehen einander gegenseitig und vertrauen einander auf dieser Grundlage gegenseitig, verlässliche Kooperationspartner zu sein, sie bewerten einander aber auch gegenseitig danach, ob und inwieweit sie über diese kooperativen Fähigkeiten verfügen, bzw. danach, inwieweit sie ihre individuellen Kompetenzen zum Wohl der Gruppe einsetzen. (Tomasello 2014: 82) Ich äußere eine Behauptung über die Welt, bei der ich weiß, dass meine Mitmenschen mich danach beurteilen, ob diese Behauptung zutrifft, und ich tätige eine Aussage über meine Absichten, bei der ich weiß, dass meine Mitmenschen mich danach beurteilen, ob ich dieser Absichtserklärung nachkommen werde. Indem ich eine Aussage mache, treffe ich zugleich eine öffentliche Festlegung über die Wahrheit dieser Aussage. Mein Gegenüber beurteilt mich anhand der Qualität meiner Festlegungen, ich weiß, dass mein Gegenüber mich anhand der Qualität meiner Festlegungen beurteilt, und mein Gegenüber weiß, dass ich weiß, dass er mich anhand der Qualität meiner Festlegungen beurteilt.
(5.3.2) In einem zweiten Schritt wird dieses Verhalten einer gegenseitigen, an die Perspektive der zweiten Person gebundenen Bewertung generalisiert: Bewertung tritt nun in dem unspezifischen, generischen Modus einer transpersonalen Perspektive des »Man« auf. Dieser Schritt von der zweitpersonalen zur transpersonalen Perspektivität begründet eine Geltung von Verhaltenserwartungen aus beliebiger, kollektiver und damit »objektiver« Betrachtungsweise (Tomasello 2014: 87 ff.), und stellt damit zugleich die »Erfindung« der Kultur dar: Kultur ist gleichbedeutend mit der Erfindung einer auf konventionelle Normen gegründeten, allgemeingültigen »Objektivität«. »Objektiv« ist das, was aus jeder beliebigen Perspektive gilt, und auf diese Weise werden soziale Konventionen zu einer externen Realität verdinglicht. Fortan ist »Kultur« auch ein Ausweis von Gruppenzugehörigkeit: wer die Welt sieht und die Dinge tut »wie wir«, ist ein verlässliches Mitglied »von uns«. Aus der einen Seite entsteht daraus ein sozialer Konformitätsdruck, auf der anderen Seite die Fähigkeit, kulturelle Gegenstände gleichsam »ex nihilo« zu erschaffen: indem das, was allgemein anerkannt ist, als »Realität« gilt, können Akte der allgemeinen Anerkennung auch Realität herstellen.
(5.3.3) Daraus geht, mit dem Begriff von John Searle, eine selbständige »Ontologie sozialer Tatsachen« hervor. (Searle 2011) Sie beruht darauf, dass die Entstehung einer transpersonalen, »objektiven« Perspektive die soziale Welt in ein Universum »deontischer Kräfte«, Kräften des Sollens und der Pflicht, verwandelt. Wir verpflichten uns darauf, kollektiv geltende Perspektiven als Realität zu behandeln, und können darum umgekehrt mit der Festlegung auf kollektiv geltende Perspektiven kulturelle Realität erschaffen. »Deontische Kräfte sind Kräfte, die allein deshalb existieren, weil sie anerkannt sind und in ihrer Existenz akzeptiert werden. (…) Daß etwas der Fall ist, führen wir herbei, indem wir es als etwas repräsentieren, was der Fall ist. (…) Wir haben die Fähigkeit, eine Realität zu schaffen, indem wir sie als etwas Existierendes repräsentieren.« (Searle 2012: 151 f.) Searle baut auf diesen Grundgedanken sein Konzept der Status-Funktionen auf: »Eine Status-Funktion definiere ich als eine Funktion, die von einem Gegenstand (Gegenständen), einer Person (Personen) oder einer anderen Entität (Entitäten) erfüllt wird und die nur aufgrund der Tatsache erfüllt werden kann, daß die Gemeinschaft, in der sie erfüllt wird, dem betreffenden Gegenstand, der betreffenden Person oder der betreffenden Entität einen bestimmten Status zuschreibt, und daß die Funktion vermöge der kollektiven Akzeptierung oder Anerkennung des Gegenstands, der Person oder der Entität als Träger dieses Status erfüllt wird.« (Searle 2012: 160 f.) Die allgemeinste Form einer solchen Statusfunktion lautet: »X gilt in K als Y« (Searle 2012: 163), und kann beispielsweise ausgefüllt werden als »›Großer Griesgram‹ (X) gilt im Kontext der Entscheidungsfindung auf Gruppenebene (K) als Häuptling (Y).« Searle sieht in dieser Statusfunktion die Grundlage der Existenz aller »institutionellen Tatsachen« (Searle 1983: 78 ff.), also jener, die ausschließlich im Modus einer geltenden Regel existieren, aber dadurch gleichwohl das menschliche Verhalten steuern: »Alle gesellschaftlichen Institutionen des Menschen werden durch eine einzige logisch-sprachliche Operation, die stets von neuem zum Einsatz gebracht werden kann, ins Leben gerufen und in Existenz gehalten.« (Searle 2012: 108)
(5.4) Der Erwerb der menschlichen Sprache und der menschlichen kognitiven Fähigkeiten ist ein zeitlich langwieriger, rekursiver Lernprozess, in dem sprachliche und kognitive Strukturen sukzessive aufgebaut werden. Diese Vorgänge sind sehr intensiv im Rahmen der von Jean Piaget begründeten kognitiven Entwicklungspsychologie untersucht und beschrieben worden. Piaget ist dafür bekannt, ein empirisch fundiertes Stadienschema des »Erwachens der Intelligenz beim Kinde« vorgelegt zu haben, das in wesentlichen Hinsichten auch heute noch gültig ist. (Berk 2011: 22 f.) Da uns hier nicht die Details seines Stufenschemas, sondern seine Auffassung des Verhältnisses von »Biologie und Erkenntnis« interessieren, müssen wir uns zunächst ein längeres Zitat von ihm zumuten:
»Im Falle der logisch-mathematischen Erfahrung … werden die Erkenntnisse nicht aus den Gegenständen selbst gewonnen, sondern aus den mit ihnen vollzogenen Akten: durch den Akt des Ordnens werden die Gegenstände in eine Reihe gebracht; der Akt des Zusammenfassens macht aus ihnen eine Summe, eine logische oder numerische Ganzheit; der Akt des In-Beziehung-Setzens kann sie numerisch (aber nicht notwendig hinsichtlich ihrer Formen und Farben) gleichwertig machen; und so fort. (…) Aus biologischer Sicht kommen die Akte des Zusammenfassens oder Einschachtelns, des Ordnens usw. keineswegs durch Lernen zustande, da die Beziehungen der Einschachtelung, der Ordnung oder der Korrespondenz an allen Koordinationen des Verhaltens, des Nervensystems, der physiologischen Funktionen und der lebenden Organisation im Allgemeinen schon als Vorbedingungen, nicht erst als Ergebnisse wirksam werden. (…) Trotzdem sind es zwei verschiedene Dinge, ob das Subjekt eine im Gegenstand liegende Regelmäßigkeit, die bloß festgestellt zu werden braucht, von außen registriert, oder ob es diese Regelmäßigkeit aktiv durch eine Operation erzeugt, die wohl das Objekt stark imitieren kann, aber der gegebenen Regelmäßigkeit den Charakter einer endogenen Notwendigkeit und Intelligibilität verleiht, den sie aus sich selbst nicht hatte. (…) Gelten die Gesetze der Logik dagegen universell, … dann müßten sie angeboren sein und sich von frühester Kindheit an manifestieren. Davon kann indes keine Rede sein; ihre Notwendigkeit ist vielmehr das Ergebnis einer allmählichen Konstruktion. (…) Die Notwendigkeit der logisch-mathematischen Strukturen beweist somit keineswegs deren Erblichkeit; sie resultiert vielmehr aus deren progressiver Äquilibration durch Selbstregulierung. (…) Die interne Äquilibration solcher Strukturen genügt, um ihre Allgemeinheit und vor allem ihre unbegrenzt bewegliche Ausweitung zu erklären.« (Piaget 1992, S. 317 ff.)
Dieses Zitat enthält in komprimierter Form wesentliche Argumente dafür, warum und in welchem Sinne Piaget die menschliche Erkenntnis als biologischen Vorgang betrachtet, aber auch dafür, warum er trotz dieser biologischen Betrachtungsweise zu Recht als »Konstruktivist« gilt.
Erstens: logisch-mathematische Erfahrung ist darin »konstruktiv«, dass sie auf einer rekursiven Integration von an Gegenständen vollzogenen Operationen besteht, die zunächst manuell und an konkreten Gegenständen, später dann mental und an abstrakten Gegenständen vorgenommen werden. Die mentalen Konzepte der zeitlichen und räumlichen Objektkonstanz, Zahlbildung, Mengenbildung, Ordnung und Hierarchisierung setzen zunächst aktive, manuelle Operationen des Kleinkinds voraus, werden aber in fortgeschrittenem Alter selbst zum Ausgangsmaterial für komplexere Operationen, die dann als rein mentale Vorgänge ablaufen. Piaget analogisiert die Idee eines rekursiven Aufbaus immer formalerer Operationen einem ähnlichen Vorgang in der Mathematik, indem er auf Gödels Unvollständigkeitssatz verweist:
»(S)o hat Gödel schon 1930 mit seinen bekannten Theoremen demonstriert, daß ein ansonsten für die Erfüllung seiner Bedürfnisse genügend reiches System (z.B. die elementare Arithmetik) nicht in der Lage ist, seine Widerspruchsfreiheit nur mit seinen eigenen oder schwächeren Mitteln zu beweisen. Dieser Beweis verlangt, über die Grenzen des Systems hinauszugehen und das System selbst in ein ›stärkeres‹ zu integrieren … . Mit anderen Worten, eine Struktur kann sich nicht durch schlichte Ausweitung der gegebenen Operationen und durch Kombination der bekannten Elemente ausschließlich auf ihrer eigenen Stufe entwickeln: der Fortschritt besteht in der Konstruktion einer umfassenderen, die vorangehende mit umgreifenden Struktur, die allerdings zugleich neue Operationen einführt.« (Piaget 1992, S. 326)
Zweitens: die elementaren manuellen Operationen selbst sind nicht erlernt, sondern werden vom Organismus bereits mitgebracht, aber die Erfahrung der Regelmäßigkeit und Notwendigkeit entsteht durch die Selbstbeobachtung der eigenen erfolgreichen Handlungen – sie ist also nicht als Inhalt des Denkens vorgegeben, sondern vom fortgesetzten und sich erweiternden praktischen Vollzug der Handlungen abhängig und wird aus ihnen sukzessive aufgebaut. Ohne den tatsächlichen Gebrauch kognitiver Operationen findet ein Aufbau der Intelligenz nicht oder nur sehr eingeschränkt statt. Es gibt keine interne Kraft des Organismus, die sie unabhängig von ihrem Gebrauch in der Handlungsumwelt entstehen lassen würde. Dennoch ist Kognition der Spezialfall des adaptiven (bei Piaget: akkommodativen und assimilativen) Verhaltens menschlicher Organismen.
Drittens: der Begriff einer »progressiven Äquilibrierung durch Selbstregulierung« verweist darauf, dass der Organismus einen Zustand des Gleichgewichts, der Äquilibrierung, anstrebt, in dem seine kognitiven Instrumente eine zureichende Beherrschung der gegebenen Handlungsumwelt gestatten, die keine Weiterentwicklung mehr erfordert. Damit ist die Begrenzung der kognitiven Entwicklung nicht an innere Schranken gebunden, sondern an den Charakter und Umfang des kognitiv zu verarbeitenden Materials bzw. der kognitiv zu beherrschenden Lebensumwelt. Die kognitive Entwicklung bleibt simpel in einfachen Lebensumgebungen, und sie entfaltet ihr volles Potential erst in komplexen Umwelten, in denen höhere Abstraktionsleistungen gefordert und gefördert werden. Eine solche Bindung der miteinander korrelierten Sprach- und Kognitionsentwicklung an soziale und historische Umstände wird auch von Maturana gesehen: »Die von einer Sprache im Laufe ihrer Geschichte erreichte Vielfalt hängt daher notwendigerweise sowohl von der potentiellen Verhaltensvielfalt der Organismen ab, welche an dem konsensuellen Bereich mitwirken, als auch von der historischen Verwirklichung solcher Verhaltensweisen und Unterscheidungen.« (Maturana 2000: 127)
(5.5) Insoweit der Stand der individuellen kognitiven Entwicklung mit dem Stand der kulturellen Entwicklung der jeweiligen Gruppe korreliert ist, lässt sich daraus die allgemeinere Formulierung ableiten, dass die Entfaltung der menschlichen Intelligenz an die Entfaltung des Zivilisationsprozesses insgesamt gekoppelt ist. An dieser Stelle soll der Gedanke nur vorläufig illustriert werden, da wir im Augenblick die »ontogenetische« Frage kognitiver Kompetenzen individueller Organismen betrachten, während die »phylogenetische« Frage des Verhältnisses von biologischer und kultureller Evolution erst später verhandelt wird. »Dem Individuum gelingen seine Erfindungen oder intellektuellen Konstruktionen nur in dem Maße, in dem es selbst ein Ort kollektiver Interaktionen ist, deren Niveau und Wert natürlich von der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit abhängen.« (Piaget 1992, S. 378)
Die in (5.1) angedeutete These, dass der Entwicklungsstand individueller kognitiver Kompetenzen nicht nur vom individuellen Lernvermögen, sondern vom kollektiven Entwicklungsstand der sozialen Umwelt abhängt, ist in weltweit kulturvergleichenden Studien breit untersucht und gut belegt worden und wurde erstmals durch die Untersuchungen von Alexander Lurija bekannt, den ich hier nach Christopher Hallpike (Hallpike 1990) zitiere. Im Folgenden gebe ich ein Beispiel wieder, das nicht nur für die individuelle interviewte Person repräsentativ ist, sondern für das kulturelle Milieu insgesamt, dem der Interviewte entstammt. Lurija
»fand bei Untersuchungen unter ungebildeten bäuerlichen Usbeken in Zentralasien, daß diese sich weigerten, logische Probleme rein hypothetisch … zu behandeln. Luria legte das folgende Beispiel einer deduktiven Schlußfolgerung einem 37 Jahre alten ungebildeten Kaschgaren aus einem abgelegenen Dorf vor (…):
Frage: Im hohen Norden, wo es Schnee hat, sind die Bären weiß. Nowaja Semlja ist im hohen Norden, und es hat dort immer Schnee. Welche Farben haben dort die Bären?
Antwort: Es hat dort verschiedene Arten von Bären.
F.: [Der Syllogismus wird wiederholt.]
A.: Ich weiß es nicht; ich habe nie einen schwarzen Bären gesehen, ich habe nie andere gesehen. Jeder Ort hat seine eigenen Tiere; wenn es weiße sind, dann sind alle weiß, wenn es gelbe sind, sind sie gelb.
F.: Welche Arten von Bären gibt es aber in Nowaja Semlja?
A.: Wir reden immer nur von dem, was wir sehen; wir reden nicht von dem, was wir nicht gesehen haben.
F.: Was bedeuten aber meine Worte? [Der Syllogismus wird wiederholt.]
A.: Nun, es ist so: Unser Zar ist nicht wie eurer, und eurer ist nicht wie unserer. Ihre Worte können nur von jemandem beantwortet werden, der dort war, und wenn eine Person nicht dort war, kann sie nur von Ihren Worten aus nichts sagen.
F.: Doch können Sie aus meinen Worten – im Norden, wo es immer Schnee hat, sind die Bären weiß – schließen, welche Art von Bären es in Nowaja Semlja gibt?
A.: Wenn ein Mann sechzig oder achtzig Jahre alt wäre und einen weißen Bären gesehen und darüber gesprochen hätte, könnte man ihm glauben, aber ich habe nie einen gesehen, und deshalb kann ich es nicht sagen. Das ist mein letztes Wort. Die welche sahen, können darüber sprechen und die, die nicht gesehen haben, können nichts sagen.«
(Hallpike 1990: 146)
Die Interviewten stützen ihre Antworten allein auf ihre Erfahrungen mit den tatsächlichen sozialen Beziehungen und sind dadurch nicht auf ein Denken vorbereitet, das sich auf nicht persönlich oder im engen sozialen Umfeld gewonnene, also sozial beglaubigte Erfahrungen stützt, sie können Aussagen nicht vom Kontext des konkreten Gesprächs lösen, sie verstehen einen Syllogismus nicht als selbständiges System aufeinander verweisender Aussagen, sie haben kein Verständnis für die abstrakte Rolle logischer Quantoren, und sie lehnen Lösungen der Syllogismen ab, wenn deren Aussagen geltenden sozialen Normen widersprechen. (Hallpike 1990: 148 f.) Es handelt sich bei den Interviewten um Analphabeten ohne Schulbildung, deren Lernprozesse nie anders als in enger Bindung an praktische Kontexte stattgefunden haben. Eine der wichtigsten kulturellen Institutionen, die zur Entwicklung höherer kognitiver Kompetenzen erforderlich ist, ist daher die Schule als ein Ort verallgemeinerten, dekontextualisierten Lernens, in der zugleich die Schrift als dekontextualisierte Form des Ausdrucks gedanklicher Inhalte gelernt wird. Kinder aus denselben Gesellschaften, die zumindest eine elementare Schulbildung genossen und schreiben gelernt haben, sind Erwachsenen ohne entsprechende Bildung hinsichtlich ihrer kognitiven Kompetenzen klar überlegen. (Hallpike 1990: 155-161) Dieser Zusammenhang sollte nicht mit der Trivialität verwechselt werden, dass, wer nicht zur Schule geht, eben nicht lesen, schreiben und rechnen kann. Sondern er besagt, dass, wer sich nie in von praktischen Zusammenhängen losgelösten, dekontextualisierten Lernsituationen befunden hat, auch niemals ein höheres, formales Abstraktions- und Urteilsvermögen entwickeln wird.
(6) Der wesentliche Nutzen eines kognitions- und moralpsychologischen Stufenschemas besteht darin, dass es der soziologischen Theorie (a) den Anschluss an ein naturalistisches Modell der Ontogenese der menschlicher Verstandesleistungen ermöglicht, (b) ein Modell der kulturellen Evolution und des Zivilisationsprozesses als phylogenetische Interpretation des ontogenetischen Stufenschemas zu formulieren erlaubt und (c) der prinzipiellen Offenheit historischer Prozesse durch eine Unterscheidung zwischen einer durch das phylogenetische Stufenschema beschriebenen Entwicklungslogik und einer durch das ontogenetische Stufenschema beschriebenen Entwicklungsdynamik gerecht werden kann. Was immer der Zivilisationsprozess an Handlungskompetenzen und Institutionen hervorbringt, lässt sich auf das Koordinatensystem eines ontogenetisch-phylogenetischen Parallelismus abbilden, welches im Prinzip nichts enthält, das nicht in naturalistischer (oder, wenn man so will, materialistischer) Weise zu den Kompetenzen des menschlichen Gehirns in Beziehung gesetzt werden kann. Dieses Programm ist in der Soziologie erstmals von Jürgen Habermas skizziert worden: »Für die Ontogenese der Erkenntnis- und Handlungsfähigkeiten lassen sich (im Sinne der kognitivistischen Entwicklungspsychologie) Entwicklungsstufen unterscheiden. Diese Stufen verstehe ich als Lernniveaus, die die Bedingungen möglicher Lernprozesse festlegen. Da die Lernmechanismen zur Ausstattung des (sprachfähigen) menschlichen Organismus gehören, kann sich die soziale Evolution … auf individuelle Lernkapazitäten stützen. (…) Die zunächst von einzelnen Gesellschaftsmitgliedern oder marginalen Gruppen erworbenen Lernkapazitäten finden über exemplarische Lernvorgänge Eingang in das Deutungssystem der Gesellschaft. Die kollektiv geteilten Bewußtseinsstrukturen und Wissensvorräte stellen … ein kognitives Potential dar, das gesellschaftlich genutzt werden kann. (…) Gesellschaften können evolutionär lernen, indem sie die in Weltbildern enthaltenen kognitiven Potentiale für die Umorganisation von Handlungssystemen nutzen.« (Habermas 1976: 176)
(6.1) Analog zum kognitionspsychologischen Stufenschema gehört zum vorstehend skizzierten Theorieprogramm auch ein moralpsychologisches Stufenschema, das insbesondere im Werk von Lawrence Kohlberg vorliegt (Kohlberg 1996). Da dies aber am Konstruktionsprinzip einer naturalistischen Kulturtheorie nichts ändert, wird es hier nicht gesondert erläutert.
(7) Dasselbe kognitionspsychologische und kognitionsbiologische Grundschema begründet auch ein Plattform, auf der sich das gesamte Programm der verstehenden und phänomenologischen Soziologie fundieren lässt, insbesondere in der Form des klassischen Sozialkonstruktivismus und der Wissenssoziologie. (Schütz/Luckmann 2003, Berger/Luckmann 1980) Insbesondere Berger und Luckmann binden ihren Konstruktivismus über den Begriff der Institutionalisierung zugleich an das Menschenbild der Philosophischen Anthropologie und damit an eine naturalistische Grundlage. (Berger/Luckmann 1980: 49-98) Auch dieses Thema wird hier nicht weiter erläutert.
(8.1) Wir haben in Abschnitt 5.2. angedeutet, dass Sprache und die in ihr verarbeiteten kulturellen Muster nicht den gesamten menschlichen Verhaltensprozess strukturieren, sondern dass diesem Prozess auch vorsprachliche Schichten angehören. Der Grundgedanke kann auf die folgende Formulierung gebracht werden: menschliches Verhalten ist ein vertikal integriertes System, weil das menschliche Gehirn ein vertikal integriertes System ist. Insbesondere arbeitet das kognitive Modul des Gehirns nicht isoliert, sondern im Kontext einer Rückkoppelung mit dem limbischen System, das seinerseits in hierarchische Konditionierungsebenen gegliedert ist, welche nur begrenzt oder gar nicht einer bewussten Einflussnahme zugänglich sind. (Roth 2003: 373 ff.) Diese Konditionierungsebenen enthalten sowohl lernunabhängige, also angeborene, Dispositionen als auch durch die frühkindliche Lebensumwelt zustande gekommene ontogenetische Prägungen und somit die Lebenserfahrung des Organismus. Die emotionalen Module des Gehirns arbeiten vor diesem lebensgeschichtlichen Hintergrund »als ein Bewertungssystem im Dienste der Verhaltenssteuerung«. (Roth 2003: 376) Ohne diese Fähigkeit zur Bewertung und Priorisierung von Verhaltensoptionen wäre der menschliche Verstand eine leerlaufende, richtungslose Maschinerie.
(8.2) Dies bedeutet andererseits nicht, dass das menschliche Verhalten dadurch zu einem deterministischen Automaten wird. Sondern menschliches Handeln wird durch Bedürfnisaufschub »abhängbar« von seinen Antrieben, und »(d)ieses Aufschieben schafft … einen Leerraum, einen Hiatus zwischen den Bedürfnissen und Erfüllungen«. (Gehlen 2014: 334) Diese »Lücke«, dieser Hiatus ist der anthropologische Ort der Emotionen: sie verbinden Bedürfnisse, die sich nicht mehr reflexhaft in Verhalten umsetzen, mit den auf sie bezogenen Erfüllungshandlungen und halten die Bedürfnisse für einen Latenzzeitraum in der Sphäre des reflexiv kontrollierten Handelns präsent und in Geltung. »Emotionen entstehen aus Antrieben, die (noch) nicht in Handlungen umgesetzt sind.« (Eibl 2009: 59)
(8.3) Darüber hinaus erfüllt planmäßiges, »abgekoppeltes« Handeln nicht nur die ihm zugrundeliegenden Bedürfnisse auf einem Umweg, sondern es kann auch neuartige, historisch präzedenzlose Handlungsweisen den Charakter von Bedürfnissen verleihen: »die menschlichen Antriebe sind entwicklungsfähig und formbar, sind imstande, den Handlungen nachzuwachsen, die damit selber zu Bedürfnissen werden. (…) Man kann daher auch sagen, es besteht gar keine objektive Grenze zwischen Antrieben und Gewohnheiten, zwischen primären und sekundären Bedürfnissen, sondern dieser Unterschied, wo er je auftritt, wird vom Menschen selbst gemacht.« (Gehlen 2014: 336) Anders formuliert: menschliche Antriebe sind hinsichtlich ihrer Objektwahl unterspezifiziert. Worauf sich elementare Empfindungen wie etwa das Scham- und Schuldgefühl oder auch die Orientierung an Rang- und Statusindikatoren richten, ist biologisch unterbestimmt und in diesem Sinne kulturell konstruiert. Die vertikale Integration menschlichen Verhaltens ist also keine unidirektionale Hierarchie, sondern erfolgt durch Kontrollflüsse sowohl bottom-up als auch top-down. Diese Differenzierung ist wesentlich, um zu verstehen, dass eine Identifikation unbewusster Verhaltensroutinen allein noch keinen Hinweis auf eine Verhaltensfestlegung durch angeborene, biologische Muster impliziert. Es bedarf eines hierauf abgestimmten, gesonderten Forschungsdesigns, um diesen Unterschied herauszuarbeiten.
(9.1) Es gibt eine ganze Reihe von geschlechtstypischen Verhaltensdispositionen, für die sich eine biologische Fundierung plausibel beanspruchen lässt, die ich aber hier nicht im Einzelnen diskutiere, sondern nur im Telegrammstil aufzähle: unterschiedlich gute Leistungen bei verbalen Kompetenzen (Frauen+), räumlichem und analytischem Denken (Männer+), unterschiedliche Interaktionsstile in Bezug auf Kinder (verbal / explorativ), Spielzeugpräferenzen bei Kleinkindern (Puppen / Autos), komplementäre Denkstile (prädikativ / funktional), unterschiedliche Aggressionsmuster (reaktiv / assertiv, Beziehungsaggression / offene Aggression), unterschiedliches Rangverhalten (instabile Geltungshierarchie / stabile Dominanzhierarchie), Selbstvertrauen (Selbstunterschätzung / Selbstüberschätzung), unterschiedliche Misserfolgstoleranz, unterschiedliches Risikoverhalten (vernünftig / übermütig), unterschiedliches Geltungsstreben (Streben nach Unauffälligkeit / Auffälligkeit), unterschiedliche Partnerschaftspräferenzen (good provider/good genes), unterschiedliche Bewertung von Familie und Beruf und andere. (Bischof-Köhler 2011) Bischof-Köhlers Arbeit, auf die ich mich hier zentral beziehe, hat den Vorzug, nicht nur eine Synopse einer Vielzahl von umsichtig bewerteten empirischen Studien zu bieten, sondern in der Abwägung der Befunde ein Abgleiten sowohl in kulturalistische als auch biologistische Positionen zu vermeiden. Auch in der Erörterung der Konsequenzen aus diesen Befunden vermeidet sie eine übereilte Festlegung auf ein politisches »Lager«. Es darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass Bischof-Köhlers Entwurf nicht voraussetzt, »dass die angeborenen Präferenzen geschlechtsspezifisch sind, also ausschließlich bei Jungen oder bei Mädchen auftreten. Ihre Verteilung über die Geschlechter kann sich durchaus überlappen. Es genügt, wenn auf jeder Seite die Mehrzahl der Beteiligten die genannten geschlechtstypischen Vorlieben zeigt«. (Bischof-Köhler 2011: 352)
(9.2) Abgesehen davon, dass ich ihre Datenbasis und Argumentation für solide und sauber ausgearbeitet halte, ist auch eine Tendenz in ihren Schlussfolgerungen höchst aufschlussreich: sie identifiziert nicht nur eine grundsätzliche Differenzen in männlichen und weiblichen Dispositionen, sondern auch eine hierin gründende, grundsätzliche Asymmetrie in den Beziehungen zwischen den Geschlechtern, die sie als ein Potential für Diskriminierung sieht: »Die Eigen- und Fremdstereotypen beinhalten nämlich nicht nur bloße Tatsachenbehauptungen, sondern auch eine Bewertung, und zwar nicht nur symmetrisch zugunsten des eigenen und zuungunsten des anderen Geschlechts, sondern auch asymmetrisch zum Nachteil der Frauen. (…) Dabei ziehen die Frauen häufig den kürzeren, sei es, weil sie durch die rigorosen Methoden der Männer überrollt werden, sei es, dass sie sich selbst ins Abseits manövrieren, indem sie sich imponieren lassen und dünnhäutiger auf Misserfolge reagieren. (…) Das Wertgefälle zuungunsten der Frau erschloss sich dabei nämlich als eine weitere Konsequenz unseres phylogenetischen Erbes, genauer gesagt, des ständigen Konkurrenzdrucks im männlichen Geschlecht.« (Bischof-Köhler 2011: 353 f.) Der Unterschied zum feministischen Diskriminierungsargument besteht aber darin, dass es sich dabei nicht um die Unterdrückung einer spontanen Tendenz zu gleichem Verhalten handelt, sondern um die unzureichende gesellschaftliche Entlastung einer spontanen Tendenz zu ungleichem Verhalten. Ähnlich wie sich selbst überlassene Marktprozesse nicht zum Ausgleich, sondern zum Monopol tendieren, so tendieren sich selbst überlassene Geschlechterbeziehungen zu einer inhärenten Ungleichwertung der Geschlechter. Auch in Bischof-Köhlers dezidiert biologisch argumentierendem Ansatz ist die Frage nach kompensierenden gesellschaftlichen Interventionen daher nicht von vornherein vom Tisch. Anders aber als in einer »Patriarchatstheorie« oder Theorie »männlicher Hegemonialität« gibt es kein aktives Beherrschungsstreben des männlichen über das weibliche Geschlecht, sondern die den Geschlechterbeziehungen inhärente Asymmetrie ist ein Systemeffekt biogener geschlechtstypischer Dispositionen, über die bis in moderne Zeiten keines der beiden Geschlechter reflexiv, und damit auch nicht intentional verfügt. In diesem Sinne »beseitigt« ihr Modell den Begriff des »Patriarchats«, indem geschlechtstypische Verhaltensdivergenzen nicht intentionalistisch und psychologistisch missverstanden werden.
(9.3) Wir können die verhaltensbiologischen und verhaltenspsychologischen und damit akteurstheoretischen Befunde von Doris Bischof-Köhler nun auf die Ebene elementarer sozialer Funktionsbereiche abbilden. Hierzu eignet sich insbesondere die von Klaus E. Müller schon in den 80er Jahren vorgelegte ethnographische Geschlechtsrollensynopse. (Müller 1989) Müllers Entwurf ist wesentlich dadurch gekennzeichnet, dass er ältere evolutionistische Modelle des Übergangs einer »matriarchalen« zu einer »patriarchalen« Entwicklungsstufe menschlicher Kulturen, wie man sie bei Lewis H. Morgan, Friedrich Engels oder Johann Jakob Bachofen findet, zurückweist und an umfangreichem ethnografischem Material zeigt, dass dem Geschlechterverhältnis bereits in primitiven Gesellschaften eine fundamentale Asymmetrie innewohnt. Er untersucht dabei sowohl die biologische und ökonomische Existenzsicherungsbasis solcher Gesellschaften als auch den kulturellen »Überbau«, d.h. vor allem die symbolischen Grundstrukturen der Gesellschaftsordnung. Müller identifiziert eine elementare »Zwei-Sphären-Dichotomie«, die er als »Endosphäre« und »Exosphäre« bezeichnet: »Die Frauen, durch Schwangerschaft und Geburt und Betreuung der Kinder in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt, gingen weiterhin, vielleicht auch verstärkt, der Sammelwirtschaft im näheren Umfeld des Lagers nach …, so daß sich ihre Bindung an Haus und Siedlung auf diese Weise also zunehmend verstärkte. Die Männer dagegen gewannen mit der Entwicklung der Jagd die Möglichkeit, sich mehr und mehr aus dem engeren Lagerbereich und seinem Umkreis zu lösen. Ihre Lokomotion erfuhr eine quasi sprunghafte Dynamisierung, entfaltete sich gewissermaßen spiralförmig-zentrifugal über die Zentralareale hinaus bis teils in die Tiefen der Exosphäre jenseits der Territoriumsgrenzen hinein. (…) Ganz zwangsläufig also verfügten die Männer immer über das umfassendere, weiterreichende Wissen, gelangten als erste in den Besitz von Neuigkeiten aus der Außenwelt, d.h. geboten in gewissem Maße auch über die Zukunft, besaßen am ehesten Fremdsprachenkenntnisse und zeigten sich so im Umgang insgesamt versierter, quasi ›weltläufiger‹.« (Müller 1989: 381 f.)
(9.4) Es fällt nicht schwer, die von Bischof-Köhler identifizierten geschlechtstypischen Dispositionen auf Müllers Dichotomie von Endosphäre und Exosphäre als geschlechtsspezifischen Handlungsfeldern abzutragen und auf diese Weise eine evolutionstheoretisch erklärbare Ausgangskonstellation der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung zu identifizieren. Ich sehe in Müllers Modell jedoch zwei Schwächen, die es nicht entwerten, aber zu einer Weiterentwicklung anregen: erstens sucht Müller zwar nach universellen Konstanten, um die Basiskonstruktion des Geschlechterverhältnisses zu erklären, versäumt es dabei aber, eine anthropologische Fundierung in biologischen Begriffen wenigstens in Betracht zu ziehen. Dadurch muss seine ausschließlich kulturtheoretische Argumentation gleichsam »selbsttragend« aufgebaut sein, was dazu führt, dass auch sein Bild des männlichen Dominanzstreben insgesamt schwärzer ausfällt, als es tatsächlich sein müsste. Denn zweitens fällt auf, dass er mit den kulturevolutionistischen Matriarchatstheorien auch gleich die empirischen Beispiele entsorgt, die ihnen seinerzeit eine gewisse Plausibilität verliehen haben: so fallen beispielsweise Morgans in der Sache auch heute noch maßgeblichen Befunde zur irokesischen Gesellschaft (Morgan 1985) bei Müller auch empirisch komplett unter den Tisch. Ohne dies hier im Einzelnen begründen zu können, bin ich aber der Meinung, dass sich solche Beispiele zwanglos in Müllers Modell einfügen lassen, wenn man berücksichtigt, dass das Verhältnis von Endosphäre und Exosphäre selbst einer gewissen Plastizität unterliegt, welche mit der Produktionsweise der jeweiligen Gesellschaften korreliert werden kann: so fallen alle Beispiele für (mehr oder weniger) »geschlechtsegalitäre« Gesellschaften in die Klasse der sesshaften Agrarkulturen, die der Sphäre weiblicher Produktivkräfte eine Chance zur Aufwertung bieten, und in einer Gesellschaft wie der des Alten Ägypten kommt auf Grund seiner geostrategischen Gunstlage mit nur wenigen militärisch zu sichernden Engpässen auch eine Entlastung der »männlichen Exosphäre« hinzu. Demgegenüber gehen die schon sehr früh ausgeprägt »patriarchalischen« Gesellschaften der Indoeuropäer auf die spätneolithischen und bronzezeitlichen, halb- bis vollnomadischen Viehzüchtergesellschaften der pontisch-kaspischen Steppe zurück, die den weitaus größten Teil ihrer Produktivkräfte auf die »männliche Exosphäre« gründen.
(9.5) Und schließlich lässt sich an Müllers Entwurf auch die im engeren Sinne »maskulistische« Kritik anschließen, die auf das spezifische, vom Feminismus konsequent ignorierte »Kostenmodell« einer männlichen Zuordnung zur Exosphäre abhebt: sobald menschliche Kulturen sei es aufgrund agrarischer Produktivkraftentfaltung, sei es aufgrund Verknappung fruchtbaren Bodens oder einer Kombination solcher Faktoren in einen Verdichtungsprozess der Bevölkerungsentwicklung und der Kulturkontakte eintreten, wird die männliche Exosphäre zwangsläufig zu der Arena, in der die daraus entstehenden Konflikte ausgetragen und der Druck zur Entwicklung weiterführender Lösungen primär spürbar wird. Männer entzünden nicht nur das Feuer des Krieges, sie sind zugleich auch das primäre Brennholz, das dieses Feuer nährt, und hinter jedem Krieger steht eine Frau, die ihn warnt, als Verlierer heimzukehren. Männer müssen sich nicht für eine »jahrtausendealte Frauenunterdrückung« oder ein »fünftausendjähriges Patriarchat« entschuldigen. Es gibt schlechterdings nichts, das entschuldigt werden müsste! Man kann bestimmte historische Entwicklungen sowohl in actu als auch retrospektiv als falsch bewerten – aber dies ist im Verlauf des Zivilisationsprozesses immer schon geschehen! Das ägyptische Ethos bewertet eigensüchtiges Verhalten als falsch, die jüdische Religion bewertet die ägyptische als falsch, das griechische Modell der Gleichheit das persische Gottkönigtum, das Christentum die antike Lebensform, der Protestantismus den Katholizismus, Aufklärung und Naturwissenschaft den christlichen Dogmatismus, die modernen Menschen- und Bürgerrechte die hierarchische Staatsform und Gesellschaftslehre und das hierarchische Geschlechterverhältnis. Erst der Second-Wave-Feminismus hat in grandioser Verleugnung seiner eigenen historischen Voraussetzungen so getan, als wären alle diese aufeinander aufbauenden Akte des ethischen Verwerfens vorgefundener schlechter Zustände, die den Zivilisationsprozess ausmachen, nichts wert und die feministische Ideologie die einzige Messlatte, an der sich fortan alle Menschheit zu messen habe. Und diese Hybris ist der Grund, warum es so etwas wie »Maskulismus« überhaupt gibt.
(10) Mit diesen eher aphoristisch gehaltenen Sätzen muss ich meinen längst zu lang geratenen Beitrag vorerst beschließen. Von hier an entfaltet sich die Geschichte der menschlichen Zivilisation als eine zweifache Emanzipationsgeschichte: als Emanzipation von der äußeren Natur mit den Mitteln der Technologieentwicklung und Produktivkraftentfaltung, und als Emanzipation von der inneren Natur der biologisch fundierten Antriebe und Motivationen, die den Menschen, wie erstmals die Hochreligionen der »Achsenzeit« feststellen, in einem prägenden Griff halten, der durch Reflexion und Willensanstrengungen überwunden werden soll – und kann. Und dies führt den Zivilisationsprozess an die Schwelle der Moderne, in der erstmals in der Weltgeschichte das Geschlechterverhältnis selbst kritisch in diesen reflexiven Blick einbezogen wird. Aber das ist ein eigenständiges Kapitel.
Literatur:
- Austin, John L. (1989), Zur Theorie der Sprechakte (How to do things with Words). Stuttgart: Reclam
- Axelrod, Robert (1984), The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books
- Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas (1980), Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt a. M.: Fischer
- Berk, Laura (2011), Entwicklungspsychologie. 5., aktualisierte Auflage – bearbeitet von Prof. Dr. Ute Schönpflug. München: Pearson
- Bischof-Köhler, Doris (2011), Von Natur aus anders. Die Psychologie der Geschlechtsunterschiede. Stuttgart: Kohlhammer
- Cassirer, Ernst (1923, 1994), Philosophie der symbolischen Formen. Erster Teil: Die Sprache. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
- Doidge, Norman (2007), The Brain That Changes Itself. Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Science. London: Penguin
- Dux, Günter (1994), Geschlecht und Gesellschaft. Warum wir lieben. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
- Eibl, Karl (2009), Kultur als Zwischenwelt. Eine evolutionsbiologische Perspektive. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
- Geertz, Clifford (1973), The Interpretation of Cultures. Selected Essays. New York: Basic Books
- Gehlen, Arnold (1950, 162014), Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. Wiebelsheim: Aula-Verlag
- Glasersfeld, Ernst von (1997), Radikaler Konstruktivismus. Ideen, Ergebnisse, Probleme. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
- Habermas, Jürgen (1976), Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
- Hallpike, Christopher R. (1990), Die Grundlagen primitiven Denkens. München: dtv
- Holler, Manfred J.; Illing, Gerhard (2006), Einführung in die Spieltheorie. Berlin – Heidelberg – New York: Springer
- Humboldt, Wilhelm von (1995), Schriften zur Sprache. Stuttgart: Reclam
- Kandel, Eric R. (2008), Psychiatrie, Psychoanalyse und die neue Biologie des Geistes. Mit einem Vorwort von Gerhard Roth. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
- Kohlberg, Lawrence (1996), Die Psychologie der Moralentwicklung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
- Lewontin, Richard (2002): Die Dreifachhelix. Gen, Organismus und Umwelt. Berlin – Heidelberg: Springer
- Luhmann, Niklas (1984), Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
- Maturana, Humberto (2000), Biologie der Realität. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
- Metzinger, Thomas (2004), Being No One. The Self Model Theory of Subjectivity. Cambridge, Massachusetts: MIT Press
- Mithen, Steven (1998), The Prehistory of the Mind. A Search for the Origins of Art, Religion and Science. London: Phoenix
- Morgan, Lewis Henry (1878, 1985), Ancient Society. Foreword by Elisabeth Tooker. Tucson: The University of Arizona Press
- Müller, Klaus E. (1989), Die bessere und die schlechtere Hälfte. Ethnologie des Geschlechterkonflikts. Frankfurt a. M.: – New York: Campus
- Parzinger, Hermann (2014), Die Kinder des Prometheus. Eine Geschichte der Menschheit vor der Erfindung der Schrift. München: C. H. Beck
- Piaget, Jean (1967, 1992), Biologie und Erkenntnis. Über die Beziehungen zwischen organischen Regulationen und kognitiven Prozessen. Frankfurt a. M.: Fischer
- Roth, Gerhard (1996), Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
- Roth, Gerhard (2003), Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert. Neue, vollständig überarbeitete Ausgabe. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
- Schütz, Alfred; Luckmann, Thomas (2003), Strukturen der Lebenswelt. Konstanz: UVK (UTB)
- Schurz, Gerhard (2011), Evolution in Natur und Kultur. Eine Einführung in die verallgemeinerte Evolutionstheorie. Heidelberg: Spektrum
- Searle, John R. (1983), Sprechakte. Ein sprachphilosophischer Essay. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
- Searle, John R. (2011), Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Zur Ontologie sozialer Tatsachen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
- Searle, John R. (2012), Wie wir die soziale Welt machen. Die Struktur der menschlichen Zivilisation. Berlin: Suhrkamp
- Simmel, Georg (1908, 1992), Soziologie. Untersuchung über die Formen der Vergesellschaftung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
- Singer, Wolf (2002), Der Beobachter im Gehirn. Essays zur Hirnforschung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
- Singer, Wolf (2003), Ein neues Menschenbild? Gespräche über Hirnforschung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
- Thompson, Richard F. (2001), Das Gehirn. Von der Nervenzelle zur Verhaltenssteuerung. Heidelberg: Spektrum
- Tomasello, Michael (2012), Warum wir kooperieren. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
- Tomasello, Michael (2014), A Natural History of Human Thinking. Cambridge: Harvard University Press
- Voland, Eckart (2013), Soziobiologie. Die Evolution von Kooperation und Konkurrenz. Heidelberg – Berlin – Oxford: Springer Spektrum
- Vygotskij, Lev Semënovič (1934, 2002), Denken und Sprechen. Psychologische Untersuchungen. Weinheim – Basel: Beltz
- Welsch, Wolfgang (2012), Homo mundanus. Jenseits der anthropischen Denkform der Moderne. Weilerswist: Velbrück
- Wilson, Edward O. (2014), Die soziale Eroberung der Erde. Eine biologische Geschichte des Menschen. München: C.H. Beck
- Wuketits, Franz M. (1997), Soziobiologie. Die Macht der Gene und die Evolution sozialen Verhaltens. Heidelberg – Berlin – Oxford: Springer Spektrum
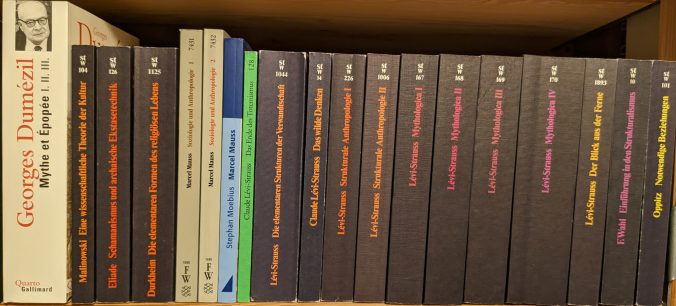
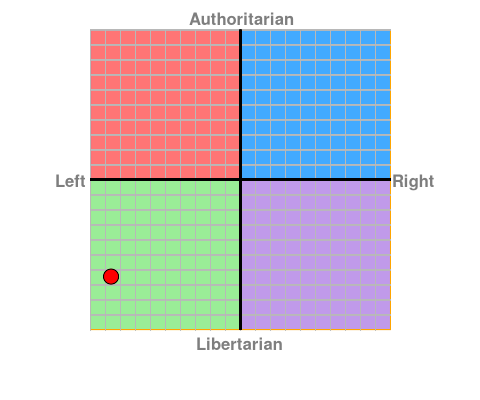
Schreibe einen Kommentar