(4. Mai 2015)
Nachdem ich in meinem vorletzten Blogpost die Grenzen bestimmter kulturwissenschaftlicher Auffassungen im Hinblick auf die Biologie zu skizzieren versucht habe, gehe ich nun einen Schritt in die andere Richtung und versuche – leider erneut in Form einer gedrängten Skizze, die eigentlich mehr Zeit verlangte – zu erläutern, wo die Grenzen bestimmter biologischer und evolutionspsychologischer Auffassungen im Hinblick auf die Kulturwissenschaften liegen. Ich versuche zu skizzieren, dass sich eine Eingrenzung der Reichweite solcher Erklärungen mit denselben Grundunterscheidungen durchführen lässt, mit denen in der modernen Philosophie der so genannte »Psychologismus« kritisiert worden ist. Dabei handelt es sich um den Versuch, Erkenntnistheorie auf die Psychologie als empirische Wissenschaft zu stützen, wie er wesentlich von John Stuart Mill und Wilhelm Dilthey unternommen und von Gottlob Frege und Edmund Husserl kritisiert wurde. Insbesondere Husserls erstes Hauptwerk, die »Logischen Untersuchungen« aus dem Jahre 1900, waren hierfür maßgeblich:
»Der Effekt der Kritik der ›Logischen Untersuchungen‹ ist dem von Kants Vernunftkritik vergleichbar. Wie Kant für die Schulmetaphysik zum Alleszermalmer wurde, so Husserl für den Psychologismus.«
Marquard 1987: 13
Meine Grundthese lautet, dass sich Evolutionsbiologie und Evolutionspsychologie vor derselben Überziehung ihrer Erklärungsansprüche in Acht nehmen müssen, wie der Versuch einer psychologischen Begründung der Logik am Ende des 19.Jahrhunderts.
Kritik am Psychologismus
Husserls Kritik des Psychologismus beruht wesentlich auf der Zurückweisung des Behauptung, der empirisch-psychologische Vorhang einer logischen Denkoperation sei mit ihrer notwendigen Geltung identisch, bzw. letztere könne aus ersterer durch Verallgemeinerung abgeleitet werden:
»(D)er ausgedrückte Satz, der im logischen Denken als Ergebnis gewonnene, enthält als Sinngebilde, in seinem Sinn selbst, nicht vom Denken, sowenig wie die im zählenden Erleben gezählte Zahl in ihrem Sinngehalt etwas vom psychischen Tun des Zählens enthält.«
Husserl 2003: 21
Mathematik und Logik können nicht psychologisch fundiert werden:
»Alle arithmetischen Operationsgebilde weisen auf gewisse psychische Akte arithmetischen Operierens zurück, nur in Reflexion auf sie kann, was Anzahl, Summe, Produkt u. dgl. ist, ›aufgewiesen‹ werden. (…) Mit dem Zählen und dem arithmetischen Operieren als Tatsachen, als zeitlich verlaufenden psychischen Akten, hat es natürlich die Psychologie zu tun. (…) Ganz anders die Arithmetik. (…) Von individuellen Tatsachen, von zeitlicher Bestimmtheit ist in dieser Sphäre gar keine Rede. Zahlen, Summen und Produkte von Zahlen … sind nicht die zufällig hier und dort vor sich gehenden Akte des Zählens, des Summierens und Multiplizierens usw.«
Husserl 2009: 173
Auch die jeweils mit den psychischen Akten und den logischen Beziehungen befassten Kunstlehren unterscheiden sich prinzipiell voneinander:
»Sache der Psychologie, als Naturwissenschaft von den psychischen Erlebnissen, ist es, die Naturbedingtheit dieser Erlebnisse zu erforschen. In ihr Gebiet gehören also speziell die empirisch-realen Verhältnisse der mathematischen und logischen Betätigungen. Ihre idealen Verhältnisse und Gesetze bilden aber ein Reich für sich. Dieses konstituiert sich in rein generellen Sätzen, aufgebaut aus ›Begriffen‹, welche nicht etwa Klassenbegriffe von psychischen Akten sind, sondern Idealbegriffe (Wesensbegriffe), die in solchen Akten ihre konkrete Grundlage haben.«
Husserl 2009: 189
Evolutionäre Erkenntnistheorie
Unter den heute aktuellen Theorien ist für unsere Argumentation insbesondere die Evolutionäre Erkenntnistheorie relevant, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Existenz logischer Kategorien als ein Produkt der Evolution zu beschreiben. Sie kann insofern als Fortsetzung des Psychologismus mit anderen Mitteln betrachtet werden, als sie die Kantsche (und Husserlsche) Idee einer strengen Notwendigkeit von Kategorien a priori zurückweist:
»Weder die synthetischen Urteile a priori noch die Kategorien haben Notwendigkeitscharakter. Notwendige Wahrheiten über die Welt gibt es nicht. Für den hypothetischen Realismus haben vielmehr alle Aussagen über die Welt Hypothesecharakter. (…) Die Anschauungsformen und Kategorien passen auch als subjektive, uns eingepflanzte Anlagen auf die Welt …, einfach deshalb, weil sie sich in Anpassung an diese Welt und an diese Gesetze evolutiv entwickelt haben. (…) Daß die Anschauungsformen und Kategorien uns ›eingepflanzt‹ sind und Erfahrung erst möglich machen, erklärt, warum wir uns auch keine anderen Erfahrungen vorstellen können, macht sie also psychologisch notwendig. Und diese psychologische Notwendigkeit erklärt schließlich auch, warum Kant glaubte, ihnen absolute Notwendigkeit zuschreiben zu müssen. Sie sind aber weder aus logischen Gründen noch aufgrund von Naturgesetzen notwendig«.
Vollmer 2002: 129 f.
Vollmer unterscheidet dabei wissenschaftliches und vorwissenschaftliches Wissen: vor allem letzteres sei durch Anpassungsprozesse entstanden:
»Das wissenschaftliche Denken beruht zwar zum Teil auf den biologisch bedingten Eigenschaften des menschlichen Gehirns, war aber umgekehrt selbst kein bestimmender Faktor für die Evolution. Dagegen gehörten vorwissenschaftliche Erfahrung und Alltagsverstand gerade zu den wirksamsten Komponenten der evolutiven Anpassung. Wir dürfen deshalb annehmen, daß die subjektiven Strukturen der vorwissenschaftlichen Erfahrungserkenntnis, zu denen auch die Wahrnehmungsstrukturen gehören, der Umwelt angepaßt sind, an der sie sich entwickelt haben. Es ist jedoch nicht zu erwarten, daß diese Strukturen auf alle realen Strukturen passen oder auch nur zum richtigen Erfassen aller dieser Strukturen geeignet seien.«
Vollmer 2002: 162
Diesem Argument ist Gerhard Roth mit dem Einwand entgegengetreten, dass die Evolutionäre Erkenntnistheorie auf einer überholten, übervereinfachten Vorstellung von evolutionärer Anpassung beruht. Roths Kritik am »neodarwinistischen Adaptionsbegriff« stützt sich auf die Beobachtungen,
»(a) daß viele Organismen innerhalb vieler Millionen Jahre oder sogar Hunderten von Millionen Jahren sich nicht wesentlich verändert haben, obwohl ihre Umwelt sich änderte (dies bezeichnet man als Stasis);
Roth 1997: 346 f.
(b) daß umgekehrt Organismen sich zum Teil stark änderten, obwohl ihre Umwelt sich nicht änderte;
(c) daß viele Organismen offenbar deshalb überlebten, weil sie sich nicht eng an ihre Umwelt anpaßten, weil sie nämlich (relativ) unspezialisiert waren; und umgekehrt: daß viele Organismen deshalb ausstarben, weil sie (retrospektiv) zu eng an ihre Umwelt angepaßt waren;
(d) daß Organismen gleicher Herkunft in gleicher Umwelt sich verschieden entwickeln können, und zwar aus Gründen, die in ihren strukturellen und funktionalen Systemeigenschaften liegen.
Ganz offenbar übt die Umwelt auf die Evolution der Organismen nicht die determinierende Kraft aus, die ihr der Neodarwinismus zuschreibt.«
Roth zufolge bieten evolutionäre Anpassungsrestriktionen sehr viel mehr Spielräume für organismusinterne Variationsprozesse, als die Evolutionäre Erkenntnistheorie annimmt:
»Für das Überleben genügt es, gewisse Minimalbedingungen z. B. hinsichtlich Nahrungserwerb, Flucht, Reproduktion, Stoffwechsel zu erfüllen, die zur erfolgreichen Erhaltung des Individuums und der Art führen. Die Umwelt definiert diese Minimalbedingungen, sie setzt eine untere Grenze, sie wählt aber in aller Regel nicht den ›Bestangepaßten‹ aus. (…) Was hier für den Organismus allgemein gesagt wurde, gilt auch für das Gehirn und seine kognitiven Funktionen. Die meisten Merkmale der funktionalen Organisation des Gehirns sind nur unspezifisch genetisch festgelegt, sie gehorchen überwiegend epigenetischen, selbstorganisierenden und erfahrungsabhängigen Prozessen. Die vergleichende Hirnforschung hat in den letzten Jahren viele Beweise dafür geliefert, daß die Hirnevolution stark eigengesetzlich verlaufen ist. Die Rolle der Umweltselektion, so stark man an sie auch glauben mag, ist für das Gehirn nirgendwo eindeutig nachgewiesen.«
Roth 1997: 347 f.
Roth verwirft die Evolutionäre Erkenntnistheorie nicht vollständig, insofern er Kognition ebenfalls als ein biologisches Phänomen versteht. Er bestreitet aber, dass sich die Objektivität unserer Erkenntnis aus evolutionärer Anpassung erklären lässt. Sein Einwand gestattet es uns auch, für die Entwicklung des menschlichen Gehirns einen Gedanken von Wolfgang Welsch aufzunehmen, der eine Rückkoppelung der Gehirnevolution mit vom Menschen selbstgeschaffenen Bedingungen vorschlägt – also keinen Selektionsdruck der Umwelt voraussetzt, sondern eine »davonlaufende« Selbstverstärkung annimmt, die nicht auf die Selektion von Individuen einer Population angewiesen ist. Zuvor müssen wir aber mit Hinsicht auf die eingangs angerissene Psychologismuskritik einen entsprechenden Kulturbegriff formulieren.
Ein der Psychologismuskritik adäquater Kulturbegriff
Objektivität und Notwendigkeit, die den kognitiven Operationen der Logik und Mathematik zukommt, sind an ihre symbolische Externalisierung gekoppelt. Die Fixierung einer Bedeutung in einem externalisierten Zeichen – ursprünglich das sprachliche Lautzeichen – löst diese Bedeutung von der empirischen Geistestätigkeit, die sie hervorgebracht hat. Es findet im Zeitverlauf eine Wiederbegegnung der geistigen Tätigkeit mit dem Symbol und dem von ihm bezeichneten Bedeutungsgehalt statt.
»Durch das Zeichen, das mit einem Inhalt verknüpft wird, gewinnt dieser in sich selbst einen neuen Bestand und eine neue Dauer. Denn dem Zeichen kommt, im Gegensatz zu dem realen Wechsel der Einzelinhalte des Bewußtseins, eine bestimmte ideelle Bedeutung zu, die als solche beharrt.«
Cassirer 1994: I, 22
Der Sinngehalt eines konkreten Zeichens oder sprachlichen Ausdrucks ist also das, was zwei oder mehr empirischen Bewusstseinsakten desselben oder mehrerer Individuen, die diesen Sinngehalt erfassen, gemeinsam ist. Dementsprechend ist die durch das Zeichen benannte Idee dasjenige, was mehreren empirischen (psychischen, neuronalen) Repräsentationen des bezeichneten Sinngehalts gemeinsam ist. Ideen sind daher nicht mit empirischen Bewusstseinsvorgängen identisch, sondern sie sind dasjenige, was einer Mehrzahl von empirisch unterschiedenen Bewusstseinsakten die Identität verleiht, sich auf dasselbe zu beziehen.
Symbolisch fixierte Ideen sind also etwas, wodurch Bewusstseinsströme extern strukturiert und stabilisiert werden. Dass ich eine komplexe Rechenaufgabe heute mit Leichtigkeit, morgen aber nur mit Mühe löse, ist meinem empirischen Bewusstseinsprozess (und seiner »Tagesform«) geschuldet, aber dieser Prozess ändert nichts an der Identität der Rechenaufgabe über den Tag hinaus. Durch ihre Zeichenbindung sind Ideen aber nicht ihrerseits bloß »ideell«, sondern besitzen eine eigene Materialität und Gegenständlichkeit, die sie ihrerseits zu einem empirischen Tatbestand und zum Gegenstand einer selbständigen Klasse von Wissenschaften macht: den Kulturwissenschaften.
Dennoch kann Ideen (und auch bei logischen Gesetzen handelt es sich um solche) eine biologische Funktion beigelegt werden: sie dienen dazu, in einem a priori unbestimmten Raum möglicher Erfahrung zur Anwendung zu kommen. Denn indem sie nicht, wie instinktiv fixiertes Verhalten, auf eine bestimmte Erfahrung festgelegt und an eine fixe Reaktion gekoppelt sind, müssen sie, einen hinreichend hohen Allgemeinheitsgrad vorausgesetzt, auf jede mögliche Erfahrung anwendbar sein. Die Anwendbarkeit auf jede mögliche Erfahrung ist aber dasjenige, was die menschliche Verhaltensflexibilität und hochgradige Anpassungsfähigkeit an variable Umwelten ermöglicht. Der Gebrauch extern fixierter Sinngehalte zur Strukturierung von Bewusstseinsströmen und zur Adaption von Verhalten über Wissen an variable Kontexte ist der Kern dessen, was wir als »Kultur« bezeichnen. Kultur garantiert die für den Menschen spezifische Flexibilität von Anpassungsleistungen und ist somit konstitutiv für die Spezies homo sapiens.
Hier ist nun freilich einem Missverständnis vorzubeugen: »Konstitutiv« bedeutet nicht, dass es sich bei »Kultur« um den einzigen Bestimmungsfaktor des Homo Sapiens handelt und die »Biologie« der Spezies nicht relevant wäre. Sondern man kann den Zusammenhang so fassen, dass es die menschliche Spezies konstituiert, dass ihre Biologie mit einer kulturellen Extension ausgestattet ist. Die Ebenen sind nicht zu trennen: ohne die biologisch konstruierte Offenheit des menschlichen Bewusstseins gäbe es keine Kultur, und ohne Kultur wäre die in dieser Weise »offen« konstruierte Biologie nicht operations- und damit lebensfähig.
Diese für den Menschen spezifische anthropologische Verschränkung von Biologie und Kultur entstammt einem Zwischenglied der Evolution zum Menschen, das zeitlich zwischen die rein biologische und die rein kulturelle Evolution geschaltet ist – die so genannte »protokulturelle Evolution«:
»Die protokulturellen Fortschritte sowohl der Werkzeugtechnik als auch der sozialen Komplexität verlangten hochgradige interne Leistungen des Gehirns. Dadurch hat sich in der protokulturellen Periode in einem fortlaufenden Rückkopplungsprozess zwischen Tätigkeitsinnnovation und Gehirnoptimierung das für den Menschen typische extrem leistungsfähige und reflexionsfähige Gehirn herausgebildet. Die Besonderheit des menschlichen Gehirns – die überwältigende Dominanz interner, reflexiver Funktionen gegenüber externen, stimulativen Funktionen – ist ein Ergebnis der protokulturellen Entwicklung.«
Welsch 2012: 722
In diese protokulturelle Evolution wird auch der sexuelle Dimorphismus einbezogen und führt über die Familialisierung des Mannes zur einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, die nicht mehr nur Natur, sondern Institution ist. (vgl. Dux 1994)
Dass geschlechtstypische Dispositionen für menschliches Verhalten überhaupt eine Rolle spielen, dürfte daran liegen, dass die Entwicklung des sexuellen Dimorphismus wesentlich älter ist als die Entwicklung des spezifisch menschlichen Gehirns. Menschliche geschlechtstypische Dispositionen sind gewissermaßen das, was der Prozess der Hominisierung vom Dimorphismus der Säugetiere und Primaten übriggelassen und in das entstehende System menschlicher Arbeitsteilung einbezogen hat, und zwar mit dem Effekt einer Aufweichung der Bestimmungskraft geschlechtstypischer Dispositionen.
Erhalten bleibt eine dimorphe emotionale Konfiguration, die sich als biologisches Moment in die entstehende kulturelle Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern integriert, die aber ebenso wie die generelle menschliche Instinktkonfiguration durch kulturelle, und das heißt: durch Reflexionsprozesse mediatisiert wird. »Mediatisierung« soll dabei im Sinne der obigen Psychologismuskritik zum einen bedeuten, dass die Kapazität zu höheren Bewusstseinsleistungen beiden Geschlechtern gemeinsam ist, da die empirisch-psychologischen Prozesse von ihnen transzendiert werden, und zum anderen, dass Kultur jenen Mechanismus des »Triebaufschubs« bereitstellt, der eine rationale Selbststeuerung des eigenen impulsiven Verhaltens bei beiden Geschlechtern gestattet.
Geschlechtstypisches Verhalten wird also nicht durch Kompetenz, sondern durch Performanz umrissen, nicht durch Können, sondern durch Wollen: Männer und Frauen können (abgesehen von einem zahlenmäßig geringfügigen Bereich von Extremleistungen) dasselbe, allein besagte dimorphe emotionale Konfiguration wird durchschnittliche Abweichungen im tatsächlich gewollten Verhalten bewirken, und zwar paradoxerweise um so mehr, je weniger diese biologisch fundierte Konfiguration durch kulturelle Restriktionen gehemmt wird. Damit gelangen wir zum modernen Geschlechterparadox, das gerade durch die kulturelle Norm einer Schleifung gesellschaftlicher Restriktionen des geschlechtsspezifischen Verhaltens den Boden der biologischen Konfiguration freilegt.
Literatur
- Cassirer, Ernst (1923, 1994), Philosophie der symbolischen Formen. Erster Teil: Die Sprache. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
- Dux, Günter (1994), Geschlecht und Gesellschaft. Warum wir lieben. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
- Husserl, Edmund (2003), Phänomenologische Psychologie. Hamburg: Meiner
- Husserl, Edmund (2009), Logische Untersuchungen. Hamburg: Meiner
- Marquard, Odo (1987), Transzendentaler Idealismus – Romantische Naturphilosophie – Psychoanalyse. (= Schriftenreihe zur Philosophischen Praxis, Band 3) Köln: Dinter
- Roth, Gerhard (1997), Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
- Vollmer, Gerhard (1975, 82002), Evolutionäre Erkenntnistheorie. Angeborene Erkenntnisstrukturen im Kontext von Biologie, Psychologie, Linguistik, Philosophie und Wissenschaftstheorie. Stuttgart – Leipzig: S. Hirzel
- Welsch, Wolfgang (2012), Homo mundanus. Jenseits der anthropischen Denkform der Moderne. Weilerswist: Velbrück

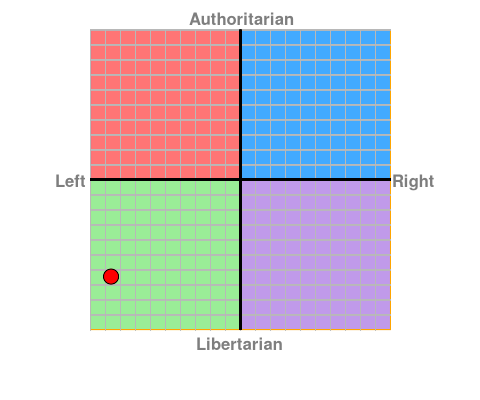
Schreibe einen Kommentar