(20. September 2014)
Nachdem ich bei »Geschlechterallerlei« jetzt einen Tag übernommen habe, aber von der Entscheidung bis zum ersten Vorkommnis desselben die Zeit eher knapp war, nutze ich, nachdem auch schon andere Mitglieder des hiesigen Autorenkollektivs entsprechend verfahren sind, diesen Umstand, um als Eröffnung in einer zwanglosen Plauderei darzustellen, wie zur Männerrechtlerei gekommen bin. Die Vokabel »Plauderei« darf als Warnung aufgefasst werden: der folgende Text ist nicht besonders analytisch und bleibt an der Oberfläche, weil er als analytischer und vertiefender Text den Rahmen eines Blogposts unweigerlich sprengen würde. Ich werde also zunächst ein bißchen biografisch ausholen, aber nicht allzu viele Details nennen, sondern im Telegrammstil ein paar Grundstrukturen beschreiben. Schließlich bin ich für eine gründliche Autobiografie noch nicht berühmt genug.
Linksliberales, bildungsbürgerliches Elternhaus. Behütete Kindheit, danach eine nicht ganz so unbeschwerte Jugend. Beide Eltern berufstätig, die Hausarbeit paritätisch aufgeteilt nach dem Grundmuster: sie Wäsche, er Küche. Beide Eltern arbeiten nicht nur, sie arbeiten auch – es ist das goldene Zeitalter der Psychoanalyse – ihre eigenen Biografien auf. Die Mutter das Opfer eines Kriegsopfers mit episodischen Gewaltausbrüchen, der Vater ein Opfer des Patriarchats. Letzteres meine ich ganz wörtlich: in einem Elternhaus aufgewachsen, das zu jenen Kreisen gehörte, die man »Pietcong« nennt, und in dem alle Familienangehörigen unter der Hausgewalt des frommen Vaters stehen. Auf Widerworte steht, ganz alttestamentarisch, die Prügelstrafe. Biedere Kleingeistigkeit, moralische Überheblichkeit und regelrechte Zwangsheiraten, denn Gott der Herr spricht: es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ein dem Geiste nach prämoderner Kontext also, in dem der Begriff des Patriarchats tatsächlich einen präzisen, deskriptiven Sinn ergibt.
Mit dem Resultat, dass in der betreffenden, chronisch kriselnden Ehe sie zu überkontrollierenden, bei Bedarf mit verbaler Aggression abgesicherten Verhaltensweisen neigt, dagegen er niemals die offene Konfrontation gelernt hat und seine Freiheiten nur durch die Hintertür wahrzunehmen vermag. In dieser Konstellation erreicht der Sohn (über Geschwister plaudere ich hier nichts, ich war aber kein Einzelkind) das Jugendalter, indes die Ehekrise der Eltern sich verschärft und die Beschäftigung der Eltern mit sich selbst dadurch eher noch intensiver wird. Mit den typischen Problemen der Pubertät, nicht zuletzt in sexueller Hinsicht, bleibt der Sohn daher praktisch ohne jeden Beistand, während er zugleich zwischen einer dominanten und zum Teil hoch verbalaggressiven, Abwertung und Verachtung kommunizierenden Mutter und einem psychisch hilflosen Vater eingeklemmt ist. Und von der Mutter dadurch, und zwar ganz ohne ideologische Zutaten, nachhaltig signalisiert bekommt, dass Männer eigentlich nichts anderes sind als ein Schmerz im Arsch der Frauen. Mit dem Resultat, dass er mit einer systematischen Überforderung und einer gründlich beschädigten männlichen Selbstachtung ins Erwachsenenleben startet, und, wenn man das sechzehnte Lebensjahr als Nullpunkt setzt, ungefähr zehn Jahre braucht, um sich davon zu erholen und überhaupt für Frauen beziehungsfähig zu werden. Was er durchaus sein will, denn schwul oder wenigstens bi ist er nicht.
Bis hierhin hat das alles noch nichts mit Feminismus zu tun. Die Mutter war immer stolz auf ihre eigenen Leistungen und hatte für Alice Schwarzer nur Verachtung übrig. Aber nun bewegt sich der Sohn im akademischen Milieu der Sozialwissenschaften, und wo, wenn nicht dort, begegnet er auch erklärten Feministinnen, und obendrein ist eine gute, ältere Freundin von ihm eine undogmatische Linke mit feministischem Hintergrund. Oder eine undogmatische Feministin mit linkem Hintergrund, je nachdem, wohin das Pendel von Haupt- und Nebenwiderspruch gerade ausschlägt. Als Student hat man auch die Zeit, sich mit sich selbst zu befassen, und prompt kommt Erfahrung mit einer Männergruppe hinzu. In der zweiten Hälfte der 80er Jahre fast notwendig das, was später »lila Pudel« genannt werden wird, aber faktisch waren die meisten davon einfach nette Jungs, die über Probleme reden wollten, und dies in dem einzigen Kontext taten, der damals dafür existierte. Nur zwei oder drei von denen waren wirklich ideologisch drauf – bei welchen ich mich schließlich unbeliebt gemacht habe, weil ich ihren Standpunkt als »Sozialarbeiterideologie« bezeichnet habe.
Jedenfalls war das ideologische Umfeld dieser Szene, zumal im universitären Milieu, so beschaffen, dass an den feministischen Glaubenswahrheiten nicht zu rütteln war. Zu der Zeit gab es nur einseitige Studien zu häuslicher und sexueller Gewalt, es schien alles der Stand der Wissenschaft zu sein. Von der amerikanischen Männerbewegung hatte ich damals nur das Stichwort »Schwitzhüttenrituale« gehört und darauf mit einem innerlichen Facepalm reagiert. Außerdem war das die Zeit, in der Schriften wie »Der Untergang des Mannes« von Volker Elis Pilgrim neu aufgelegt wurden (die Originalausgabe war 1973 erschienen) – eine wüste, vulgärsoziologische Räuberpistole vom Manne und seinem Patriarchat, die den Vergleich mit keinem von Radikalfeministinnen verfassten Pamphlet zu scheuen brauchte, und in der der programmatische Satz formuliert wurde, dass der Mann sozial und sexuell ein Idiot sei. Ein Stück weit hat mich damals einer meiner Soziologieprofessoren gerettet, als ich ihm (in einem Seminar über Familiensoziologie) eine Hausarbeit mit tendenziell ähnlichen Aussagen abgeliefert habe – er hat mir sehr freundlich, aber auch sehr klar zu verstehen gegeben, was für einen unglaublichen Scheiß ich da verzapft hatte. Danach war ich sozusagen entgiftet.
Aber ich schweife ab! Der Feminismus trat ja immerhin mit dem Anspruch und Versprechen auf, auch die Männer zu befreien! Sofern und soweit ich aber in feministischen Kontexten über Aspekte meiner Biografie erzählte und diskutierte, über die ganz und gar nicht traditionellen Rollenmuster meines Elternhauses, über weibliche Aggression, aber insbesondere über meine subjektive Unfähigkeit, irgend eine Art von klassischer Männerrolle einzunehmen oder »männliches Verhalten« an den Tag zu legen (wogegen ich gar nichts gehabt hätte, wenn ich gewusst hätte, wie ich das hätte anfangen sollen), kam immer wieder eine Grundnote durch. Eine Grundnote, die meistens sinngemäß, aber tatsächlich auch wörtlich auf die Formel gebracht wurde: »Du willst wohl ‘ne Ausnahme sein?!« Gemeint war selbstredend: eine Ausnahme von der allgemeinen, verkorksten, schädlichen, gefährlichen, herrschenden, privilegierten, hegemonialen (auch wenn es den Begriff damals noch nicht gab) Männlichkeit. Als ich das zum ersten Mal hörte, blieb mir die Spucke weg. Aber mit der Zeit musste ich erkennen, dass diese Verleugnung und Zurückweisung meiner persönlichen Erfahrungen – ich war ja selbst so etwas wie ein wandelnder empirischer Prüfstein für deren Ideologie, nur eben leider ein falszifizierender – System hatte. Es war ein klassischer Fall von »victim blaming« und hinsichtlich dieser nach meinem Elternhaus erneuten Negation nicht meiner Meinungen, sondern meiner Erfahrung war es tatsächlich auch eine Art »Retraumatisierung«. Offenbar schien ich dazu verurteilt zu sein, in Bezug auf Frauen mit meinen eigenen Bedürfnissen und Sichtweisen gegen Mauern der narzisstischen Selbstbezogenheit zu prallen. Ich wusste allerdings, dass ich immer eine »Ausnahme« gewesen war, ich wusste, dass mein Vater eine »Ausnahme« war, dass meine Mutter eine war – ich war mir daher ziemlich gut bewusst, dass es hier nicht um »Ausnahmen« ging, sondern dass in der Unterstellung einer Regel der Fehler lag. Wenn ich durch meine Erfahrung mit dem Feminismus einen Längsschnitt lege und die Quintessenz derselben in einen einzigen Satz kondensieren möchte – dann bietet sich dazu eben jener als rhethorische Frage gekleidete Vorwurf an, den ich als Titel für diesen Blogpost gewählt habe.
Allerdings war ich weder missionarisch noch masochistisch genug, um gegen die Ansprüche (und mindestens im Kontext studentischer Diskurse auch Vorherrschaft) dieser von mir intuitiv als verfehlt erkannten Ideologie einen privaten Feldzug zu beginnen. Ich habe daher einfach die biografische Konsequenz gezogen, dass man sich im Leben mit Feminismus nicht belasten muss. Ich habe daraufhin also getan, was das einzig Gesunde war, und mich zu diesem ideologischen Sumpf in innerliche, nach der Uni dann auch in äußerliche Distanz begeben, denn zu diesem Zeitpunkt hatte ich immerhin einigermaßen gelernt, abzulehnen, was mir nicht gut tat. Ich wurde beruflich und familiär erfolgreich und hatte die Umtriebe des Feminismus irgendwann so weit vergessen, dass ich ungefähr ein Jahr vor dem Kachelmann-Prozess nicht mal genau sagen konnte, ob ich eigentlich etwas gegen Alice Schwarzer habe. Allerdings habe ich nicht aufgehört, den misandrischen Diskurs, der sich in der Öffentlichkeit weiter ausbreitete, zumindest unterschwellig wahrzunehmen.
Bis dann meine Ehescheidung bevorstand. Um es gleich zu sagen: diese erfolgte einvernehmlich und nahm, auch aufgrund einer erfolgreichen Trennungsmediation, einen fairen Ausgang. In Bezug auf die gemeinsamen Kinder besteht zwischen der Mutter und mir ein gutes Kooperationsverhältnis, und die Kinder haben dank räumlicher Nähe auch nicht das Gefühl, jemanden verloren zu haben. Das hat mich jedoch nicht davor geschützt, im Verlauf dieser Trennung in tiefe Ängste zu verfallen und tief in der Kiste meines Mißtrauens und meiner schlechten Erfahrungen zu wühlen – zumal ich, vorzugsweise im Internet, auch mitbekommen habe, wie es anderen Vätern ergeht und welche Zustände in dieser Hinsicht vor deutschen Gerichten herrschen. Und zu dieser Zeit begann ich, die seit dem Auftreten der »Neuen Frauenbewegung« sukzessive entstandenen gesellschaftlichen Verhältnisse wieder bewusst wahrzunehmen. Dazu trugen im Kontext meiner langjährigen »Tätigkeit« als Telepolis-Forent auch solche berüchtigten Artikel wie »Jammernde Väter« von Birgit Gärtner bei.
Zu diesem Zeitpunkt verfügte ich also gleichsam über eine große Schachtel mit Puzzleteilen, aber noch nicht über ein Gesamtbild oder einen Überblick. Immerhin hatte ich die Schachtel geöffnet und suchte nach einem Muster, um diesen Haufen zusammenzusetzen. Und dann war es im Sommer 2011 – wahrscheinlich naheliegend bei jemandem, der zeitlebens umfänglich Bücher gelesen hat – tatsächlich ein Buch, bei dem sich mir die Puzzleteile endlich zusammenfügten, und zwar kein anderes als Arne Hoffmanns »Männerbeben«. Wohl einfach darum, weil es, mit dem Terminus von Clifford Geertz, eine »dichte Beschreibung« der aktuellen Geschlechterverhältnisse darstellt, in der ich mich in Dutzenden von Formulierungen »wiedergefunden« habe.
And here I am. Ich freue mich, in der männerrechtlichen Bloggerszene eine Diskussionsplattform gefunden zu haben, in der ich meine eigenen Standpunkte weiterentwickeln und »testen« kann. Zumal ich die virtuellen Saalschlachten des Telepolis-Forums eigentlich nur noch ermüdend finde und ich auch niemanden dort daran hindern möchte, dumm zu sterben.
Abschließend noch eine kurze Erläuterung, warum ich hier anonym poste und nun auch teilzeitblogge: ich wünschen mir, meine Auseinandersetzung mit dem Thema früher oder später in ein eigenes Buch zu fassen – und falls ich es tatsächlich fertigbringe, dann verlasse ich die Anonymität noch früh genug und wecke bis dahin keine schlafenden Hunde. Und falls das nicht klappt und ich das Ei nicht legen kann, von dem ich hier gackere, dann ist das in der Anonymität wenigstens nicht so peinlich! 🙂 Ich hoffe aber, bis zum nächsten Zwanzigsten zumindest meinen versprochenen Grundsatzartikel zum Thema »Biologie und Kultur« fertigzustellen.

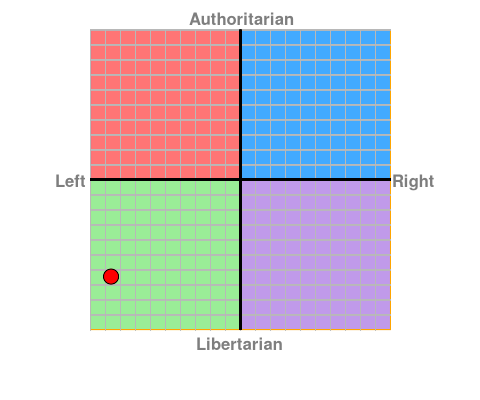
Schreibe einen Kommentar