28. März 2016
Ulrich Kutschera (*1955) ist seit 1992 Inhaber des Lehrstuhls für Pflanzenphysiologie und Evolutionsbiologie an der Universität Kassel und seit 2007 Visiting Scientist an der Stanford University in Kalifornien. Und ist – spätestens seit einem Radiointerview bei Rundfunk Berlin-Brandenburg im Juli 2015 – der leibhaftige Gottseibeiuns des Feminismus und der akademischen Gender Studies. Dies so sehr, dass ihn die Universität Marburg aktuell nicht einmal als Vortragenden zu seinem eigenen Fachgebiet im Studium Generale erträgt. Eine seiner provozierendsten Thesen lautet, dass sich die Fachrichtung der Gender Studies mit der christlich-fundamentalistischen Ideologie des Kreationismus analogisieren lasse, da sie sich in vergleichbarer Weise der Zurkenntnisnahme grundlegender Erkenntnisse der Evolutionsbiologie verweigere. Seine Kritik der Gender Studies hat Kutschera im Februar dieses Jahres unter dem Titel »Das Gender-Paradoxon. Mann und Frau als evolvierte Menschentypen« in Gestalt eines Buch von gut vierhundert Seiten Umfang veröffentlicht, mit dem ich mich im Folgenden auseinandersetzen möchte.
Kutscheras Buch ist eine themenspezifische Zusammenstellung von Befunden der Biologie, die man allesamt auch gängigen Lehrbüchern entnehmen könnte (von denen er selbst eines verfasst hat), die hier aber mit dem ausdrücklichen Ziel präsentiert werden, mit aus der Sicht der Biologie unhaltbaren Behauptungen der Gender-Forschung konfrontiert zu werden. Aufgrund dieser Zielsetzung bietet das Buch keinen systematischen, sondern einen anlassgetriebenen Text. Wollte man ihm einen barocken Untertitel verleihen, so könnte dieser lauten: »Ein Florileg aus Befunden der Evolutionsbiologie, ausgewählt nach Kriterien des Zusammenstoßes mit unvereinbaren Standpunkten der Gender Studies und feministischen Politik, sowie am Leitfaden exemplarischer Konflikte aus Gegenwart und Vergangenheit dargestellt.« Diese Konflikte sind zum Teil Kutscheras eigene Zusammenstöße mit einem debattierenden oder Debatte vortäuschenden Publikum, zum Teil der Presse und Literatur entnommene Beispiele. Aus der Art der Präsentation dieser Konflikte wird sowohl die provozierende Wirkung als auch die potentielle Sprengkraft des Textes ersichtlich.
Kutscheras Argumentation beabsichtigt im Wesentlichen die Begründung folgender Thesen:
(1) Die Gender Studies beruhen in entscheidenden Hinsichten nicht auf seriöser wissenschaftlicher Methodik, sondern auf ideologischen Glaubenssätzen.
(2) Ein wesentlicher Teil dieser Glaubenssätze geht auf die Schriften des amerikanischen Psychologen John Money zurück, die vom Feminismus rezipiert wurden, obwohl ihre wissenschaftliche Unhaltbarkeit bereits in den 60er Jahren nachgewiesen wurde.
(3) Die Gender Studies können aufgrund ihrer Verweigerung der Kenntnisnahme biowissenschaftlicher Erkenntnisse legitimerweise dem religiösen Kreationismus analogisiert werden.
(4) Der Grad der Realitätsverweigerung von Vertreterinnen und Vertretern der Gender Studies trägt analog zum Kreationismus sektenhafte Züge und führt zu im Namen des Feminismus ausgeübten politischen Repressionsversuchen gegen Kritiker.
(1) Für Kutscheras Argumentation grundlegend ist dabei eine Kritik der von den Gender Studies verwendeten Semantik. Während wir den Gebrauch des Begriffspaars »Sex« und »Gender« vornehmlich aus den Kulturwissenschaften kennen (üblicherweise als Unterscheidung von biologischem und sozialem Geschlecht), weist er darauf hin, dass es eine davon unabhängige biologische Bedeutung der Begriffe gibt. »Sex« im biologischen Sinne ist an die Funktion der Fortpflanzung gebunden und bezeichnet die Verschmelzung zweier haploider Gameten (Keimzellen) zu einer diploiden Zygote. Im Falle des Menschen handelt es sich um die Verschmelzung eines Spermiums mit einer Eizelle. Die Funktion der Sexualität besteht darin, durch Rekombination von Chromosomensätzen genetische Variation zu erzeugen. Dieser biologische Mechanismus existiert seit dem Präkambrium, also seit dem Erdzeitalter, in das auch die Entstehung des Lebens selbst fällt.
»Die sexuelle Reproduktion ist somit eine frühe ›Erfindung‹ in der Stammesgeschichte der Organismen«.
Kutschera 2015, S. 231
»Gender« im biologischen Sinne bezeichnet dagegen die »Ausbildung von Männchen und Weibchen, d.h. anatomisch/funktionell verschiedene(n) Geschlechtstiere(n) bzw. Pflanzen«, also den Sexualdimorphismus. (Kutschera 2016, S. 33) Die kulturwissenschaftliche Begriffsverwendung bezeichnet demgegenüber mit »Sex« das »biologische Geschlecht«, also den Sexualdimorphismus, und mit »Gender« eine angeblich sozial konstruierte Geschlechtsidentität.
Hier setzt nun ein erster Widerspruch Kutscheras ein. Geschlechtsidentität ist aus biologischer Sicht niemals »konstruiert«.
»Umfassende Studien belegen … jenseits aller Zweifel, dass das ›Junge- oder Mädchen-Sein‹, verhaltensbiologisch betrachtet, bereits im letzten Drittel der Schwangerschaft einsetzt.«
Kutschera 2016, S. 245
Da die embryonale Geschlechtsdifferenzierung über die Menge des ausgeschütteten Testosterons reguliert wird, verhalten sich
»männliche Embryonen ab dem 6. Schwangerschaftsmonat im Mutterleib ca. 10% aktiver als weibliche Kontroll-Individuen. (…) Diese ›Hyperaktivität‹ (m) ist statistisch hoch signifikant und daher ein biologisches Faktum.«
Kutschera 2016: 245
Das betrifft auch das nachgeburtliche Verhalten: Jungen reagieren aufmerksamer auf bewegte Gegenstände, Mädchen auf Gesichter, Jungen bevorzugen harte Gegenstände wie z. B. Autos als Spielzeuge, Mädchen weiche Gegenstände wie z. B. Puppen. Ähnliches gilt auch für die erotischen (»heteronormalen« vs. »homoerotischen«) Präferenzen: Kutschera zufolge sind diese angeboren, wobei 95% der männlichen und weiblichen Bevölkerung »heteronormal« sind, vier Prozent homoerotisch und ein Prozent trans- oder intersexuell. Kutschera widerspricht damit ausdrücklich der in Degeles Einführungsband in die Gender Studies geäußerten Behauptung:
»Biologische Befunde legen keineswegs die Annahme von Geschlecht als Polarität, sondern als Kontinuum nahe.«
Degele 2008, S. 62
Damit widerspricht er zugleich der Vorstellung, Homosexualität sei etwas, das »gewählt« (feministische Variante) oder »aberzogen« (christlich-fundamentalistische Variante) werden könnte.
Allerdings gilt die »strikte« biologische Festlegung auf Hetero- oder Homosexualität nur für Männer: Frauen sind in dieser Hinsicht biologisch von Männern unterschieden:
»Im Gegensatz zu homoerotisch veranlagten Männern ist die lesbische Zuneigung wesentlich flexibler und auch von Umweltfaktoren gesteuert. Heteronormale Frauen können somit, bei anhaltend negativen Erfahrungen mit Männern sowie unter dem Einfluss politischer Lesben-Propaganda, relativ leicht ›umgepolt‹ werden, entweder vollständig oder nur teilweise.«
Kutschera 2016, S. 259
Der Unterschied ist erneut auf die Fortpflanzung bezogen: während homosexuelle Männer sich nicht fortpflanzen, schließt die lesbische Veranlagung Fertilität und Fortpflanzungswunsch nicht aus, was evolutionär darauf zurückzuführen sei, dass sich Paare von Frauen auch beim Wegfall von Männern erfolgreich als alliierte Mutter-Kind-Dyaden unterstützen können.
Kutschera insistiert auch darauf,
»dass das Phänomen der homoerotischen Neigung in Menschen-Populationen als normale Komponente innerhalb einer naturgegebenen Variabilität des ›Sexualtriebs‹ zu interpretieren ist. Diskriminierungen von LGBTQIA-Personen … sind in keiner Weise durch Sachargumente zu rechtfertigen und nur in einem religiös-politischen Umfeld verständlich«.
Kutschera 2016, S. 260 f.
Homosexualität (bei Kutschera als »Homoerotik« vom Sex-Begriff differenziert) ist also eine »normale Abweichung« von der »Heteronormalität«. Hieraus ergibt sich folgerichtig auch, dass der Verfasser Begriffe wie »Heteronormativität« oder »Zwangsheterosexualität« als pseudowissenschaftliche und ideologiegetriebene Begriffsbildung zurückweist.
Sexuelle Uneindeutigkeiten gibt es nur bei dem einen Prozent der biologisch unter die Kategorie »Disorders in Sexual Development« (DSD) fallenden Individuen. Medizinisch gesehen sind dies beispielsweise Menschen, die das Klinefeltersche oder Turnersche Syndrom aufweisen, also in der Pubertät entwickelte Individuen mit männlichen Geschlechtsorganen und weiblichen Brüsten, die zeugungsunfähig sind, sowie kleinwüchsige, weiblich aussehende Individuen, die ebenfalls unfruchtbar sind.
»Über die Frage, ob man Personen, die man in die Kategorie ›DSD‹ stellt, als ›gesund‹ oder ›krank‹ deklarieren sollte, wird noch kontrovers diskutiert. Auch der biomedizinische Begriff ›Disorder‹ ist fragwürdig, da er eine Wertung beinhaltet. Es ist angemessen, völlig wertneutral von ›intersexuellen Menschen‹ zu sprechen und andere Begrifflichkeiten zu vermeiden. Die populäre Bezeichnung ›Hermaphroditen‹ bzw. ›Zwitter‹ ist, biologisch betrachtet, nicht korrekt: Echte Zwitter … besitzen jeweils ein funktionstüchtiges Paar Hoden und Ovarien. (…) Ein Durchschnittswert von ca. 1% Intersex-Menschen, bezogen auf die bisher untersuchten ethnischen Gruppen der Erde, wird von den meisten Forschern als realistische Abschätzung angesehen«.
Kutschera 2016, S. 219 f.
Der Begriff des »Hermaphroditismus« zählt für Kutschera zu den in mehrfacher Hinsicht ideologisch missbrauchten biologischen Begriffen. Erstens ist der Begriff mit einer feministischen Fehlinterpretation von Charles Darwin verbunden. Eine feministische Autorin, Sarah Richardson, will bei Darwins die Aussage gefunden haben, dass sich seiner Ansicht nach alle Lebewesen »aus einer einzelligen hermaphroditischen Form« (Kutschera 2016, S. 38) entwickelt hätten. Kutschera zufolge hatte Darwin tatsächlich die (aus heutiger Sicht unzutreffende) Überlegung geäußert,
»dass der Vorläufer aller Wirbeltiere (Vertebraten) eine Zwitterform (Hermaphrodit) gewesen sein könnte. Die Geisteswissenschaftlerin Hamlin (2014) sowie ihre Rezensentin (Richardson 2014) haben offensichtlich die Begriffe ›universelle Urform aller Lebewesen‹ mit dem ›entfernten Vorläufer der Wirbeltiere‹ verwechselt«.
Kutschera 2016, S. 39
Zweitens wird die Vorstellung eines ursprünglichen biologischen Hermaphroditismus von der schwedischen Gender-Forscherin Marlin Ah-King vertreten, die im Auftrag des schwedischen Sekretariats für Genderforschung beauftragt worden war, ein Buch über »Genderperspektiven in der Biologie« zu verfassen. Im Rahmen dieser Tätigkeit weilte sie im Wintersemester 2013/14 als Gastdozentin an der Universität Marburg und veröffentlichte dort eine Broschüre gleichen Namens, die auf dem Titel eine zu den in reproduktionsbiologischer Hinsicht hermaphroditischen Lebewesen zählende Meeresqualle abbildet. Damit ist die Intention der Broschüre bereits angedeutet: biologische Konzepte von Geschlechtszugehörigkeit als »gesellschaftlich geprägte Vorstellungen« zu kritisieren. Dem legitimatorischen Rückgriff auf die hermaphroditische Qualle widerspricht Kutschera:
»Es gibt keine belastbaren Fakten, die für einen zwittrigen Ursprung sämtlicher animalischer Lebewesen sprechen würden. Das Gegenteil ist der Fall: Hermaphroditen waren und sind noch heute eher Sackgassen der Evolution, als dass sie innovative Abstammungslinien begründet hätten.«
Kutschera 2016, S. 117
Das hindert die Autorin nicht daran, die Broschüre mit einer Batterie feministischer Vorwürfe an die Biologie zu füllen, die Kutschera zufolge jeder fachlichen Grundlage entbehren.
Drittens ist die Vorstellung des Hermaphroditismus ein Schlüsselkonzept in der Geschlechterpsychologie von John Money, jenes Professors für Pädiatrie und Medizinische Psychiatrie, der für David Reimer zuständig gewesen ist. Bereits in seiner Dissertation von 1952 hatte er sich mit dem Thema des Hermaphroditismus beschäftigt. Kutschera zitiert Moneys erstmals 1955 formulierte und 1963 präzisierte Grundthese wie folgt:
»Anstelle einer Theorie der instinktiven, angeborenen Maskulinität bzw. Femininität zeigt uns die Hermaphroditen-Forschung, dass, psychologisch, die Sexualität des Menschen bei Geburt undifferenziert ist und sich unter dem Einfluss verschiedener Erfahrungen während des Aufwachsens in eine männliche oder weibliche Richtung differenziert. (…) Wie Hermaphroditen, folgen alle Menschen sämtlicher Rassen demselben Muster, d.h. einer psychosexuellen Undifferenziertheit bei der Geburt. (…) Neugeborene männliche Babys können, nach Operation und Hormonbehandlung, in heterosexuelle Frauen umgewandelt werden.«
Kutschera 2016, S. 285
(2) Nicht erst Kutschera hält diese Theorie für Scharlatanerie:
»Nur zehn Jahre nach der 1955 erstmals formulierten ›Gender-Theorie‹ … hat der amerikanische Biologe Milton Diamond in einem ausführlichen Artikel, publiziert im renommierten Quarterly Review of Biology, die Money’sche ›Neutralitäts-bei-Geburt-Theorie‹ der menschlichen Entwicklung Punkt für Punkt widerlegt. (…) Menschen und andere Säugetiere kommen, biologisch bedingt, zu über 99% als Junge oder Mädchen zur Welt«.
Kutschera 2016, S. 285 f.
Bereits Money reagierte auf Kritik an seiner Arbeit in derselben Weise, wie Vertreterinnen und Vertreter der Gender Studies dies heute tun: er denunzierte sie als Antifeministen und Rechtsradikale.
Die Kritik von John Moneys Werk nimmt eine Schlüsselstellung in Kutscheras Kritik ein. Gestützt auf eine aktuelle Publikation der Politikwissenschaftlerin Jemima Repo (The Biopolitics of Gender) vertritt Kutschera die Ansicht, dass John Moneys Einfluss auf die feministische Theoriebildung nachhaltig und grundlegend gewesen ist. (Der Rezensent kann nicht umhin, zu konstatieren, dass ihm damit zum ersten Mal ein lesenswertes, auf Michel Foucault beruhendes sozialwissenschaftliches Werk von einem Biologen zur Kenntnis gebracht wurde.) Kutscheras Kritik an John Money ist dabei unweigerlich verbunden mit einer Kritik von Moneys Handhabung des Falls Bruce Reimer, auf die wir nun eingehen müssen. Bruce und Brian Reimer waren 1965 geborene Zwillinge.
Aufgrund eines ärztlichen Kunstfehlers bei einer versuchten Entfernung der Vorhaut mit einem elektrischen Gerät wurde der Penis von Bruce nicht wiederherstellbar zerstört. Die Eltern wandten sich an den damals bereits renommierten John Money, der den Eltern anbot, eine auf seine Theorien zum Hermaphroditismus gestützte Geschlechtsumwandlung von Bruce vorzunehmen und über die Zeit seines Aufwachsens zu begleiten. Money bot seine Leistung unentgeltlich an, weil er in dem Fall eine Möglichkeit sah, seine bereits in der Kritik stehende Theorie zu beweisen. Die nicht wohlhabenden Eltern nahmen das Angebot an, was jedoch zu einer Verzerrung der Rückmeldungen über den nun als das Mädchen »Brenda« aufwachsenden Jungen führte, da die Eltern dazu neigten, Moneys vorgefasste Erwartungen zu bestätigen. Dass »Brenda« sich weiterhin als Junge fühlte und sich im sozialen Umfeld auch so verhielt, drang nicht bis zu Money durch.
Das ist aber noch nicht alles. Money war auch ein Anhänger der Vorstellung, dass der Umgang pädophiler Erwachsener mit minderjährigen Jungen und Mädchen straffrei sein solle. Kutschera erwähnt dies nicht um einer bloßen Denunziation willen, sondern weil dies im Fall Reimer eine wichtige Rolle spielt: die Eltern von Brian und »Brenda« gaben ihre Kinder im Zuge der psychologischen Begleitung regelmäßig in die Obhut John Moneys. Der Biograph von Bruce Reimer (Bruce nannte sich ab dem 14. Lebensjahr »David«), John Colapinto, schilderte den Ablauf solcher »Betreuungen«: Da Money an den Reimer-Geschwistern als Zwillingen interessiert war, besuchten ihn jeweils beide in seiner Praxis in Baltimore. Money verhielt sich den Kindern gegenüber – in Abwesenheit der Eltern – jedoch aggressiv und tyrannisch autoritär und verlangte von ihnen im Alter von acht Jahren unter anderem, zur Einübung in ihre jeweilige Geschlechtsrollen Kopulationsübungen auszuführen.
»Der zum Mädchen umoperierte Junge war bereits mit 8 Jahren erheblich traumatisiert und hatte panische Angst vor seinem Peiniger.«
Kutschera 2016, S. 293
Nach heutigen Maßstäben handelt es sich hierbei um nichts anders als um sexuellen Kindesmißbrauch – weil der Fall Reimer aber als Schlüsselerzählung der Gendertheorien Karriere gemacht hat, scheint ein großer Teil der feministischen Theorie geneigt, darüber hinwegzusehen.
Solche Fälle von Ignoranz innerhalb des Feminismus erklären, warum Kutschera seine Kritik immer wieder in Form einer robusten Polemik äußert:
»Der fanatische Kinderschänder Money gab aber nicht auf – er musste der Psycho-Fachwelt gegenüber beweisen, dass seine Gender-Theorie korrekt ist.«
Kutschera 2016, S. 295
Angesichts der geschilderten Sachverhalte erscheinen solche Formulierungen freilich nicht unangemessen. John Money hat nicht nur das Leben von Bruce/David Reimer, sondern auch das seines Bruders Brian zerstört: die Vorbelastungen durch das von Money verschuldete Martyrium ihres Aufwachsens führte dazu, dass sich Brian im Jahr 2002 und David im Jahr 2004 in einer jeweiligen persönlichen Krise das Leben nahmen. John Money hat an seinen Theorien bis zu seinem Tod im Jahre 2006 festgehalten und jegliche Kritik von sich gewiesen. Wenn wir aber für die Bereitschaft, ohne Rücksicht auf das Leiden seiner Opfer Menschenversuche zur Bestätigung obskurer Theorien durchzuführen, nach einer historische Analogie suchen, dann dürfte sich John Money wohl als der Josef Mengele des Feminismus qualifizieren. Denn wer sich in einem Einzelfall derart pathologisch und rücksichtslos verhält wie Money im Fall Reimer, der ist am Verschulden weiterer Fälle nicht durch innere Schranken, sondern nur durch den Mangel an äußerer Gelegenheit gehindert. Man stelle einen John Money in dieselbe Position mit derselben Machtvollkommenheit wie einen Josef Mengele, und er wird dieselbe Art von Verbrechen begehen.
Eine Feministin, die den Fall Reimer kurz vor seinem Tod noch einmal aufgegriffen hat, ist niemand anderes als Judith Butler in einem Kapitel ihres Buches Undoing Gender (deutsch: Die Macht der Geschlechternormen, Butler 2009), worauf Kutschera im Rahmen seiner Kritik verweist. Butler überschreibt das Kapitel mit »Jemandem gerecht werden. Geschlechtsangleichung und Allegorien der Transsexualität«. Es ist hier nicht der Platz, um Butlers Argumentation im Detail zu erörtern. Es lässt sich aber anmerken, dass sie an entscheidender Stelle die Pointe verfehlt. Obwohl sie Moneys Vorgehensweise durchaus kritisch sieht und für »gewaltsam« hält, argumentiert sie so, als ob Bruce/David niemals ein eindeutig männliches Kind gewesen sei. Die operative Wiederherstellung einer männlichen Anatomie Davids hält sie für eine »künstlich herbeigeführte Natürlichkeit« (Butler 2009, S. 110), sie behauptet: »So, wie sie uns übermittelt wird, beweist die Geschichte keine der beiden Thesen.« (Butler 2009, S. 111), und sie beschreibt die Bemühungen der Kritiker Moneys, Diamond, Sigmundsen und Colapinto als Versuche, »mit Hilfe seiner (Davids) diskursiven Äußerungen die Wahrheit über sein Geschlecht zu ermitteln« (Butler 2009, S. 112) – ganz so, als sei diese Wahrheit nicht bereits zum Zeitpunkt seiner Geburt bekannt gewesen und durch den ursprünglichen Unfall und die spätere Moneysche »Therapie« bloß verschüttet worden. Was Judith Butler mit ihrer Argumentation in Undoing Gender vollzieht, ist dasselbe wie schon in Gender Trouble: »Undoing Biology«: diskursives Unsichtbarmachen der Biologie auf sprachlich hohem Niveau.
(3) Kutschera sieht in John Moneys Theorien gewissermaßen den Prototyp für die von ihm als »Biophobie« bezeichnete Rezeptionsverweigerung biowissenschaftlicher Erkenntnisse durch den Feminismus im Allgemeinen und die Gender Studies im Besonderen. Diese Verweigerung analogisiert er dem Verhalten von Vertretern des christlich-evangelikalen Kreationismus, über den er bereits ein Buch herausgegeben und mitverfasst hat (vgl. Kutschera 2007). Der Kern der Analogie ist der Glaube an eine voraussetzungslose Schöpfung des Menschen – als physisches Wesen durch Gott, als geschlechtlich definiertes Wesen durch die Einflüsse der menschlichen Kultur – der nur darum möglich ist, weil empirisch wohlbegründete Befunde der Biowissenschaften ignoriert und diffamiert werden.
»Das Fundamental-Dogma aller Gender Studies ist die Annahme, das Geschlecht des Menschen sowie andere gesellschaftliche Phänomene würden ›sozial konstruiert‹ werden. Mit diesem durch keinerlei empirische Fakten belegbaren Glauben verfolgen die Sozial-Konstruktivisten ein politisches Ziel. (…) Völlig analog denken und argumentieren die deutschen Kreationisten. Deren Glaubenssatz lautet, der biblische Schöpfergott (bzw. der Intelligent Designer) hätte vor maximal 10.000 Jahren ›Grundtypen des Lebens‹ ins Dasein gerufen. Diese ›göttlich konstruierten Basiswesen‹ … hätten sich dann über fiktive Hochgeschwindigkeits-Mikroevolutionsprozesse zur rezenten Biodiversität weiterentwickelt. Das politische Ziel der Intelligent-Design (ID)-Kreationisten ist es, u.a. über Evangelische Bekenntnisschulen christlich-religiöse Missionierung zu betreiben.«
Kutschera 2016, S. 394 f.
(4) Wie Kutschera seinen Vorwurf des feministischen Sektierertums rechtfertigt, möchte ich an einer besonders provokant wirkenden Aussage erläutern. Im Rahmen des Human Genome Projects wurden im Jahre 2005 Forschungsergebnisse publiziert, die konstatierten, dass anders als zuvor vermutet die genetischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen wesentlich größer waren als zuvor.
»Fachleute schlussfolgerten 2005, dass wir nicht von ›einem menschlichen Genom‹ sprechen können …, sondern dass in der Realität zwei Genome vorliegen: das Männliche und das Weibliche.«
Kutschera 2016, S. 220
Einer dieser Fachleute wies darauf hin, dass bei einer genetischen Abweichung von 1,5 % zwischen dem männlichen und weiblichen Genom der Abstand ebenso groß ist wie der genetische Abstand zwischen homo sapiens und pan troglodytes – dem Gemeinen Schimpansen. Diese Feststellung zog aggressive feministische Reaktionen nach sich. Wenn das Human Genome Project an dieser Stelle korrekt gearbeitet hat, dann handelt es sich bei dem Befund freilich um eine Tatsache und nicht um eine Geschmacksfrage der Politischen Korrektheit. Problematisch ist dieser Befund nur dann, wenn man ihn von vornherein in einem Kontext von Unterstellungen liest. Zum einen provoziert der Befund dadurch, dass er der zum Dogma gewordenen Lehrmeinung widerspricht, nicht nur Männer untereinander und Frauen untereinander seien genetisch zu 99,9% gleich, sondern auch Frauen und Männer.
Zum anderen dürfte die Provokation einer Lesart geschuldet sein, in der feministische Interpreten darauf geeicht sind, stets und überall männlich-weibliche Hierarchien sowie Abwertungs- und Unterdrückungsverhältnisse zu erwarten. In diesem interpretativen Rahmen ist es nahezu zwangsläufig, dass der Befund als Höherwertung des Mannes und als Abwertung von Frauen zum Schimpansen gedeutet wird. Tatsächlich insistiert Kutschera aber darauf, dass die Evolutionsbiologie nicht von einem hierarchischen, sondern von einem Komplementärverhältnis der beiden menschlichen Geschlechter ausgeht, das mit einer ursprünglichen Arbeitsteilung korrespondiert und in evolutionären Zeiträumen entstanden ist. Die Deutung der Geschlechterbeziehung als Hierarchie ist dagegen eine Voreingenommenheit, die nicht der Biologie, sondern der feministischen Erwartungshaltung entstammt. Die feministische Kritik des biologischen Befundes wird auf diese Weise zum Opfer ihrer eigenen »sozialen Konstruktion« von Deutungsmustern.
Dies führt dazu, dass die Vertreterinnen und Vertreter der Gender Studies sich reflexhaft gegen jede Infragestellung ihres Weltbildes sperren und darauf mit politischen Denunziationen reagieren. Das geschieht nicht nur auf der Ebene von feministischen Politkommissaren, die einen Vortrag Kutscheras im Studium Generale der Universität Marburg verhindern wollen, sondern auch im Prozess feministischer »Wissenskonstruktion« selbst. Ein auch von Kutschera genannter Sammelband (Hark/Villa 2015) beispielsweise reagiert auf die inhaltliche biowissenschaftliche Kritik an den Gender Studies mit der Konstatierung einer »anti-genderistischen« politischen Diskurses, für den konservative und politisch rechtsstehende öffentliche Äußerungen durchforstet werden.
Damit wird insinuiert, die Kritik an der Gender Studies bestünde in nichts anderem als solchen politischen Statements und nicht zuallererst auch in biowissenschaftlichen Einwänden. Die Editorinnen Hark und Villa selbst verwechseln notorisch die Ebene einer kulturellen Konstruktion von Geschlechtsrollen mit den Befunden zu einer biologischen Geschlechtsidentität und wollen schon in der Biologie des 19. Jahrhunderts nichts anderes sehen als eine ideologische Veranstaltung zur Rechtfertigung der bürgerlichen Geschlechtsrollen, mit denen zumindest für einen bestimmten Zeitraum die Verweigerung höherer weiblicher Bildung verbunden gewesen ist. Kutschera zeigt dagegen auf, dass auch die Biologie des 19.Jahrhunderts zum Thema des Geschlechts bereits für die Gegenwart wegweisende Erkenntnisse erarbeitet hat, die sich nicht mit dem Vorwurf einer ideologischen Fixierung beiseite wischen lassen.
Er demonstriert, dass die Biologie des 19. Jahrhunderts unabhängig von ihrem ideologischen Mißbrauch auch heute noch gültige Wissensbestände über den Mensch und die Geschlechter erarbeitet hat, und dass Vertreter der Naturwissenschaften durchaus auch in der Lage waren, progressive Konsequenzen aus ihren Forschungen abzuleiten. Die Darstellung der Biologie des 19. Jahrhunderts als einer durchgängig und prinzipiell von Rassismus und Sexismus kontaminierten Wissenschaft ist daher eine unzulässige Geschichtsklitterung. Diese Argumentation hat auf Seiten der Sozialwissenschaften dazu geführt, die sozialkonstruktivistische Methodenlehre für der naturwissenschaftlichen Begriffs- und Urteilsbildung grundsätzlich überlegen zu halten und das Urteil unter Schlagworten wie »Szientismus«, »Positivismus« oder »Essentialismus« auf die Biologie als Ganzes, also auch auf ihre späteren und heutigen Vertreter auszudehnen.
Diese Folgerung ist nicht jedoch nicht nur nicht zu rechtfertigen, sondern hat obendrein die Fähigkeit der Sozialwissenschaften zu einer interdisziplinären Debatte mit den Naturwissenschaften schwerwiegend beeinträchtigt. Dies ist nicht nur im Kontext des Feminismus geschehen: so war beispielsweise der von Jürgen Habermas an Sigmund Freud gerichtete Vorwurf eines »szientistischen Selbstmissverständnisses« rezeptionsgeschichtlich überaus folgenreich, obwohl er sich in der Sache schließlich als eklatant verfehlt herausgestellt hat und Habermas seinen eigenen Ansatz in dieser Frage nur wenige Jahre später nicht mehr weiter verfolgt hat. In der Folge hat sich insbesondere in den mit politischen Forderungen überfrachteten Bereichen der Sozialwissenschaften wie den Gender Studies die Ignoranz und Verdrängung der Naturwissenschaften zu einer aktiv betriebenen Rezeptionsblockade und Verdrängung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse verselbständigt.
Am Ende verrennt sich die feministische Kritik in eine bloße Projektion ihres eigenen Verhaltens auf das Gegenüber. Die eingeübte Praxis, überall »soziale Konstruktionen« und Ideologien zu erwarten und zu sehen, führt zum Verlust der Fähigkeit, Begriff und Methodik der naturwissenschaftlichen Empirie überhaupt noch verstehen zu können. Die »diskursive Macht« und »diskursive Herrschaft«, die Feminismus und Gender Studies allerorten am Werke sehen, wird von ihnen gegen die Biowissenschaften selbst ausgeübt. Die Gender Studies beruhen konstitutiv auf einem aktiven, mit diskursiver und politischer Gewaltausübung bewehrten Unsichtbarmachen der Biologie.
Da sie gesichertes biologisches Wissen über mittlerweile Jahrzehnte hinweg fehlinterpretiert, ignoriert, ausgegrenzt, verleugnet, denunziert und diskursiv unsichtbar gemacht haben, überrascht es nicht, dass deren Vertreterinnen angesichts von Kutscheras Thesen nunmehr aus allen Wolken fallen. Die Empörung über Kutscheras Polemik ist dabei ein bloß vorgeschobener Grund: sie verdeckt, dass Gender Studies und Feminismus der biowissenschaftlichen Kritik praktisch niemals auf der inhaltlichen Ebene begegnet sind – weil sie im Lichte dieser Argumente zu Staub zerfallen würden wie Graf Dracula in der Sonne.
Kutscheras Buch enthält noch viele weitere Einzelthemen und provokante Formulierungen, auf die hier nicht im Einzelnen eingegangen werden kann. An dieser Stelle mag jedoch die Frage aufkommen, ob denn der Rezensent an Kutscheras Buch überhaupt nichts zu kritisieren hat. Angesichts dessen, was ich für die wesentliche Leistung des Buches halte, fällt dieser Part tatsächlich gering aus. Zu nennen wäre der oftmals tatsächlich etwas hölzerne, hausbackene und altväterliche Stil. An einigen Stellen entgleitet Kutschera auch die Genauigkeit des eigenen Arguments: so kritisiert er im Zusammenhang eines Berichts über eine Unterrichtseinheit zur Sexualerziehung das Verhalten des Lehrers in Bezug auf männliche und weibliche Körperkraft. Dort geht es um die vergleichsweise banale Frage, ob man immer nur Jungen einen Overheadprojekt tragen lassen soll. Kutscheras Einwand lautet:
»Junge Männer haben eine erheblich höhere Muskelmasse als gleichaltrige Mädchen und einen ganz anderen, auf mechanische Arbeit hin evolvierten Körperbau. Daher ist es vernünftig und sinnvoll, dass die Jungen, und nicht die pubertierenden Mädchen den Overhead-Projektor zu tragen haben (Sexual-Dimorphismus)«
Kutschera 2016, S. 315
Hier unterläuft Kutschera ersichtlich der Fehlschluss vom statistischen Mittel auf den Einzelfall, den er in seiner sonstigen Argumentation selbstredend kennt. (Als Vater von zwei schulpflichtigen Kindern fallen mir sofort real beobachtete Konstellationen ein, in denen dieser »Schleppdienst« definitiv von einem kräftig gebauten Mädchen anstatt von einem schmächtig gebauten Jungen geleistet werden müsste.) Hier wird man bei Kutschera wachsam sein dürfen, ohne darum die grundsätzliche Plausibilität seiner Argumente verwerfen zu müssen. Generell wird man von ihm aber nicht die Beantwortung der Frage erwarten, auf welche Weise sich bestimmte physiologische und psychologische Geschlechterdispositionen in soziale Praktiken und Institutionen übersetzen. Dies ist die Aufgabe einer kulturanthropologischen Soziologie, welche die Biologie als benachbarte Grundlegungswissenschaft für die eigene anthropologische Ausgangsposition ernst nimmt anstatt sie zu ignorieren oder politisch zu verdammen.
Literatur:
- Butler, Judith (2009), Die Macht der Geschlechternormen und die Grenzen des Menschlichen. Frankfurt a. M.: Suhrkamps
- Degele, Nina (2008), Gender / Queer Studies. Eine Einführung. Paderborn: Wilhelm Fink (UTB)
- Hark, Sabine; Villa, Paula-Irene (2015), »Eine Frage an und für unsere Zeit«. Verstörende Gender Studies und symptomatische Missverständnisse. In: dies. (Hrsg.): Anti-Genderismus Sexualität und Geschlecht als Schauplätze aktueller politischer Auseinandersetzungen. Bielefeld: transcript, S. 14-39
- Kutschera, Ulrich (2007)(Hrsg.), Kreationismus in Deutschland: Fakten und Analysen. Berlin: Lit-Verlag
- Kutschera, Ulrich (2006, 2015), Evolutionsbiologie. Ursprung und Stammesentwicklung der Organismen. 4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart: Eugen Ulmer (UTB)
- Kutschera, Ulrich (2016), Das Gender-Paradoxon. Mann und Frau als evolvierte Menschentypen. Berlin: Lit-Verlag
- Repo, Jemima (2016), The Biopolitics of Gender. Oxford – New York: Oxford University Press

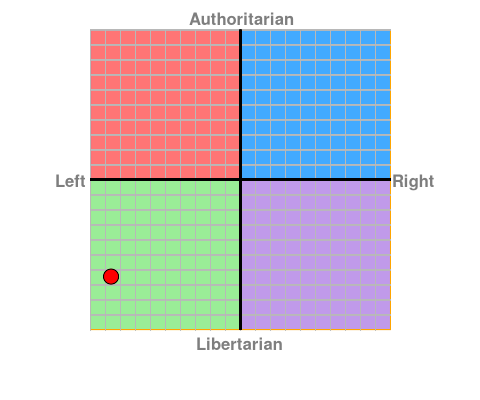
Schreibe einen Kommentar