15. Dezember 2019
Antje Schrupp hat am 22. November dieses Jahres aus Anlass einer Buchvorstellung in Zürich eine Laudatio auf die italienische Differenzfeministin Luisa Muraro gehalten, und seit vergangener Woche ist der Text dieser Rede online verfügbar. In dieser Laudatio ruft sie das Ende des Patriarchats aus, was freilich nur für mich eine Neuigkeit war, denn Schrupp vertritt diesen Standpunkt schon länger. Ich fand ihn jedoch höchst bemerkenswert, weil es nicht nur meiner eigenen Ansicht zu entsprechen schien, sondern auch dem Patriarchats-Gejammer eines Netzfeminismus à la Wizorek, Stokowski und Penny pointiert zuwiderläuft. Bei näherem Hinsehen ist es dann freilich doch nicht, wonach es dem ersten Anschein nach aussieht – dennoch ist ihre Argumentation überaus interessant, wenn man ein Beispiel dafür haben möchte, in welche Widersprüche sich feministische Theorie verwickeln kann. Denn Schrupps Perspektive ist paradox: luzide und blind zugleich, ebenso subjektiv ehrlich wie ideologisch vernagelt. Das macht ihren Text in meinen Augen – im Kontext einiger anderer Texte von ihr und anderen Differenzfeministinnen – zu einem Schlüsseldokument des heutigen Feminismus. Die Zitate stammen, wenn nicht anders vermerkt, aus drei von ihr unter der Rubrik Patriarchat verschlagworteten Artikeln.
Frau sein als Privileg
Schrupp gibt einen reflektierten Rückblick auf ihre eigene Biografie, in dem sie freimütig einräumt, wie wenig unterdrückt und wie privilegiert sie in ihrer Generation gewesen ist:
»Ich bin 1964 geboren und also quasi zusammen mit der Frauenbewegung erwachsen geworden. (…) Ich habe schon früh gespürt, dass ich in einer Zeit lebe, in der es ein Glück ist, eine Frau zu sein. Das wusste ich lange, bevor ich etwas vom Feminismus erfuhr oder gar selbst zur Feministin wurde. Zum Beispiel habe ich mich schon als Jugendliche und als junge Frau als einen Körper wahrgenommen, der bereits für sich genommen, also ganz ohne mein persönliches Zutun, die Rolle eines revolutionären Subjekts hat.«
Ohne eigenes Zutun eine privilegierte Rolle einzunehmen ist ein Geschenk, das in früheren, »patriarchalen« Epochen nur dem Adel zukam. Dass Weiblichkeit adelt, scheint insofern eine biografische Schlüsselerfahrung von Schrupp zu sein.
»Mein Schicksal war nicht das einer unterdrückten Person ohne Möglichkeiten. Mein Schicksal war es, an der Schwelle zu einer besseren Welt das Neue zu repräsentieren.«
Das ist bemerkenswert ehrlich, und zugleich bleibt der Begriff des »Schicksals« unscharf: denn dieses »Schicksal« lässt sich soziologisch einordnen: man kann es als bürgerliches Klassenschicksal auffassen. Die Kulturrevolution der 1960er Jahre war eine Revolution der expandierenden Erwartungen im Kontext einer explosiven Erweiterung der Möglichkeiten der Lebensgestaltung für die Mittelschichten und für jene, die im Begriff waren, dorthin aufzusteigen. Das »Schicksal, das Neue zu repräsentieren« ist ein Privileg einer oder zweier Generationen aus der Mitte des Zwanzigsten Jahrhunderts. Das ist Schrupp im Grundsatz auch bewusst:
»Die Gleichheit war schon da, als ich auf die Welt kam, sie war das Prinzip, mit dem ich aufgewachsen bin. Aber ich war mir im Klaren darüber, dass sie noch ganz frisch war.«
Nicht viele unserer Feministinnen haben ein Bewusstsein dafür, dass ihre eigenen Erfolge auf gesellschaftlichen Voraussetzungen beruhen, die sie nicht selbst geschaffen haben. Allerdings scheint Schrupp der Ansicht zu sein, dass sich der Verdienst zwar nicht ihrer Generation, aber doch hauptsächlich der Neuen Frauenbewegung zuschreiben lässt:
»Die Frauenbewegung ist eine der erfolgreichsten sozialen Bewegungen überhaupt. Sie hat unsere Welt in einem Maß verändert, wie keine andere soziale Bewegung. (…) Es war nicht einfach der Lauf der Dinge, der das alles bewirkt hat, sondern die Liebe der Frauen zur Freiheit.«
Hier ist fällt die implizit vollzogene Polarisierung der Geschlechter gegeneinander auf: kannten nur Frauen bzw. Feministinnen eine »Liebe zur Freiheit«? Wo waren die Männer, als sich seit dem 16. Jahrhundert Freiheitsbewegungen gegen die absolutistische Herrschaft wendeten? Und waren es nicht ohnehin ganze soziale Schichten, die auf ihre jeweilige Art und Weise eine Liebe zur Freiheit entwickelten, nämlich Männer und Frauen gemeinsam? Und hat eine solche Gemeinsamkeit denn wirklich gar nichts zum Erfolg der Frauenbewegung beigetragen?
Der Optimismus der 1960er und 1970er Jahre hat sich mit der Zeit abgenützt, und die Erfahrungen der Generation, aus der die heutigen Netzfeministinnen stammt, stammen aus einer neuen Epoche – einer vielleicht nicht im strikten Sinne schlechten, aber einer mit unklaren Perspektiven, größeren Ängsten und größeren Unsicherheiten, denen es subjektiv nicht allzu viel zu helfen scheint, dass sie auf vorausgehenden Errungenschaften aufbauen können. Auch das ist Schrupp aufgefallen:
»Allerdings bedeutet das eben auch, dass die jüngeren Frauen das Patriarchat aus eigener Anschauung gar nicht mehr kennen. Manchmal, wenn sie sich auf Twitter über irgendetwas aufregen, ertappe ich mich dabei, innerlich zu denken: meine Güte, das ist doch Pillepalle im Vergleich zu dem, was früher war.«
Das sieht die Generation der vierten feministischen Welle offenkundig anders: die Wahrnehmung ihrer im Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung in höherem Maße verunsicherten Generationslage dürfte dazu geführt haben, dass sie den Begriff des »Patriarchats« wieder haben aufleben lassen, obwohl ihm tatsächlich die empirische Grundlage fehlt: sie benötigen ihn, um alles das darauf zu projizieren, was ihnen an unserer Gegenwart bedrohlich erscheint. Denn die heutige Generationserfahrung verkennt ihre historischen Voraussetzungen:
»Allerdings kennen sie eben heute auch das Glück nicht mehr, qua Geschlecht bereits ein revolutionärer Körper zu sein. Was für mich als junge Frau neu und – ja – beglückend war, nämlich eine Zeit nach dem Patriarchat zu verkörpern, ist für sie nicht mehr beglückend, sondern normal. Über etwas Normales freut man sich nicht.«
Und man nimmt diese Zeit »nach dem Patriarchat« erst gar nicht als Tatbestand wahr. Man realisiert nicht, wie sehr die Rede vom Patriarchat eine Fiktion konstruiert, einen kulturellen Code zur Symbolisierung eines Unbehagens im gesellschaftlichen Lebenszusammenhang, der, um im Alltag sinnlich greifbar zu werden, auch den konkreten Mann als Sündenbock konstruieren muss, indem man ihm eine »hegemoniale« und »toxische« Männlichkeit andichtet. Es scheint also, als hätte Schrupp sich einen nüchternen, kritisch-distanzierten Blick auf die Verhältnisse bewahrt. Dass dem dann doch nicht so ist, wird im weiteren Verlauf des Textes klar, in dem sie ihre eigene Position darlegt, die sie im Anschluss an den italienischen Differenzfeminismus am Beginn dieses Jahrhunderts entwickelt und formuliert hat.
Antje Schrupps Differenzfeminismus bedeutet, dass ihr der politische Fokus auf die Gleichheit von Männern und Frauen verdächtig erscheint. Der Kontext ihrer Laudation ist die Präsentation der deutschen Übersetzung eines Buches von Luisa Muraro, das 2011 unter dem Titel Non è da tutti. L’indicibile fortuna di nascere donna veröffentlicht und nun ins Deutsche übersetzt wurde. Muraro vertritt in »Vom Glück, eine Frau zu sein« die These, dass Weiblichkeit ein Privileg und Adelsprädikat ist, ganz explizit: es handelt sich um
»ein Privileg wie jenes, das den Menschen in den alten aristokratischen Gesellschaften durch adlige Geburt zuteil wurde: Du bist der Sache vielleicht nicht gewachsen, aber das Privileg kannst du nicht verlieren. Ebenso wenig wie du es dir verdient hast.«
Luisa Muraro, zit. n. Dorothee Markert
Worin dieses Privileg besteht, spricht Schrupp mit ebenso verblüffender wie aufschlussreicher Klarheit aus:
»Das Gute an der Vorstellung vom Frausein als Privileg ist, dass damit alle Vorstellungen verdrängt werden, die das Frausein als etwas verstehen, das man sich erarbeiten muss, dessen man sich würdig erweisen muss. Das war die große Lüge des Patriarchats – ein richtiges Mädchen macht sich nicht schmutzig, eine richtige Frau hält die Wohnung in Ordnung, eine gute Frau schminkt sich nicht oder schminkt sich unbedingt, je nachdem welche Zeit. Hingegen Frausein als Privileg – das erlaubt uns zu sagen: screw you! Ich bin eine Frau, und ich muss gar nichts!«
Das entspricht der konventionellen Vorstellung, der zufolge Männer sind, was sie tun, und Frauen sind, was sie sind, human doing und human being [Anm. 19.12.2022: Link zu Warren Farrell nicht mehr erreichbar]. Die weibliche Existenz bedarf keiner Rechtfertigung, diese steht durch die ihr gegebene Fähigkeit, Kinder zur Welt zu bringen, immer schon außer Frage, und auf diese Fähigkeit bezieht sich auch Schrupp. Was zu Anfang wie ihre Fähigkeit zur kritischen Selbstbetrachtung aussah, schlägt hier ins Gegenteil davon um: in eine atemberaubende Selbstbezüglichkeit, die ernsthaft davon auszugehen scheint, nur Frauen hätten gesellschaftliche Zumutungen abzuschütteln.
Denn warum gilt nicht auch der äquivalente Satz: »Ich bin ein Mann, und ich muss gar nichts!«? Abgesehen davon, dass einem Mann eine solche Einstellung zweifellos als »patriarchales Privileg« ausgelegt würde, stellt sich die Frage, warum in einer Gesellschaft überhaupt jemand irgendetwas »soll«? Gibt es wirklich keinerlei Erwartung, die die Gemeinschaft oder Gesellschaft an Einzelne zu richten ermächtigt wäre? Wenn wir uns Rechenschaft darüber ablegen, wie unser soziales Leben tatsächlich funktioniert, erkennen wir unmittelbar, dass eine solche Behauptung absurd ist. Zusammenleben funktioniert schlechterdings nicht ohne kollektive Erwartungen an Einzelne. Wie kommt es dann aber zu jener feministischen Polarisierung der Geschlechter, die gesellschaftliche Erwartungen an Frauen ohne Umweg als patriarchale Herrschaft brandmarkt?
Der Mann als Norm
Judith Butler hatte die These aufgestellt, dass die männliche und weibliche Geschlechtsidentität strikt relational, also durch eine Beziehung des gegenseitigen Ausschließens bestimmt sei:
»Die Instituierung einer naturalisierten Zwangsheterosexualität erfordert und reguliert die Geschlechtsidentität als binäre Beziehung, in der sich der männliche Term vom weiblichen unterscheidet.« (Das Unbehagen der Geschlechter, Suhrkamp 1991, S. 46)
Aus einer solchen relationalen Bestimmung der Geschlechter möchte Schrupp und der von ihr vertretene Differenzfeminismus aussteigen:
»Sind Frauen und Männer gleich oder unterschiedlich? Sind die Unterschiede biologisch, kulturell, sozial zu erklären? Wollen wir sie abschaffen, verändern, beibehalten, neu definieren? An dieser Frage waren die feministischen Diskussionen meiner Meinung nach lange auf einem Holzweg: Weil nämlich die Frage: Was ist eine Frau? versucht wurde, im Vergleich zu: Was ist ein Mann? zu beantworten. Was eine Frau ist, das hängt aber nicht davon ab, was ein Mann ist, sondern davon, was eine Frau tut, will, was sie sagt und wie sie handelt.«
Das impliziert auch eine Absage daran, »Frauen« als eine einheitliche Gruppe zu sehen, in deren Namen man auftreten könne. Differenzfeminismus im Sinne von Luisa Muraro meint nicht nur eine spezifische Unterschiedenheit der Frauen von den Männern, sondern auch eine Unterschiedlichkeit aller Frauen untereinander:
»Die zentralen Punkte in ihrer Argumentation sind: Die Aufforderung, nicht länger von einem ›Wir‹ der Frauen zu sprechen, von den Frauen als einer Gruppe, in deren Auftrag ›der Feminismus‹ sozusagen unterwegs ist, denn dieses ›Wir‹ macht nur Sinn in Abgrenzung von ›den Männern‹, die man damit als Norm akzeptiert.«
Die Kritik an einer Vorstellung, dass Männer sich als Norm des Menschlichen bzw. des Menschen betrachten, ist ein lang etablierter Topos der feministischen Kritik, der auf Simone de Beauvoir zurückgeht, die formuliert hatte:
»Das Verhältnis der beiden Geschlechter ist nicht das von zwei Elektrizitäten, zwei Polen: Der Mann ist so sehr zugleich der positive Pol und das Ganze, daß im Französischen das Wort ›homme (Mann)‹ den Menschen schlechthin bezeichnet … . Die Menschheit ist männlich, und der Mann definiert die Frau nicht an sich, sondern in Beziehung auf sich; sie wird nicht als autonomes Wesen angesehen. (…) Sie wird bestimmt und unterschieden mit Bezug auf den Mann, dieser aber nicht mit Bezug auf sie; sie ist das Unwesentliche angesichts des Wesentlichen. Er ist das Subjekt, er ist das Absolute: sie ist das Andere.« (Das andere Geschlecht, Rowohlt, S. 10 f.)
Auch dieses »beauvoirsche« Geschlechterverhältnis ist relational im Sinne eines Gegensatzes, aber der Mann stellt zusätzlich das Ganze dar. Vielleicht beschreibt das den Weg, der zwischen dem Erscheinen des Deuxième Sexe (1949) und der Gender Troubles (1990) von der Frauenbewegung zurückgelegt wurde: die Frauen sind aus der Rolle eines untergeordneten, abgeleiteten Bestandteils des Menschlichen ausgestiegen, aber finden immer noch die Zweigeschlechtlichkeit vor, denn Judith Butlers Gegenstand der Kritik ist nicht mehr das Muster des Kompositums, sondern die reine binäre Opposition.
Beauvoir hatte darauf bestanden, dass die Frauen zugeschriebenen Eigenschaften, die negativen wie positiven Klischeevorstellungen, zwar nicht völlig aus der Luft gegriffen, aber darum noch lange nicht in irgendeiner »Biologie der Weiblichkeit« verankert sind:
»Sie macht sich in der Immanenz breit, sie ist ein Widerspruchsgeist, sie ist schlau und kleinlich, sie hat keinen Sinn für Wahrheit, für Genauigkeit, sie ist unsittlich, sie ist auf niedrige Vorteile bedacht, sie lügt, sie schauspielert, sie ist selbstsüchtig … An all diesen Behauptungen ist etwas Wahres. Nur wird ihre Verhaltensweise, die angeprangert wird, der Frau nicht von ihren Hormonen zudiktiert, noch ist sie in den Fächern ihres Gehirns vorgebildet: Im großen und ganzen werden sie ihr durch ihre Situation gegeben.« (Das andere Geschlecht, Rowohlt, S. 567)
Nämlich in der Situation, innerhalb des Menschlichen ein subalternes, partielles, derivatives Element zu sein. Nun hat der Feminismus die Identifikation des Männlichen mit dem Menschlichen schon seit Langem als Fiktion dekonstruiert. Warum ist dann aber auch heute immer noch die feministische Obsession so groß, sich mit dem Männlichen unbedingt zu desidentifizieren? Dass (nicht nur) Antje Schrupp immer noch unterstellt, der Mann sei die Norm des Menschlichen, bedeutet, dass sie sich immer noch an einem vergangenen und obsoleten Bild des Mannes von sich selbst orientiert, anstatt an der eigentlich vom Feminismus selbst korrigierten und realistischeren Perspektive! Das war schon Esther Vilars Kritik gewesen:
»So absurd es klingt: In der heutigen Welt brauchen die Männer die Feministinnen weit dringender als ihre Ehefrauen. Sind diese doch die letzten, die sie noch so beschreiben, wie sie sich selbst gern sähen – eigenwillig, machtbesessen, rücksichtslos und ohne jede Hemmung, wenn es um die Befriedigung ihrer animalischen Instinkte geht. Gerade die aggressivsten Frauenrechtlerinnen arbeiten also der bestehenden Ordnung am unglückseligsten in die Hand. Ohne ihre unermüdlichen Anklagen gäbe es den ›Macho‹ höchstens noch im Kino. Falls unsere Presse sie nicht täglich in Millionenauflagen zu reißenden Wölfen stilisierte, zögen die eigentlichen Opferlämmer dieser ›Männergesellschaft‹, die Männer selbst, wohl schon längst nicht mehr so ergeben in die Fabriken.« (Der dressierte Mann/Das polygame Geschlecht/Das Ende der Dressur, Vorwort zur Neuausgabe in einem Band, dtv 1987, S. 10)
Offenkundig gibt es einen großen feministischen Bedarf, eine sexistische Perspektive auf den Mann beizubehalten. Denn es ist die vielleicht größte Ironie des ganzen Feminismus, dass diese »beauvoirsche« Situationsbindung des menschlichen Verhaltens zwar für die Frau radikal eingefordert, für den Mann aber nicht im Ansatz verstanden wird. Dabei ist es zumindest vorläufig auch unerheblich, ob wir evolutionspsychologisch oder streng sozialkonstruktivistisch argumentieren, denn auch evolutionär entstandene Verhaltensmuster enthalten einen Bezug auf langfristig stabile Umgebungen – was heißt: Situationen.
Denn was ist die archetypische männliche Situation? Sie besteht in der Situationslogik am Perimeter der Gemeinschaft, dort, wo die Männer und Frauen umfassende Gemeinschaft einer externen Umwelt gegenübersteht, deren Gefahren und risikobehaftete Chancen notfalls mit Gewaltgebrauch und unter Einsatz des eigenen Lebens zu bewältigen sind, also in einer Situationslogik, angesichts der über irgendeine Norm und Ordnung zu verfügen immer noch besser ist als über gar keine. Männer verkörperten das »Allgemeine« historisch nicht darum, weil sie inhärent herrschsüchtig, sondern weil sie zu einer Überverantwortlichkeit verdammt waren. Die vermeintlich psychologische Essenz des Männlichen ist in Wirklichkeit eine Funktion der Auseinandersetzung mit externen Situationslogiken.
Aber an der Konsequenz einer entsprechenden Situierung männlichen Verhaltens ist der Feminismus eklatant gescheitert! Aus der Perspektive der Feministin verstellt der Mann den Blick auf die Gesellschaft, was dazu führt, dass er mit ihr identifiziert wird. Es wird somit für Feministinnen unmöglich, in Betracht zu ziehen, dass die vermeintlich »männliche Norm« in Wirklichkeit bloß eine ist, die vom Mann an den Binnenraum der Gesellschaft weitergereicht wird, während er selbst versucht, extern vorgegebenen Herausforderungen gerecht zu werden.
Aus dieser Wahrnehmung, der Mann sei die Norm bzw. ihre Quelle, sei mit ihr identisch, erklärt sich das angestrengte und überreizte Dauer-Abgrenzungsbedürfnis des Feminismus gegen eine Sphäre des Männlichen. Der Differenzfeminismus versucht diesem Abgrenzungsdruck zu entgehen – aber er versucht dies auf dem Wege, gleich ganz auf jegliche Bezogenheit auf die männliche Sphäre zu verzichten. Würde das Normative des Männlichen tatsächlich nur idiosynkratische männliche Subjektivität enthalten, wäre diese Haltung folgerichtig. Drückt sich aber in dieser Sphäre ein Realitätsprinzip aus, das Männer nur in den Binnenraum der Gesellschaft hineinvermitteln, dann ist die feministische Abgrenzungsobsession mit der Gefahr eines Realitätsverlustes bedroht.
Anders gewendet: Es ist der alte Gegensatz von Lustprinzip und Realitätsprinzip, der von Schrupp und den Differenzfeministinnen so akzentuiert wird, dass das Lustprinzip als »weibliches Begehren« den Frauen und das Realitätsprinzip als »Patriarchat« den Männern zugeordnet wird. Das »Glück, eine Frau zu sein« wird dadurch zum Zentrum eines feministischen Narzissmus, dass es ignoriert, welchen Beitrag Männer allererst dazu leisten, es möglich zu machen – dadurch, dass sie sich in existenzieller Weise dem Realitätsprinzip stellen. Auf diese Weise hat der Feminismus die narzisstische Reduktion der Frau, von der Beauvoir spricht (Das andere Geschlecht, Rowohlt, S. 594 ff.) nicht überwunden, sondern beibehalten und wiederbelebt. Das schlägt sich auch in einem paradoxen Umgang Schrupps mit dem Begriff des Patriarchats nieder.
Das »Ende des Patriarchats«
Einerseits lässt sie eine realistische Problembetrachtung zu:
»Die Politik schafft nicht das Paradies auf Erden, und was sie erreicht und tut ist immer nur relativ gut oder schlecht und auch das ist noch Interpretations- und Ansichtssache. Klar ist jedenfalls: Die Welt ist schlechter, als sie sein könnte. Und deshalb sagen manche: Das Patriarchat ist nicht zu Ende.
Ich halte das nicht für sinnvoll. Als Politikwissenschaftlerin und vielleicht auch als Christin mit einem Sündenbegriff bin ich davon überzeugt, dass die reale Welt immer schlechter ist, als sie sein könnte, Patriarchat hin oder her. Das Patriarchat ist nicht dann zu Ende, wenn für Frauen paradiesische Zustände auf der Welt bestehen, denn erstens wird es die niemals geben, weil die Welt nun einmal nicht das Paradies ist, und zweitens stellen sich verschiedene Menschen – und also auch verschiedene Frauen – das Paradies auch noch unterschiedlich vor.
Das Patriarchat ist dann zu Ende, wenn Frauen in diesen Auseinandersetzungen und Diskussionen über die Regeln, die die Menschen auf dieser Welt einrichten, mitreden, verantwortlich mitdenken und entsprechend handeln«
Worauf Schrupp hinaus will, ist ein subjektivistischer Begriff des Patriarchats. Es geht um Vorstellungen in den Köpfen der Menschen und die Macht, die diese Vorstellungen über unsere Urteile und unser Verhalten ausüben können, und umgekehrt um die Möglichkeit, diese Macht durch einen sozusagen voluntaristischen Akt, theologisch formuliert: durch eine innere Wandlung aufgrund einer Offenbarung, von sich abzuschütteln – und dieser Akt des Abschüttelns ist zeitlos:
»Das heißt, das Ende des Patriarchats hat zwar eine historische Dimension – in den letzten hundert, den letzten dreißig Jahren hat sich vieles verändert – aber das ist nicht alles. Es gibt kein festes Datum, keinen bestimmten Zeitpunkt. Denn wenn das Patriarchat zu Ende ist, weil Frauen ihm die Glaubwürdigkeit entziehen, dann ist es schon immer zu Ende: (…) Es war zu Ende, als Jane Austen Bücher über weibliche Autorität schrieb, als Teresa von Avila neue Regeln für Frauenklöster erfand. Das Patriarchat ist dann zu Ende, wenn Frauen nicht mehr daran glauben. Es hängt nicht von den Männern, den Verhältnissen, den Gesetzen ab. Sondern davon, dass Frauen sich nicht am Maßstab des Patriarchats orientieren, dass sie ihm andere Maßstäbe entgegensetzten. Frauen, die sich an ihrem eigenen Begehren orientierten und es in den Austausch mit anderen Frauen und mit der Welt gebracht haben.«
Dies wirft freilich die Frage auf, inwieweit die Rede vom Patriarchat nicht überhaupt bloß Vorstellung ist – eine feministische Vorstellung mithin, die aus der zweiten Hälfte des Zwanzigsten Jahrhunderts auf die vergangene Weltgeschichte zurückprojiziert wird, bedeutende Frauen der Vergangenheit dabei für die eigene Geschichtserzählung in Beschlag nehmend. Denn was ist das eigentlich für ein Patriarchat, was ist das für ein Herrschaftssystem, dass sich mittels eines simplen Willensaktes abschütteln lässt, als ob es ein Bekenntnis zu Jesus Christus wäre? Ist es nicht eher ein zur männlichen Überverantwortlichkeit komplementärer Akt weiblicher Unterverantwortlichkeit, der sich um die »objektiven Verhältnisse« nicht schert und sie damit den Männern überlässt?
Dass es so sein könnte, ahnt Schrupp immerhin. Denn sie changiert zwischen diesem subjektivistischen und einem objektivistischen Verständnis des Patriarchats hin und her, wenn sie auf seine Ordnungsfunktion zu sprechen kommt:
»Das Patriarchat kann – als Denkschema, als Wertesystem, als Maßstab zur Interpretation der Welt und der menschlichen Beziehungen – keine Ordnung mehr schaffen, es schafft Unordnung, und Frauen, immer mehr Frauen, sprechen das überall auf der Welt aus und handeln entsprechend. (…) Denn das Patriarchat war zwar eine schlechte Ordnung, aber doch eine Ordnung, in deren Rahmen Dinge funktioniert haben, zum Beispiel die Versorgung alter und kranker Menschen. Die Frauen haben sich an einem gewissen Punkt geweigert, diese Arbeit unentgeltlich zu machen, mit der Folge, dass sie heute schlecht getan wird und die Gesellschaft teuer zu stehen kommt.«
Und an anderer Stelle sagt sie:
»(D)as Patriarchat ist umso mehr zu Ende, je unfähiger es sich erweist, die Probleme der Welt zu lösen und das Zusammenleben der Menschen zu regeln.«
Hier gesteht sie implizit mehr oder weniger die soziologische Binsenweisheit zu, dass jede Form von Herrschaft eine Ordnungsfunktion hat, und dass sie sich als legitime Herrschaft auf Dauer nur behaupten kann, wenn sie der Wohlfahrt der Herrschaftsunterworfenen in hinreichender Weise zuträglich ist, und dass ein Verlust dieser Zuträglichkeit ihren Legitimationsverlust nach sich zieht.
»Der Satz »Das Patriarchat ist zu Ende« ist also keine Aussage darüber, dass mit der Welt nun alles in Ordnung ist. Sondern er ist eine Bilanzierung und Würdigung der bisherigen Erfolge der Frauenbewegung und eine Beschreibung der objektiven Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, und von denen wir in jeder Tageszeitung lesen und in jeder Nachrichtensendung hören. (…) Das Wesentliche ist, dass Frauen – nicht alle Frauen, aber doch genügend Frauen – der patriarchalen Ordnung die Glaubwürdigkeit entzogen haben. Wir orientieren uns an anderen Maßstäben, wenn wir über uns, über die Welt und über gutes Leben nachdenken. (…) Damit ist auch klar, dass das Ende des Patriarchats keineswegs das Ende der Frauenbewegung ist, sondern im Gegenteil, ein neuer Anfang, eine neue Ausrichtung der Frauenbewegung. Ihre wichtigste Aufgabe ist es nun, diese weibliche Kultur zu stärken, sie sichtbar zu machen, ihr in der Welt Gehör zu verschaffen.«
Die Polarisierung zwischen einem zerstörenden Männlichen und einem rettenden Weiblichen ist nun aber, wie wir seit Christoph Kucklicks Bestimmung des unmoralischen Geschlechts wissen können, selbst nichts anderes eine der ältesten Schichten der modernen bürgerlichen Ideologie. Nur indem sie die Probleme der modernen Gesellschaft als »männliche« und »patriarchale« Probleme psychisch und ideologisch abspaltet, kann Schrupp für sich und ihre differenzfeministische Perspektive den Narzissmus des weltrettenden Weiblichen in Anspruch nehmen. Die Rede vom »Glück, eine Frau zu sein«, verströmt die Selbstverliebtheit dieses Anspruchs aus jeder Pore.
Und das meine ich, wenn ich eingangs von der Gleichzeitigkeit von Luzidität und Blindheit der Texte Antje Schrupps sprach. Verglichen mit der heutigen Generation der Netzfeministinnen hat Schrupp sich ein gewisses Maß an Hellsicht und Realismus bewahrt. Mit allen feministischen Generationen hat sie jedoch gemeinsam, dass sie die Unterscheidung zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen als die fundamentale und ursprüngliche Unterscheidung aller Unterscheidungen setzt. Die Perhorreszierung der Vorstellung, sich in irgendeiner Weise an dem als Norm imaginierten Männlichen zu orientieren, schließt dabei auch aus, ihm irgendeine Wertschätzung zukommen zu lassen. Das eingangs dokumentierte Bewusstsein Schrupps, auf Voraussetzungen aufzubauen, die man selbst nicht geschaffen hat, wird durch diese ideologische Polarisierung wieder negiert.

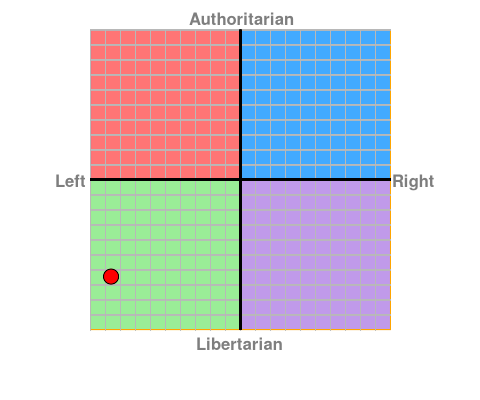
Schreibe einen Kommentar