20. Februar 2016
Am morgigen einundzwanzigsten Februar jährt sich zum hundertsten Mal der Beginn der Schlacht von Verdun, einer Schlacht, die sich bis zum 20. Dezember desselben Jahres hinzog, die nach nur zu schätzenden Zahlen dreihunderttausend deutsche und französische Männer das Leben kostete und eine weit größere Zahl an Verwundeten hinterließ – darunter viele dauerhaft versehrte Kriegsinvaliden -, die einen verwüsteten Landstrich produzierte, der in Teilen bis zum heutigen Tag nicht gefahrlos betreten werden kann, der immer noch gelegentlich menschliche und materielle Überreste der Schlacht freigibt und zu einem Symbol des Ersten Weltkriegs, der modernen, nämlich »industriellen« Kriegführung als solcher sowie des »Anfangs von Ende des bürgerlichen Zeitalters« (Wolfgang J. Mommsen) geworden ist. Welchen Reim können wir uns nach hundert Jahren auf dieses männermordende Gemetzel machen?
1916 ist das dritte Jahr des Großen Kriegs. Im ersten Jahr war der deutsche Versuch, Frankreich in einem Bewegungskrieg ähnlich dem von 1870 zu besiegen, an einer Überforderung der eigenen Kampfkraft gescheitert – Deutschlands Bevölkerung war um ein gutes Drittel größer als die Frankreichs, aber 1914 zu einem deutlich geringeren Anteil militärisch mobilisierbar, und die Armee musste auf zwei Fronten verteilt werden, sodass 1,7 Millionen deutsche zwei Millionen französischen sowie einhunderttausend belgischen und weiteren gut einhunderttausend britischen Soldaten gegenüberstanden. Diese zahlenmäßige Unterlegenheit des deutschen Heeres im Westen wurde zwar einerseits teilweise durch eine flexiblere Armeeorganisation und überlegene schwere Artillerie wettgemacht, führte aber andererseits auch zu einem Mangel an operativen Optionen, der durch ein risikoaverses und nervöses Verhalten der deutschen Heeresleitung noch verstärkt wurde, die in einem kritischen Augenblick des Vormarsches, der Marneschlacht, einen Rückzug des beweglichen rechten Flügels der Gesamtarmee anordnete und den Bewegungskrieg damit abbrach. Damit trat ein strategisches Patt ein, und die Westfront erstarrte im sogenannten »Wettlauf zum Meer« zum Stellungskrieg.
Im zweiten Jahr des Krieges konzentrierte sich Deutschland auf die Ostfront, kleinerenteils, um die russische Armee auf Abstand zur deutschen Grenze zu bringen, größerenteils, um die von der militärischen Niederlage bedrohte Armee Österreich-Ungarns zu entlasten, und war damit in beiden Hinsichten erfolgreich: Ende 1915 verlief die Ostfront von den östlichen Karpaten mitten durch das heutige Weißrussland ins Baltikum und zur Bucht von Riga. Russland löste Österreich als die am meisten unter militärischem Druck stehende Nation ab. Währenddessen gerieten die Versuche der Alliierten, im Westen die Initiative zu gewinnen, zu einer einzigen, mit hohen Verlusten bezahlten Enttäuschung, obwohl Italien an ihrer der Seite in den Krieg eintrat. Die Bereitschaft, verlustreiche Offensiven zu riskieren, kam nicht zuletzt daher, dass die Illusion eines »kurzen Krieges« noch nicht erloschen war und die Vorstellung, durch eine »letzte Anstrengung« eine militärische Entscheidung herbeizuführen, noch plausibel schien. Ende 1915 bereitet nunmehr Deutschland einen Versuch vor, im Westen die Initiative zu erlangen.
Beide Seiten hatten aus dem bisherigen Kriegsverlauf gelernt, dass Durchbruchserfolge im Frontalangriff kaum oder nur unter besonderen Randbedingungen zu erzielen waren. Der Gebrauch des Maschinengewehrs verschaffte dem Verteidiger unverhältnismäßige Vorteile: auch nach einem größeren Artillerieschlag reichten wenige Überlebende mit intakten Maschinengewehren aus, um den jeweils nachfolgenden Infanterieangriff abzuwehren. Die deutsche Westfront hielt 1915 stand, obwohl zwei Drittel des deutschen Heeres im Osten eingesetzt waren. Der deutsche Durchbruch in der Schlacht von Gorlice-Tarnów 1915, der zu einem umfassenden Rückzug der zaristischen Armee und zur gewünschten Entlastung Österreich-Ungarns führte, war eine Ausnahme und hauptsächlich schweren Fehlern der russischen Führung geschuldet, die den betreffenden Frontabschnitt zu schwach besetzt hatte und die Vorteile eines Stellungssystems nicht auszunutzen wusste, während die gegen sie eingesetzten deutschen Truppen über entsprechende Erfahrungen an der Westfront verfügten. Zu einem strategischen Durchbruch wurde der Erfolg zudem durch die geringere Mobilität der russischen Armee, die es versäumte, gegen den lokalen Durchbruch Reserven einzusetzen.
Im Westen ließ sich auf solche Fehler nicht spekulieren. Das Konzept, das den gewünschten Erfolg bringen sollte, beruhte Anfang 1916, nach der Auswertung der Erfahrungen des vorangegangenen Jahres, sowohl auf deutscher als auch auf alliierter Seite auf der Vorstellung eines »Durchbruchs über Bande«, das heißt: auf der Vorstellung, dass ein Durchbruch möglich wird, wenn man den Gegner dazu verleiten kann, in der Verteidigung gegen einen primären Angriff seine Reserven zu verbrauchen. Zahlenmäßig steht Deutschland erneut schlechter dar: 2,4 Millionen deutsche stehen 3,5 Millionen französischen und britischen Soldaten gegenüber. Andererseits sind die insgesamt mobilisierbaren Reserven Deutschlands im Vergleich zu denen Frankreichs größer, es scheint also die Chance zu bestehen, die französischen Reserven zu verschleißen. Der deutsche Generalstabschef Falkenhayn spekuliert zudem auf einen verlustreichen Entlastungsangriff der Briten, sollte Frankreich an einer Stelle angegriffen werden, die das Land nicht würde aufgeben wollen. Der Gedanke einer »letzten äußersten Kraftanstrengung« erscheint der deutschen Führung unter diesen Umständen als plausibel. Ziel ist dabei nicht die operative Besetzung des französischen Territoriums insgesamt, sondern eine politisch umzumünzende Demonstration deutscher militärischer Überlegenheit, die den französischen Widerstandswillen brechen und einen politischen Siegfrieden herbeiführen soll. Die französische Front soll durchbrochen und in einem Bewegungskrieg aufgerollt werden, spätenstens im Mai 1916 soll der Krieg zugunsten Deutschlands entschieden sein.
Zunächst zieht Falkenhayn einen Angriff bei Belfort in Betracht, dem Tor nach Burgund und einem Anker des französischen rechten Flügels. Bei Verdun dagegen bedinden sich die deutschen Stellungen bereits näher an der Festung, der bestehende Frontbogen macht nachfolgende Umfassungsangriffe möglich und beseitigt einen möglichen Startpunkt für gegnerische Zangenangriffe, die Hauptangriffsrichtung nach Süden macht bei vorherrschenden Westwinden Gasangriffe möglich, und anders als im Raum zwischen den Vogesen und der Schweizer Grenze sind vor Verdun ausholende operative Manöver möglich. Mit der Entscheidung für Verdun fällt der geplante Angriff in den Bereich der vom Kronprinzen Wilhelm von Preußen befehligten Fünften Armee, die nun aus den strategischen Reserven des Westheeres für den Angriff aufgestockt wird. Faktisch wird die Fünfte Armee aber nicht vom Kronprinz angeführt, der etwas von einem »politischen General« an sich hat, sondern vom Chef des Stabes der Fünften Armee, Generalleutnant Constantin Schmidt von Knobelsdorf, der bald alle wesentlichen Entscheidungen an sich ziehen und nicht nur seinen unmittelbaren Vorgesetzten, sondern auch General Falkenhayn erfolgreich manipulieren wird.
Auf der französischen Seite bleibt die Konzentration deutscher Truppen bei Verdun nicht unbemerkt, und die Überlegungen zu einer angemessenen Reaktion darauf entfalten politische Sprengkraft innerhalb eines politischen Spannungsdreiecks zwischen Parlament, Regierung und Oberkommando. Die Misserfolge von 1915 belasten die Reputation der Armeeführung, das Parlament insistiert auf seiner Aufsicht über die Exekutivgewalt. Hinter den im engeren Sinne politischen Konflikten steht aber auch der gesellschaftliche Konflikt zwischen einem konservativ-katholischen und einem republikanisch-antiklerikalen Lager, der sich schon 1894 in der Dreyfus-Affäre entladen hatte, und von dem der engere Konflikt um die richtige Kriegsstrategie überladen wird. Das Oberkommando hat General Joffre, Raymond Poincaré ist Staats- und Aristide Briand Ministerpräsident. Joffre erwägt, entgegen Falkenhayns Kalkül, eine Räumung der Stadt und eine Verkürzung des Frontbogens, hat aber das Misstrauen der politischen Gewalten gegen sich, und der schwelende Konflikt ist empfindlich für einen Zündfunken, der ihn offen entflammen lässt. Diesen Zündfunken liefert der im Palais Bourbon persönlich vorgetragene Bericht eines Frontoffiziers, des Oberst Driant, über den beklagenswerten Zustand der Feldbefestigungen bei Verdun. Die Stadt und ihr Festungssystem werden daraufhin zum politischen Symbol, weil beide Seiten an ihr ihre Kompetenz und Legitimität unter Beweis stellen wollen.
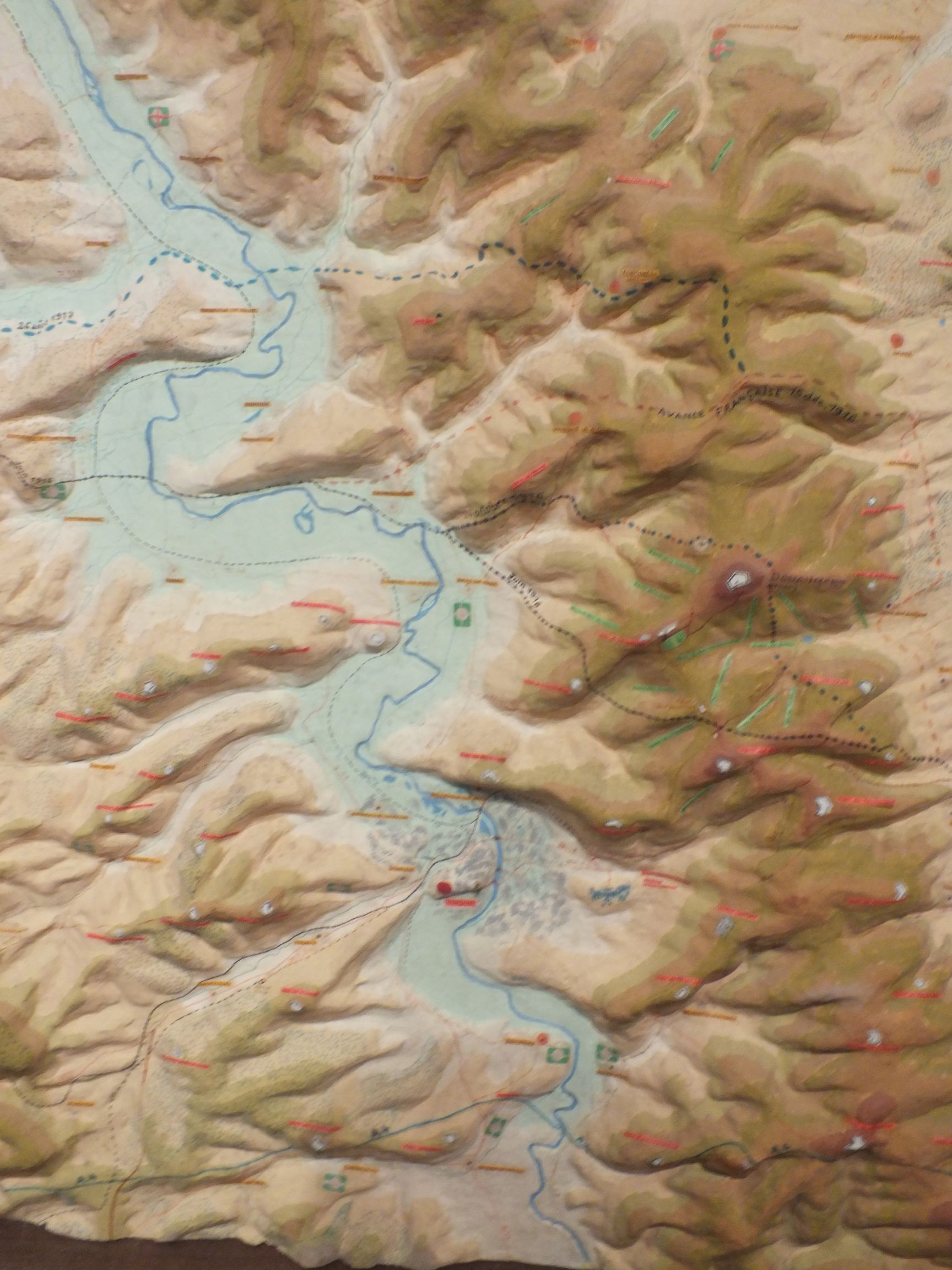
(Abb. 1: Geländemodell der Maashöhen)
Verdun ist ein Teil des nach dem Krieg von 1870 angelegten ostfranzösischen Festungsgürtels, der barrière de fer, die bei Verdun aus einigen baulich älteren und einigen modernen Forts besteht, die in einem nahezu quadratischen Layout und zweifach gestaffelt um die Stadt herum angeordnet sind. Ihr östlicher Teil liegt in den Côtes de Meuse, einem schmalen, mittelgebirgsartigen Höhenzug zwischen dem Maastal und den weiten, offenen Ebenen der lothringischen Woëvre im Osten. Den deutschen Truppen, die den nordöstlichen Winkel dieses Befestigungssystems durchbrechen müssen, steht also bevor, eine Landschaft gut befestigter Bergwälder zu erstürmen, bevor sie die im Tal gelegene Stadt erreichen beziehungsweise die Franzosen zum erhofften verlustreichen Gegenangriff auf die Höhen aus dem Maastal heraus verleiten können. Auch westlich der Maas gibt es einen Höhenzug, der allerdings zunächst nicht in die Angriffsplanungen einbezogen wird. Denn Falkenhayn will nur im Osten angreifen lassen und verwässert den Angriffsplan Schmidt von Knobelsdorfs. Er will Reserven entweder für eine weitere Offensive im nordfranzösischen Artois oder für ein strategisches »Nachstoßen« bei Verdun zurückzubehalten, und kalkuliert, dass die Entscheidung bei Verdun ganz wesentlich nicht von deutschen Truppenmassen, sondern von einer Massierung der überlegenen schweren Artillerie, darunter der »Lange Max« (ein 38-cm-Marinegeschütz) und einer Batterie der »Dicken Bertha« (einem 42-cm-Mörser), herbeigeführt werden soll. 1225 Geschütze aller Kaliber und zweieinhalb Millionen Granaten Munitionsreserve für die ersten sechs Kampftage stehen für die Schlacht bereit.
Zudem »420.000 Stielhandgranaten, 18.000 Drahtscheren, 24.000 Infanterie-Schutzschilde, 560.000 Leuchtsignalpatronen, 52.500 Spaten, 52.500 Kreuzhacken, 21.000 Äxte, 1.100 Tonnen Stacheldraht, 55 Tonnen Bindedraht, 14.000 Spanische Reiter, 105.000 Kubikmeter Bretter und Bohlen, 2.100.000 Sandsäcke«.
Jessen 2014, S. 86
Ursprünglich wird der 12. Februar für den Beginn der Schlacht festgelegt, dichter Nebel, Regen und Schneefall erzwingen jedoch eine Verschiebung. Am Montag, den 21. Februar, herrscht zwar Frost, aber der Himmel ist klar und die Sonne scheint. Um 7:12 Uhr beginnt der Artillerieschlag, er ist noch in sechzig Kilometer Entfernung als Vibration zu spüren und bis zur einhundertfünfzig Kilometer entfernten Vogesenfront akustisch vernehmbar. Um 9:00 Uhr beginnen die Mörser zu schießen, und um 15:00 Uhr wird für eine Stunde die Feuergeschwindigkeit zum dreifachen Munitionsverbrauch gesteigert. Nach fast neun Stunden ist um 16:00 Uhr das Artilleriefeuer beendet. Der Angriff ist historisch präzedenzlos, die Wirkung auf Gelände, Körper und Psyche verheerend, außer an Explosionen und Granatsplittern sterben die Verteidiger durch Lungenriss und Gehirnblutung aufgrund der Druckunterschiede während der Detonationsserien. Als die deutsche Infanterie angreift, leisten die Chasseurs des Oberst Driant, dessen Vortrag in Paris die politische Kontroverse über die militärische Strategie katalysiert hatte, einen exemplarisch zum Heldenmythos stilisierten Widerstand, der tatsächlich nicht viel heldenhafter war als der anderer Einheiten auch. Der Widerstand ist jedoch stärker als erwartet, weil die Wirkung der Artillerie geringer ist, als ihre optische und akustische Erscheinung glauben macht. Stacheldrahtverhaue werden oft nicht zerstört, sondern nur vom Luftdruck angehoben, schwere Granaten dringen tief in die Erde, bevor sie explodieren, was ihre Sprengwirkung auf Menschen und Befestigungen einschränkt, obwohl das hochgeschleuderte Erdreich und die Qualmwolke den gegenteiligen Eindruck erweckt. Maschinengewehrnester und Scharfschützen verlangsamen das Vorrücken der deutschen Angreifer und verursachen höhere Verluste als geschätzt. Das wiederholt sich in den nächsten Tagen bei jedem weiteren Vorstoß, und obwohl am 25. Februar durch einen glücklichen Handstreich das unterbesetzte Fort Douaumont, die modernste und stärkste Befestigung des Festungsgürtels um Verdun, erobert wird, was einen Siegestaumel in Deutschland und einen Schock in Frankreich auslöst, konstatiert der Heeresbericht bereits am 27. Februar erstmals »nirgends Erfolg«.

(Abb. 2: »Dünenlandschaft« in armiertem Beton: das Dach des Forts Douaumont)
Es zeigte sich nun schnell, dass der deutsche Kräfteansatz zu schwach war, um trotz hoher Verluste zügig bis an den Rand des Maastals durchzustoßen, und ebenso zeigte sich, dass der Verzicht auf den Angriff am Westufer ein schwerer Fehler war, denn von den dortigen Positionen aus konnte die französische Artillerie sehr kontrolliert das Feuer auf den deutschen Angriffssektor im Osten richten und dem Gegner anhaltend schwere Verluste zufügen. Verdun wurde so schon nach kurzer Zeit für beide Seiten zur artilleriedominierten Schlacht. Das Verhältnis der deutschen und französischen Verluste hielt sich anders als vorauskalkuliert ungefähr die Waage – bis Ende Februar jeweils ungefähr 25.000 Mann, und Knobelsdorf begann bereits Ende Februar, die Schätzung der französischen Verluste in den Meldungen an seine Vorgesetzten wissentlich zu übertreiben. Auf der anderen Seite hatte sich die französische Regierung zum unbedingten Widerstand bei Verdun entschlossen und schickte ohne Unterlass Verstärkungen an Menschen und Material auf das Schlachtfeld. Zwar war der Oberbefehlshaber Joffre niemals auf ein unbedingtes Halten von Stadt und Festung festgelegt, aber der Mann, der am 26. Februar das Kommando über den Sektor Verdun erhielt, General Pétain, richtete seine Planungen so aus, als bestünde ein entsprechender Befehl. Sein »Operationsbefehl Nr. 1« vom selben Tag ordnete an, jeden Vorstoß des Gegners mit einem »sofortigen Gegenangriff« zu kontern.
Damit war eine schnelle Eroberung des Festungsbezirks und der Stadt Verdun durch die Deutschen bereits wenige Wochen nach Beginn der Schlacht gescheitert. Anstatt ihren Angriff mit frischen Truppen bis an den Rand der Maashöhen fortzutragen, müssen sie einen um den anderen französischen Gegenangriff abwehren und das französische Artilleriefeuer ebenso ertragen wie die Franzosen das der Deutschen, denn Pétain hat die französische Artillerie zu geschlossenen Gruppen reorganisiert. Im März wird der deutsche Angriff daher notgedrungen doch noch auf das Westufer erweitert. Dort, auf der Höhe »Toter Mann«, die in dieser Schlacht durch Artilleriebeschuss angeblich um sechzig Höhenmeter abgetragen wird, verbeißen sich die Gegner erstmals in kurzfristige Abfolgen von Angriffen und Gegenangriffen um wenige Meter Gelände, und vermischen sich erstmals dauerhaft Erdreich, Schanzwerk, Ausrüstung, Granatsplitter und die Überreste menschlicher Körper zu jener nicht mehr aufräumbaren, nach Verwesung stinkenden Masse, die schließlich für das ganze Kampfgelände auf beiden Seiten der Maas charakteristisch wird. Diejenigen deutschen Offiziere, die Verlauf und Charakter der Kämpfe aus eigener Anschauung kennen, glauben bereits Mitte März nicht mehr an einen Erfolg der deutschen Offensive.
Dennoch wird der Kampf noch monatelang fortgeführt, und es ist diese unentwegte Fortsetzung der Schlacht trotz ausbleibender Erfolge, horrender Verluste und völlig unmenschlicher Existenzbedingungen auf dem Schlachtfeld, die »Verdun« zu dem Inbegriff des militärisch organisierten Wahnsinns werden ließ. Wie kam es dazu? Zum einen ist der Krieg an der Westfront der Krieg einer »Châteaux-Generalität«. Die höheren Offiziere sitzen in rückwärtigen Kommandoposten (im Falle der Fünften Armee in Stenay, einem kleinen Städtchen an der Maas fünfzig Kilometer nördlich von Verdun), einquartiert in geräumigen französischen Immobilien, mit Blei- und Farbstiften über Karten gebeugt, deren Genauigkeit und Aktualität dem tatsächlichen Gang der Ereignisse kaum einmal entspricht, und hantieren mit Zahlen und Reports, die das Elend der Kämpfe auf nüchterne Zusammenfassungen kondensieren. Praktisch niemals lernen sie die Kampf- und Existenzbedingungen der von ihnen befehligten Soldaten aus eigener Anschauung kennen. Die Stimmungen und Einschätzungen der Offiziere vor Ort dringen nicht bis zur Führung durch. Die Ignoranz der höheren Eben ist dabei durchaus nicht selbstverständlich. Olaf Jessen verweist auf die ursprüngliche Idee der preußischen Militärführung:
»Das preußisch-deutsche Generalstabsystem setzt auf wechselseitige Aufsicht und Beratung. Korpsgeist und eine sachlich begründete, rückhaltlose Offenheit sollen dafür die Grundlage bieten – sowohl im Verhältnis zwischen Oberbefehlshaber und Stabschef als auch in den Beziehungen aller Generalstabsoffiziere untereinander. (…) Diese Überlieferung ist in Stenay zerbrochen. Alle Beziehungen wechselseitiger Aufsicht und Beratung haben versagt oder werden versagen: zwischen Kaiser und Generalstabschef [Falkenhayn], zwischen Generalstabschef und seinem Oberbefehlshaber in Stenay [Kronprinz Wilhelm], zwischen dem Oberbefehlshaber in Stenay und dessen Chef des Stabes [Knobelsdorf], zwischen dem Chef des Stabes und seinem Ersten Generalstabsoffizier [Gerhard von Heymann].«
Jessen 2015, S. 233 f.
Hauptakteur ist Constantin Schmidt von Knobelsdorf, der Verdun zu »seiner« Schlacht macht. Die Urteile seines »I a« Heymann, denen zufolge die Vorstellung, Frankreichs Armee würde sich auf dem Schlachtfeld »verbluten«, völlig abwegig und dass der Angriff bei Verdun gescheitert und daher einzustellen sei, ignoriert er und fordert ihn stattdessen auf, dem Kronprinzen die Lage schönzureden. Der Kronprinz wiederum ist Befehlshaber der Fünften Armee nur aus politischen Gründen, ein »militärischer Lehrling« (Jessen), der »spannende Gefechtstage« wie ein Zuschauer (aus hinreichender Entfernung) verfolgt, beschwert sich über den ruppigen Ton Knobelsdorfs, ist entsetzt über dessen Bereitschaft, Verluste hinzunehmen und sucht doch gleichzeitig dessen Anerkennung, anstatt seinen höheren Rang für die Durchsetzung sachgerechterer Entscheidungen zu nutzen. Und während Knobelsdorf gegenüber seinen Vorgesetzten über die eigenen Verluste schlicht lügt, lügt er sich über die angeblichen französischen Verluste vor allem selbst in die Tasche, da diese nur geschätzt werden können. Beides zusammen ermöglicht es den Beteiligten weiter oben in der Hierarchie allerdings, sich zu Verdun in reinem Wunschdenken zu ergehen. Dennoch führen die ausbleibenden Erfolge bei Falkenhayn zu merklicher Unsicherheit und Ratlosigkeit. Denn inzwischen wird auch klar, dass die Alliierten für den Sommer eine eigene Offensive vorbereiten, gegen die das deutsche Heer Reserven wird zurückbehalten müssen.

(Abb. 3: Trichterlandschaft auf den Maashöhen)
Das militärische Problem der Deutschen ist derweil, dass die Armee vor Verdun auf halbem Weg zwischen Ausgangsstellungen und Schlüssellinie (dem Rand der Côtes de Meuse) in einer taktisch ungünstigen Lage feststeckt und nach Maßstäben militärischer Rationalität entweder diese Schlüssellinie endlich erreichen oder aber in die Ausgangsstellungen zurückgehen muss. Letzteres wäre aber ein offenes Eingeständnis der Niederlage. Also fordert Falkenhayn von Knobelsdorf zwar das Einnehmen der Schlüssellinie, gibt ihm dafür aber keinerlei Fristen (und damit ein Abbruchkriterium) vor. Stattdessen beginnt er sich selbst einzureden, dass das »Verbluten« der französischen Armee kein Mittel zum Zweck für den Übergang zum Bewegungskrieg, sondern ein Selbstzweck sei.
»Damit überlässt er die Entscheidung über Weiterführung oder Abbruch der Offensive dem Chef des Stabes in Stenay – und den Zugriff auf eine Schlacht, die ursprünglich den Angelpunkt des Weltkrieges bilden sollte. (…) Spürbar verunsichert, entgleitet ihm die persönliche wie strategische Führung. Umso haltloser gerät Falkenhayn ins Kielwasser des Willensmenschen aus Stenay.«
Jessen 2015, S. 242
Es ist Anfang April, als Knobelsdorf auf diese Weise auf deutscher Seite zum faktischen Alleinherrscher über die Schlacht von Verdun wird. Unter Umgehung des Kronprinzen, seines Vorgesetzten, wird er durch Intrigieren bei Falkenhayn bis Ende des Monats auch die Ablösung seines »I a« Heymann erreichen, dessen realistische Lagebeurteilungen ihm zu lästig geworden sind.
Die Franzosen streiten derweil um den französischen Beitrag zu der von den Briten für den Sommer geplanten Offensive an der Somme, von der sich der britische Oberbefehlshaber Haig erhofft, er könne mit ihr bis an den Rhein vorstoßen. Pétains Verteidigung von Verdun bindet starke Kräfte, da er die französischen Truppen in schneller Folge rotieren lässt: anders als die deutschen Truppen bleiben sie nur acht bis zehn Tage in der Hauptkampflinie und werden dann an andere Frontabschnitte verlegt. Der größere Teil des französischen Feldheeres hat daher am Kampf um Verdun teilgenommen, »fast jeder Soldat in französischer Uniform ist ein Verdun-Kämpfer«. (Jessen 2015, S. 225) Pétain benennt dieses System nach einem Wasserschöpfrad »noria«, weil es in schneller Folge frische Truppen auf das Schlachtfeld bringt und vergleichsweise schnell wieder abzieht. Pétain und die Regierung geben Verdun weiterhin die Priorität, Joffre wiederum macht den Briten hinter dem Rücken seiner Regierung Zusagen. Das französische Parlament gewinnt immerhin eine hinreichende Kontrollmacht über das Militär zurück und erlangt im Unterschied zum Deutschen Reichstag ein durchaus realistisches Bild der Lage.
Vor Verdun machen die deutschen Truppen noch einige geringere Geländegewinne: sie erobern Anfang Juni das Fort Vaux und kämpfen sich Ende Juni bei dem Dörfchen Fleury noch ein Stückchen weiter auf die Schlüssellinie zu, diesmal unter mehrfachem Einsatz von Diphosgen-Giftgas, das sich beim Einatmen in der Lunge zu Salzsäure umsetzt und das Opfer unter starken Schmerzen und Hustenkrämpfen bei vollem Bewusstsein ersticken lässt – »Grünkreuzschießen« heißt dieser Waffeneinsatz im Militärjargon. Aber den Franzosen stehen nach früheren bösen Erfahrungen mit Gasangriffen effiziente Gasmasken zur Verfügung, und ihre Verluste halten sich in Grenzen. Am 1. Juli beginnt die britisch-französische Offensive an der Somme, weshalb am 12. Juli vom Oberkommando des Heeres die vorläufige Einstellung der Angriffe bei Verdun befohlen wird – vor Ort kommt es den August hindurch noch zu »kleineren Angriffshandlungen«, die zu führen Knobelsdorf durch Falkenhayn ermächtigt blieb. Am 18. August hat schließlich auch Knobelsdorf die Geduld seiner Vorgesetzten nach einer erneuten unrealistischen Angriffsplanung endgültig überreizt – dem Kronprinz platzt endlich der Kragen, und er staucht ihn brüsk zusammen, sodass Knobelsdorf seinen Rücktritt einreicht (er wird nunmehr das X. Armeekorps an der Ostfront befehligen). Erst am 2. September wird – nicht mehr von Falkenhayn, sondern vom neuen Oberbefehlshaber Paul von Hindenburg – die endgültige Einstellung der Offensive befohlen – was die Schlacht nicht beendet, sondern die Phase der französischen Gegenangriffe eröffnet. Auch Frankreich setzt nun Schwerstartillerie ein, unter anderem gegen das Fort Douaumont, das am 24. Oktober erobert wird. Fort Vaux wird am 2. November von den Deutschen geräumt. Bis zum 20. Dezember, dem Ende der französischen Gegenangriffe, geht der größere Teil der deutschen Geländegewinne auf den Maashöhen wieder verloren.
Die Verlustzahlen der Schlacht von Verdun wurden nicht nur von den Beteiligten während ihres Verlaufs, sondern auch von den Zuschauern und der Nachwelt aufgebläht, nachdem Verdun zum Symbol geworden war. Während der Schlacht betrafen die Übertreibungen die unterstellten Verluste des Gegners, nach der Schlacht dienten die übertriebenen Verlustzahlen dazu, ersatzweise den Schrecken der Ereignisse zu repräsentieren. Bis zu einer Million Tote wurden da genannt. Nach der Schätzung Jankowskis starben tatsächlich 160.000 Franzosen und 140.000 Deutsche. Rechnet man die Verwundeten hinzu, kommt man auf jeweils ungefähr 375.000 Mann für jede Seite, also eine Dreiviertelmillion insgesamt. Die relativen Verluste im Bewegungskrieg, 1914 im Westen und 1915 im Osten, waren höher. Die Eigentümlichkeit der Schlacht von Verdun lag darin, dass den Verlusten keinerlei militärische Gewinne entsprachen: kein Geländegewinn, keine Wegnahme strategischer Positionen, kein Zugewinn ökonomischer Ressourcen, keine Erschütterung von Kampfmoral oder politischer Stabilität des Gegners. Die Schlacht war einfach nur ein »sich langsam hinziehendes Opfern vieler Menschenleben« (Jankowski 2015, S. 171).

(Abb. 4: Der große Soldatenfriedhof am Beinhaus von Douaumont)
Der Charakter von »Verdun« kann für den Charakter des Krieges als Ganzem stehen: sein zentrales Merkmal besteht darin, aus gescheiterten oder verweigerten Lernprozessen zu bestehen. Der Klappentext zu Jörg Friedrichs »14/18« formuliert:
»Am Ersten Weltkrieg trägt niemand Schuld, er war ein von Europa selbstgewähltes Verhängnis. Aus der Hochblüte gemeinsamer Kunst, Wissenschaft und Wirtschaft brachen die Destruktivkräfte über Nacht hervor wie eine Pandemie, die den Kontinent zerfraß. Die Waffen produzierten keine Sieger, die Politik fand keinen Kompromiß. Feindschaft überall. (…) Die Frage ist nicht, wie es anfing, sondern warum es nicht aufhörte. Warum Millionen junger Europäer einander vier Jahre lang ausmerzten, als ginge es um eine Rattenplage.«
Verdun deutet erstmals an, was Auschwitz unabweisbar werden lässt: dass die Oberfläche einer brillanten Zivilisation noch keine Garantie für die Überwindung von Barbarei bietet. Gewalt ist eine Funktion – oder eine Dysfunktion – sozialer Organisation: sind entsprechende Kontexte gegeben, dann lassen sich in menschlichen Individuen Dispositionen wecken, mit denen Fortleben ein naiver Zivilisationsbegriff nicht mehr gerechnet hat. Denn die Zivilisation des Menschen ist nicht gleichbedeutend mit einer Aufhebung oder Neukonstruktion seiner Natur, seiner Psyche und seiner Antriebe. Sie bietet allenfalls die Chance, sich zur eigenen Natur reflexiv zu verhalten, ihre Impulse durch Ausrichtung auf kulturell definierte Ziele zu mediatisieren, und Kontexte sozialen Vertrauens zu schaffen, die den Rekurs auf Gewaltgebrauch obsolet machen. Aber wann immer solche Kontexte sozialen Vertrauens geschliffen und abgebaut werden, werden die gewaltaffinen Dispositionen zur spontanen, egoistischen Selbstbehauptung wieder zum Vorschein kommen.
Solche Probleme über die Geschlechtskategorie zu bürsten, wie es eben erst Karen Duve wieder versucht hat, führt in die Irre: mit einer gewissen Zuspitzung – wenn man Constantin Schmidt von Knobelsdorf vereinfachenderweise zum Hauptbösewicht erklärt – kann man das Verhältnis von Männern als Täter und Männern als Opfer in Verdun mit dem Faktor 1 : 750.000 veranschlagen. Nicht »warum haben Männer so etwas getan?« ist hier die angemessene Frage, sondern: »warum haben Männer so etwas ertragen«? Als sich französische und deutsche Kriegsinvaliden in einem Lazarett in der neutralen Schweiz begegneten, erhoben sie ihre Krücken gegeneinander – aber nicht, um damit aufeinander loszugehen, sondern, wie sich Elias Canetti erinnert, um sich mit beißender Ironie zu grüßen:
»Einer der Franzosen drehte sich noch zurück, hob seine Krücke in die Luft, fuchtelte ein wenig mit ihr und rief den Deutschen, die nun schon vorüber waren, zu: ›Salut!‹ Ein Deutscher, der es gehört hatte, tat es ihm nach, auch er hatte eine Krücke, mit der er fuchtelte, und gab den Gruß auf Französisch zurück: ›Salut‹! Man könnte denken, wenn man das hört, dass die Krücken drohend geschwungen wurden, aber das war keineswegs so, man zeigte einander zum Abschied noch, was einem gemeinsam geblieben war: Krücken.«
Canetti, zit. n. Leonhard 2014, S. 564
Wenngleich der Erste Weltkrieg nicht mehr, wie noch der Amerikanische Bürgerkrieg, dem »medizinischen Mittelalter« angehörte, so wurden die Fortschritte der Chirurgie durch die Auswirkungen moderner Artillerie wieder konterkariert – das Schicksal der Kriegsinvaliden ist freilich ein Thema für sich.
Bertolt Brechts Ansicht über das Verhältnis des weiblichen Geschlechts zum Militarismus war nicht gnädiger, man höre in der Legende vom toten Soldaten genauer hin:
»Und wenn sie durch die Dörfer ziehn | Waren alle Weiber da. | Die Bäume verneigten sich. Vollmond schien. | Und alles schrie hurra! – Mit Tschingdrara und Wiedersehn | Und Weib und Hund und Pfaff | Und mitten drin der tote Soldat | Wie ein besoffner Aff.«
Brecht 2005, S. 199 ff.
In der Zeit des Großen Kriegs war die sozialistische Antikriegsbewegung stärker als die feministische:
»Nur wenige Feministinnen aber nahmen an der Antikriegsbewegung teil. Der Nationalismus war vielleicht ›nur für Männer‹ bestimmt, aber Frauen – auch erklärte Feministinnen – konnten trotzdem in der damaligen Nationalbewegung ihren Platz finden. Schon vor dem Ersten Weltkrieg akzeptierten die meisten Frauenvereine – häufig mit offener Begeisterung – die nationalistische Phraseologie jener Tage, und während des Krieges ließ ein Teil von ihnen ihre eigenen chauvinistischen Redensarten verlauten.«
Volkov 2001, S. 80
Die Identifizierung einer ganzen Kultur mit »Männlichkeit«, um einen Krieg gegen sie zu rechtfertigen, ist einer heute verbreiteten Einstellung dem Islam gegenüber nicht völlig unähnlich und lässt sich zum Beispiel an den britischen Feministinnen Emmeline und Christabel Pankhurst demonstrieren:
»Bereits vor dem Krieg benutzten die beiden unumwunden die für den Nationalismus charakteristische Sprache, und im Jahre 1916 riefen sie öffentlich zum Beitrag der Frauen im Krieg aufgrund ihres ›natürlichen Patriotismus‹, ihres ausgeprägten Pflichtbewußtseins, ihres bewiesenen Mutes und dergleichen auf. Nach den damaligen Kategorien wurde Deutschland als eine ›männliche Nation‹ eingestuft und das Preußentum als ›bis auf einen abscheulichen Grad radikalisierte Männlichkeit‹. Der Aufruf zum Sieg über einen solchen Feind war daher selbstverständlich, und der Krieg gegen ihn konnte sogar als Fortsetzung des Kampfes für Frauenrechte gelten. Der Übergang vom Feminismus zum Nationalismus in Europa des frühen 20.Jahrhunderts ging schnell und mit Leichtigkeit vor sich«.
Volkov 2001, S. 80 f.
In diesem Sinne möchte ich den heutigen Blogpost mit einer nicht ganz unpathetischen These beschließen: die Welt wird nicht schlecht durch das, was Männer tun, sondern durch das, was Männer sich bieten lassen.

(Abb. 5: Der wahre Grund für Europa – Kapelle »Notre Dame de l’Europe« in Fleury-devant-Douaumont)
Was wäre ein Blogeintrag ohne Agitpropkultur:
Alle Abbildungen vom Verfasser, Sommer 2015.
Literatur:
- Brecht, Bertolt (2005), Ausgewählte Werke in sechs Bänden. Bd. 3: Gedichte 1. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
- Friedrich, Jörg (2014), 14/18. Der Weg nach Versailles. Berlin: Propyläen
- Jankowski, Paul (2015), Verdun. Die Jahrhundertschlacht. Frankfurt a. M.: S. Fischer
- Jessen, Olaf (2014), Verdun 1916. Urschlacht des Jahrhunderts. München: C. H. Beck
- Keegan, John (2001), Der Erste Weltkrieg. Eine europäische Tragödie. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt
- Leonhard, Jörn (2014), Die Büchse der Pandora. Geschichte des Ersten Weltkriegs. München: C. H. Beck
- Mommsen, Wolfgang J. (2004), Der Erste Weltkrieg. Anfang vom Ende des bürgerlichen Zeitalters. Frankfurt a. M.: Fischer
- Stevenson, David (2006), 1914 – 1918. Der Erste Weltkrieg. Düsseldorf: Artemis & Winkler
- Volkov, Shulamit (2001), Das jüdische Projekt der Moderne. Zehn Essays. München: C. H. Beck

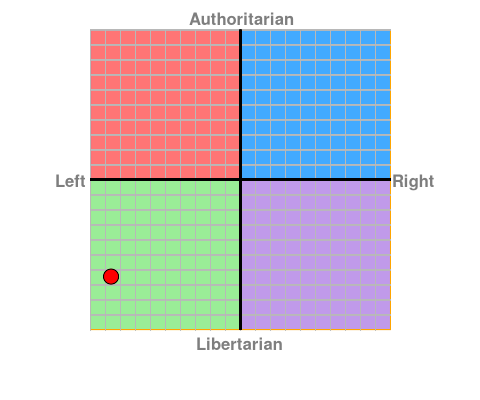
Schreibe einen Kommentar